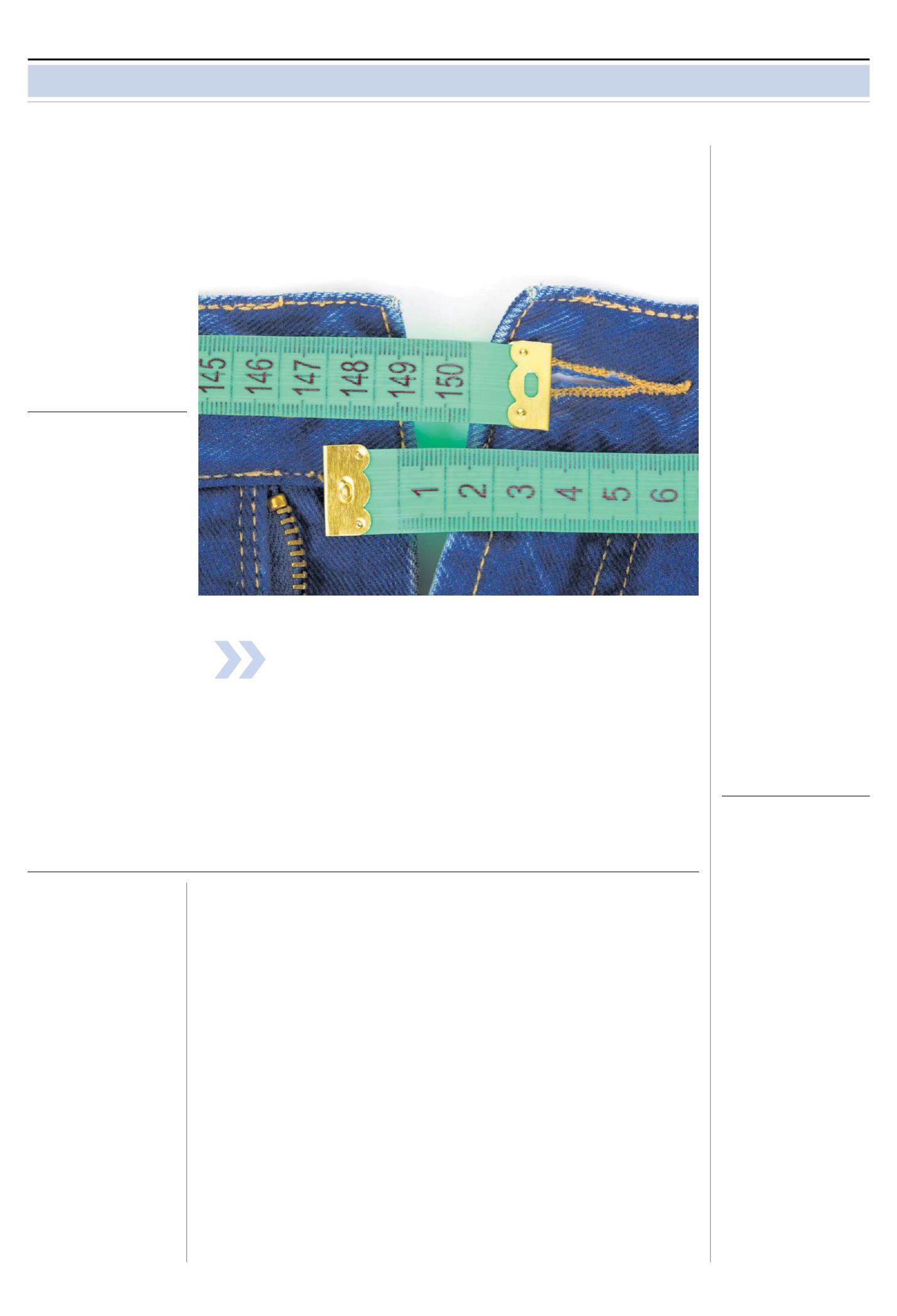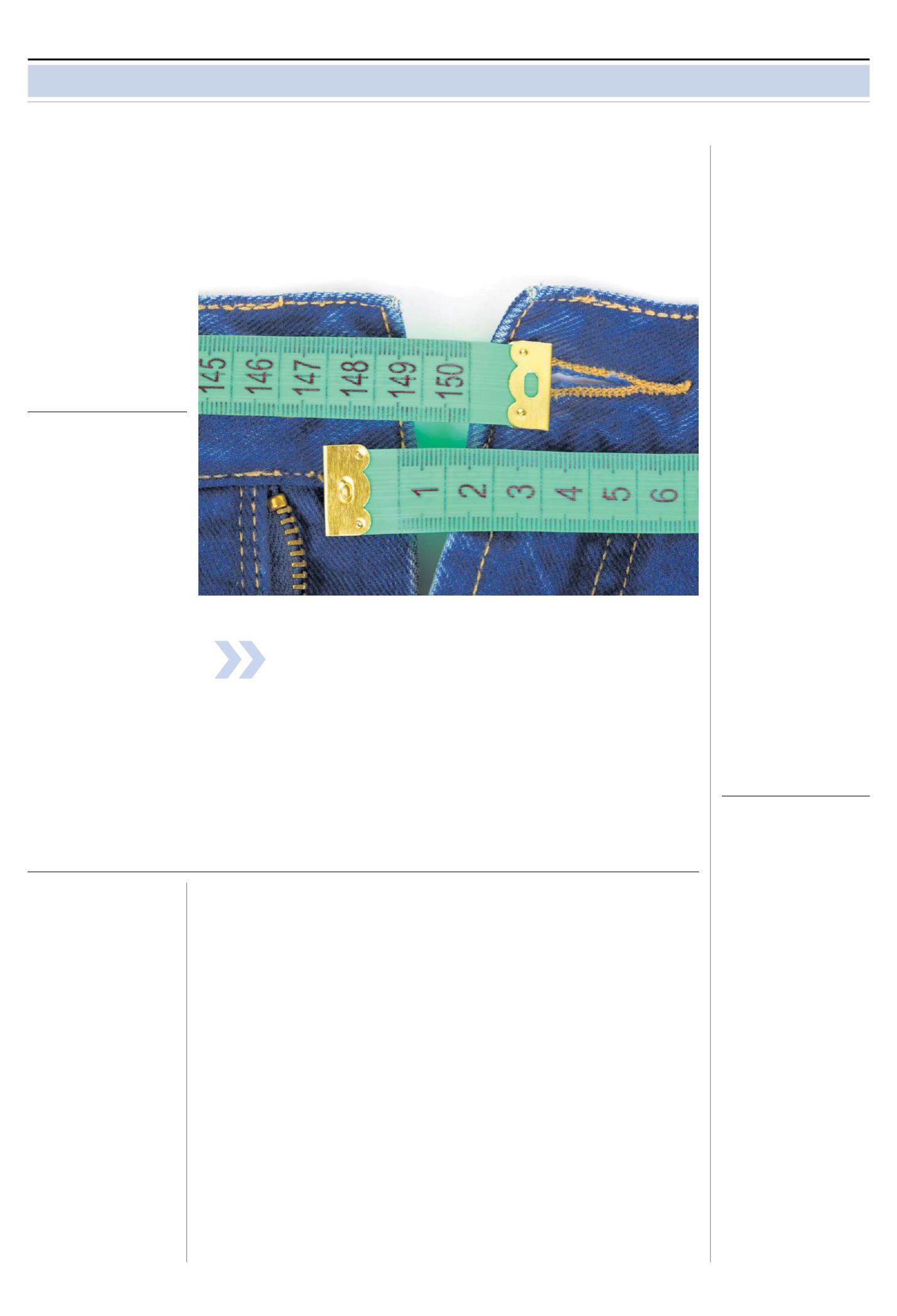
Medizin
BDI aktuell
Juli 2014
13
Anhand von Biomarker-Analysen wer-
den individualisierte Impfstoffe zur
Immuntherapie von Patienten mit Gli-
omen hergestellt. Zu dem einmaligen
internationalen
Forschungsprojekt
GAPVAC (Glioma Actively Personal-
ized Vaccine Consortium), das von der
EU gefördert wird, tragen 14 For-
schungseinrichtungen aus Europa und
den USA mit ihrem Know-how bei.
Koordiniert wird das Mammutprojekt
von dem Tübinger Unternehmen im-
matics biotechnologies. Wie jetzt wäh-
rend der CIMT-Tagung (The Associa-
tion for Cancer Immunotherapy) in
Mainz berichtet wurde, soll die Studie
nach zwei erfolgreichen präklinischen
Testläufen mit Krebszellen von Gli-
ompatienten bereits in wenigen Wo-
chen mit anfangs 30 Patienten begin-
nen, zunächst an acht klinischen Zent-
ren in Europa und später auch an ei-
ner US-Klinik.
Grundlage der immuntherapeuti-
schen Strategie sind Ergebnisse des
Verbundprojekts IVAC (Individualized
Vaccines for Cancer). Dazu hat die
Translationale Onkologie an der Uni-
versität Mainz (TRON) unter der Lei-
tung von Professor Ugur Sahin einen
Prozess etabliert, mit dessen Hilfe es
innerhalb kürzester Zeit möglich ist, in
Tumorgewebe eines Patienten krebs-
spezifische Mutationen zu identifizie-
ren und zu validieren. Die IVAC-Er-
kenntnisse werden nach Angaben von
Sahin auch in der MERIT-Studie ge-
nutzt, in der an der Universität Mainz
RNA-basierte Impfstoffe gegen das
Hodenkrebsantigen NY-ESO-1 und
das Enzym Tyrosinase für Patienten
mit fortgeschrittenem malignem Mela-
nom geprüft werden.
Zwei Impfserien
Wie es auf der Tagung hieß, erhält je-
der Patient im Gliomprojekt nach dem
APVAC-Konzept (actively personal-
ized vaccination) nach Operation und
Chemotherapie zwei anhand von Bio-
markern auf seinen Tumor und sein
Immunsystem zugeschnittene Impf-
stoffe, wobei jeweils das Immunpepti-
dom – die Gesamtheit aller von HLA-
Antigenen dem Immunsystem präsen-
tierten Peptide – sowie krebsspezifi-
sche Mutationen und das Immunprofil
berücksichtigt werden.
Der Impfstoff APVAC1 enthält bis
zu sieben patientenspezifische, an
HLA bindende tumorspezifische Pep-
tide, die gewissermaßen einem Waren-
lager mit bereits vorgefertigten Pepti-
den entstammen. In diesem Lager gibt
es seit Ende vergangenen Jahres unter
anderem bereits fast 40 verschiedene
derartige Peptide. Es handelt sich um
Moleküle, die an HLA-A*02 (HLA-
Klasse I) binden. Zytotoxische T-Zel-
len können Tumorantigene erkennen,
die von den Molekülen genau dieser
HLA-Klasse auf antigenpräsentieren-
den Zellen dem Immunsystem darge-
boten werden.
Der zweite Impfstoff APVAC2, der
mehrere Wochen nach Beginn der ers-
ten Impfserie gespritzt wird, enthält
Tumorpeptide, die anhand der Mole-
küle im individuellen Tumor des je-
weiligen Patienten neu synthetisiert
werden. Entdeckt wurden die mutier-
ten Moleküle mit der „Next Generati-
on Sequencing“.
(ple)
Internationales Projekt: Ein
Konsortium liefert „aktiv
personalisierte Impfstoffe“
gegen Hirntumoren.
Gliome: Impfstoffe auf Abruf
Die tiefe repetitive transkranielle
Magnetstimulation des Motorkor-
tex (rTMS) hat das Potenzial, Fati-
gue und Depression bei Patienten
mit Multipler Sklerose (MS) zu lin-
dern, auch über die Dauer der Sti-
mulationen hinaus. Das legen zu-
mindest Daten einer kleinen Pilot-
studie nahe, die auf der diesjährigen
AAN-Jahrestagung vorgestellt wur-
den. Die Wirksamkeit der rTMS
bei schweren Depressionen ist gut
belegt; mit den bisher verwendeten
Spulen erreicht man jedoch nur ei-
ne Stimulationstiefe von etwa 1 cm.
Da in der Pathophysiologie von Fa-
tigue und Depressionen möglicher-
weise tiefere Hirnregionen beteiligt
sind, haben Forscher um Sven
Schippling vom Universitätsspital
Zürich rTMS mit der neu entwi-
ckelten, tiefer reichenden H-Spule
in einer randomisierten, kontrollier-
ten Phase- I/IIa-Studie bei MS-Pa-
tienten geprüft. Es zeigte sich eine
numerische, nicht-signifikante Ab-
nahme der FSS, die in der sechswö-
chigen Follow-up-Phase anhielt
und dort auch Signifikanz erreichte
(-26,72% ± 16,3%, p= 0,001).
Zwei Wochen nach der ersten Sti-
mulation waren auch die BDI-Wer-
te signifikant gesunken.
(frg)
Stimulationen
gegen Fatigue
und Depression
MULTIPLE SKLEROSE
Die Hinweise mehren sich, dass Fett-
leibigkeit bei Männern mit einer er-
höhten Wahrscheinlichkeit für die
Entwicklung eines aggressiven Prosta-
takarzinoms assoziiert ist. Aus Tierver-
suchen ist bekannt, dass niedrige Tes-
tosteronspiegel bei adipösen Mäusen
unter anderem Zellproliferation und
-migration begünstigen. Niedrige Hor-
monspiegel in Assoziation mit einem
fortgeschrittenen Tumorstadium bei
Männern, bei denen eine radikale
Prostatektomie geplant war, sind in
mehreren Studien beobachtet worden.
In einer prospektiven Studie überprüf-
ten Urologen um Dr. Florian Jentzmik
von der Universitätsklinik in Ulm, ob
bei Männern mit einem lokalisierten
Prostatakarzinom niedrige Hormon-
spiegel vor einer radikalen Prostatekto-
mie direkt oder indirekt mit dem Tu-
morstadium und -grad in einem Zu-
sammenhang stehen.
Risiko für Lymphknotenmetastasen
Für die prospektive Studie standen die
präoperativen Befunde von 510 Män-
nern im Alter zwischen 42 und 84 Jah-
ren zur Verfügung. Sie waren an einem
histologisch nachgewiesenen Adeno-
karzinom der Prostata erkrankt, wes-
wegen eine radikale Prostatektomie
vorgesehen war. 93 Männer (18,2%)
hatten einen BMI von mindestens 30
und galten als adipös. Bei 123 Män-
nern (24,1%) lag der Taillenumfang
über 110 cm.
Zwar konnten die Ärzte eine inverse
Korrelation zwischen Körpergewicht
und Testosteronspiegel feststellen.
Doch nur das Körpergewicht war sig-
nifikant mit einem fortgeschrittenen
Stadium der Krebserkrankung assozi-
iert. Dies galt für einen BMI über 30
und einen Taillenumfang über 110
cm, die beide mit einem GleasonScore
von mindestens acht assoziiert waren.
Bei Adipösen lag der Gleason-Score
signifikant häufiger in dieser Höhe als
bei Männern mit einem BMI unter 30
(17,4% vs. 8,3%; p = 0,01). Entspre-
chend hatten signifikant mehr Männer
mit einem Taillenumfang von mindes-
tens 110 cm einen Score über acht als
schlanke (18,9% vs. 7,1%; p 0,001).
Diese Zusammenhänge bestanden
auch dann noch, wenn die Männer
normale Testosteronwerte hatten. Da-
rüber hinaus korrelierte ein hoher
Taillenumfang signifikant mit der Ent-
stehung von Lymphknotenmetastasen.
Bei 470 Teilnehmern der Studie war
eine Lymphadenektomie in der Be-
ckenregion vorgenommen worden. Bei
17,8 Prozent der Männer mit einem
Umfang über 110 cm wurden Metas-
tasen entdeckt, dagegen nur bei 7,4
Prozent der Teilnehmer in der Ver-
gleichsgruppe.
Einschränkend weisen die Ulmer
Urologen darauf hin, dass unklar ist,
ob sich das Studienergebnis verallge-
meinern lässt, da alle Männer für eine
Prostatektomie geeignet waren und
keine Komorbiditäten hatten. Zudem
seien bei den Analysen keine statisti-
schen Korrekturen anhand von Risiko-
faktoren wie Hyperinsulinämie, HDL,
LDL und freie Fettsäuren vorgenom-
men worden.
Übergewicht, nicht niedrige
Testosteronspiegel, ist mit
fortgeschrittenen Stadien
von Prostata-Ca assoziiert.
Die niedrigen Hormonspie-
gel könnten nur ein Epiphä-
nomen der Adipositas sein.
Bei adipösen Männern verläuft
Prostatakarzinom oft aggressiver
Von Peter Leiner
Ein BMI über 30 und ein Taillenumfang über 110 cm sind bei Prostata-Ca offenbar ungünstig.
© GETTY IMAGES/ZOONAR RF
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nur das Körperge-
wicht – nicht aber der
niedrige Testosteron-
spiegel – war signifi-
kant mit einem
fortgeschrittenen
Stadium von Prostata-
karzinom assoziiert.
Dr. Florian Beyer
Universitätsklinik Ulm
Wer in der Kindheit eine Krebser-
krankung überlebt hat, sollte als Er-
wachsener besonders auf kardiovas-
kuläre Risikofaktoren achten, raten
Epidemiologen um Dr. Morten Ol-
sen von der Universität in Aarhus.
Sie hatten dänische Registerdaten
von knapp 2250 Personen ausge-
wertet, die zwischen 1943 und
1990 als Minderjährige an einem
Tumor erkrankt waren und an-
schließend mindestens fünf Jahre
überlebt haben. Jedem stellten die
Forscher zehn gleich alte Personen
ohne Tumorleiden in der Kindheit
und Jugend gegenüber und vergli-
chen die Häufigkeit von kardiovas-
kulären Diagnosen im Erwachse-
nenalter. Bei insgesamt sieben Pro-
zent der ehemaligen Krebskranken
ließ sich später eine kardiovaskuläre
Krankheit feststellen (Am J Epidem
2014; online 28. Mai).
Wie sich herausstellte, war die
Rate für kardiale Ereignisse bei Er-
wachsenen mit einem Tumor in
Kindheit und Jugend zweieinhalb-
fach höher als in der Kontrollgrup-
pe. Am stärksten gesteigert war die
Rate von Subarachnoidalblutungen
(6,1-fach), Venenthrombosen (5,3-
fach), ischämischen Herzerkran-
kungen (4,7-fach) und von Herzin-
suffizienz (3,8-fach). Bei den übri-
gen kardiovaskulären Erkrankungen
war die Rate eher gering (Schlagan-
fall, Perikarditis) oder gar nicht er-
höht (Herzklappenprobleme, Vor-
hofflimmern).
(mut)
Krebs als Kind –
häufiger Infarkt
als Erwachsener
Krebs in jungen Jahren
bedeutet ein fünffaches
Risiko für eine ischämi-
sche Herzerkrankung und
ein sechsfaches für eine
Subarachnoidalblutung.
REGISTERANALYSE
Ob eine Knie- oder Hüftgelenksar-
throse einen schweren Verlauf
nimmt oder nicht, lässt sich bisher
nur schwer vorhersagen. Wie Dr.
Christian Beyer vom Universitäts-
klinikum Erlangen-Nürnberg beim
EULAR berichtet hat, könnten sich
microRNAs dafür eignen. In einer
Studie hatte er mit Kollegen das
Serum von 816 Personen mit Os-
teoarthrose auf die Anwesenheit
von insgesamt 374 microRNAs un-
tersucht. Im Lauf von 15 Jahren
wurde bei 67 Patienten ein Gelenk-
ersatz notwendig. Dies entspricht
einer Interventionsrate von 6,9 pro
1000 Patientenjahre. Übergewichti-
ge Patienten und Ältere benötigten
häufiger eine Arthrosplastie. Von
den untersuchten microRNAs er-
wiesen sich drei als mit einem
schweren Verlauf der Osteoarthrose
assoziiert (miR-885-5p, miR-454
und let-7e). Von diesen eignet sich
let-7e als Prädiktor, wie Beyer in
Paris berichtete.
(kat)
Sagen micro-
RNAs Arthrose-
Verlauf voraus?
BIOMARKER