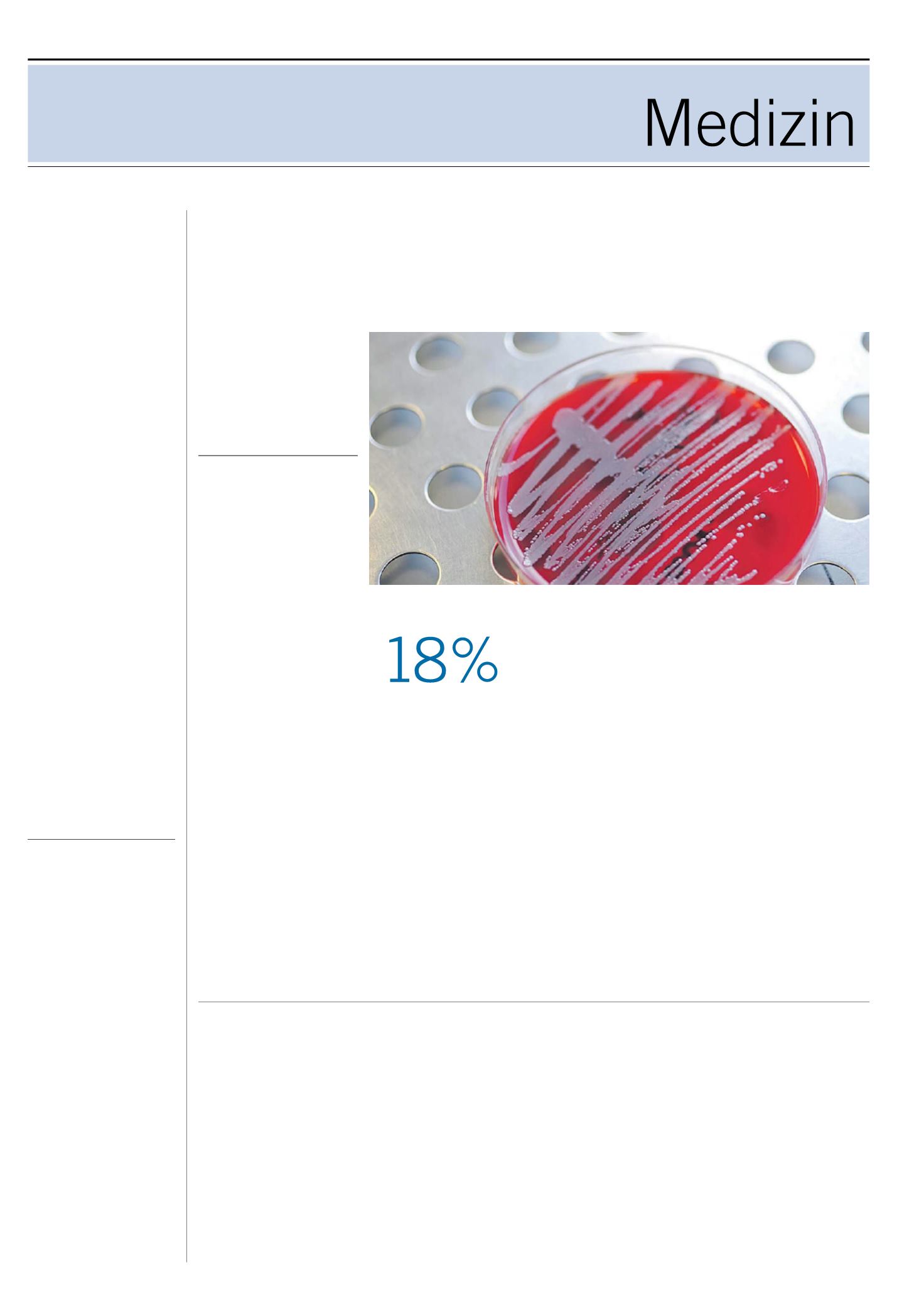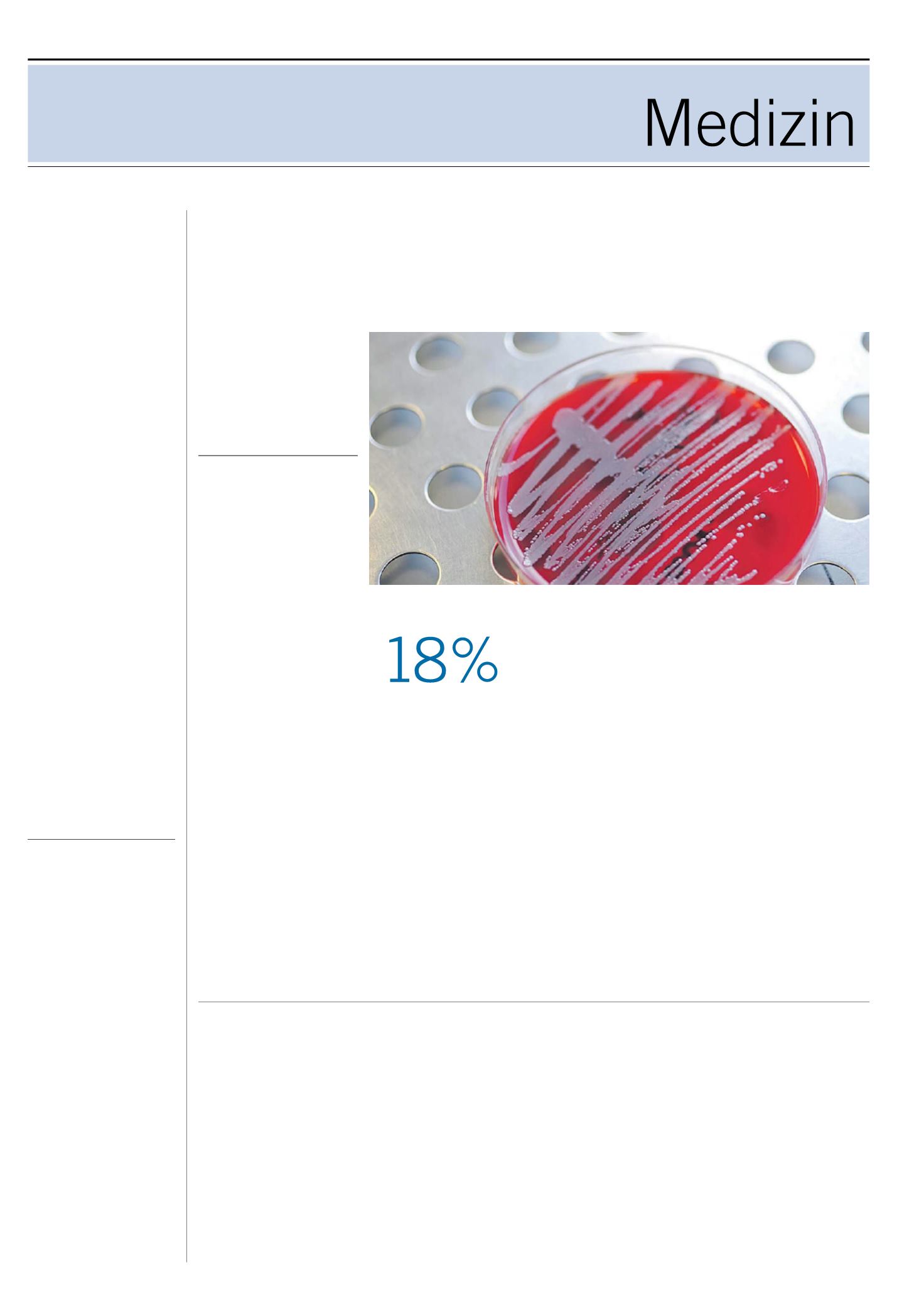
10
BDI aktuell
Juli 2014
Auf Deutschlands Altenpflegeheime
kommen offenbar neue multiresistente
Probleme zu. Bereiteten bislang vor
allem MRSA (Methicillin-resistenter
Staphylococcus aureus)-Resistenz Ex-
perten Sorgen, sind es jetzt zuneh-
mend gramnegative Stäbchen – allen
voran Keime, die Betalaktamasen mit
einem erweiterten Wirkspektrum bil-
den, kurz ESBL.
Darauf deutet eine neue Studie des
MRE-Netzes Rhein-Main unter Fe-
derführung des Stadtgesundheitsamtes
in Frankfurt am Main hin, deren Da-
ten auf der 64. Jahrestagung der Ärzte
im öffentlichen Gesundheitsdienst
(BVÖGD) in Magdeburg vorgestellt
wurden (Gesundheitswesen 2014; 76:
V67). Demnach breiten sich ESBL-
Keime zunehmend in Heimen aus. Im
Rahmen des 2010 initiierten europa-
weiten HALT-Projektes haben die
neun teilnehmenden Kreise im
Rhein-Main-Gebiet im Frühjahr 2013
29 Altenpflegeheime und insgesamt
2404 Bewohner unter die Lupe ge-
nommen. Bei 690 weiteren Teilneh-
mern konnten die Forscher zudem ei-
ne Anamnese zu multiresistenten Er-
regern (MRE) erheben und einen la-
bordiagnostischen MRE-Befund auf
Basis diverser Abstriche erstellen.
Hoher Anteil an Fluorchinolonen
Hauptaugenmerk waren MRSA,
ESBL-Bildner und Vancomycin-resis-
tente Enterokokken (VRE). Eine ähn-
liche Untersuchung hatte das MRE-
Netz bereits im September 2012
durchgeführt. In der damaligen Pilot-
studie beteiligten sich 184 Bewohner
aus acht Frankfurter Pflegeheimen an
der MRE-Untersuchung (Bundesge-
sundheitsbl 2014;57(4):414-422).
Infektionen fanden die Forscher in
der jüngsten Studie bei 2,6 Prozent
der Patienten, was vergleichbar ist mit
Ergebnissen von internationalen Stu-
dien. In der 2012er-Erhebung lag der
Anteil in der MRE-Gruppe mit 4,9
Prozent noch deutlich höher. Das
könnte unter anderem durch den Ab-
fragezeitraum September begünstigt
worden sein, denn damals gab es deut-
lich mehr Atemwegsinfektionen.
Der Antibiotika-Einsatz hält sich
mit 0,9 Prozent in der jetzigen MRE-
Gruppe in Grenzen. Für besorgniser-
regend halten die Experten allerdings
die Art der Antibiosen. So war der An-
teil an Fluorchinolonen in den Frank-
furter Studien durchweg erhöht. In
der 2012er Erhebung machten sie im-
merhin 23 Prozent aller eingesetzten
Antibiotika aus.
Wachsende Gefahr von 4MRGN
Bei der MRSA-Prävalenz in den Hei-
men scheint ein Plateau erreicht zu
sein (6,5 vs.9,2 Prozent).
Der ESBL-Anteil, war in den bei-
den Untersuchungen des MRE-Netzes
laut Heudorf „extrem hoch“. Zu den
ESBL-Bildnern gehören vor allem
gramnegative Stäbchen wie E. coli
oder Klebsiella sp., aber auch Ente-
robacter, Pseudomonas und Acineto-
bacter. In der jüngsten Studie waren
17,8 Prozent aller Altenheimbewohner
damit besiedelt, 2012 sogar 26,7 Pro-
zent – im Mittel also jeder Vierte. In
der 2013er-Erhebung war die ESBL-
Besiedelung für 0,7 Prozent der Pati-
enten bekannt – ein extrem krasses
Missverhältnis zu dem im Labor er-
mittelten Anteil von 17,8 Prozent. Als
signifikanten Risikofaktor fanden die
Hessen in beiden Untersuchungen
Harnwegskatheter. In der Analyse von
2012 war zudem eine positive
MRSA-Anamnese signifikant mit einer
ESBL-Besiedelung assoziiert. Heudorf
bezeichnete die zunehmende ESBL-
Prävalenz als „ambulantes Problem“.
Wir haben die höchsten ESBL-Raten
in den Altenheimen“, sagte sie. In der
Reha, also nach klinischen Aufenthal-
ten, liege die ESBL-Prävalenz „deut-
lich unter zehn Prozent. In Dialyseein-
richtungen betrage sie „um die acht
Prozent“.
Die Amtsärzte warnten auf ihrem
Kongress außerdem vor der mögli-
cherweise aufkommenden Gefahr vier-
fach-resistenter gramnegativer Stäb-
chen, kurz 4MRGN. Dieses sind so-
wohl gegen Penicilline, neuere Cepha-
losporine als auch gegen Carbapene-
me und Fluorchinolone resistent. In
den aktuellen Heimuntersuchungen
im Rhein-Main-Gebiet fanden die
Forscher noch keine 4MRGN, es sei
aber nur eine Frage der Zeit, bis die
Erreger sich breit machten.
Die Gesundheitsämter sind
alarmiert: In Deutschlands
Altenheimen machen sich
offenbar ESBL-Keime breit.
Experten erwarten noch
schlimmere Probleme.
ESBL und 4MRGN – die
„neuen“ Gefahren im Heim?
Von Dennis Nösler
Staphylococcus aureus in der Petrischale.
© KLAUS ROSE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
der Bewohner von Altenheimen
sind mit ESBL-Keimen besiedelt, so
der im Labor ermittelte Anteil. Die
zunehmende Prävalenz wird als ein
„ambulantes Problem“ angesehen.
In einer prospektiven Kohortenstudie
über 24 Jahre zeigte sich bei Frauen,
die Kalzium supplementierten, kein
höheres kardiovaskuläres Risiko als bei
Frauen ohne diese Nahrungsergän-
zung. Die Herzinfarktrate war in der
Gruppe der Supplementiererinnen so-
gar niedriger als in der Vergleichsgrup-
pe ohne zusätzliche Kalziumzufuhr.
Die Kuopio Osteoporosis Risk Faktor
and Prevention Study, die schwedische
Mammografie-Kohorte sowie die Stu-
die EPIC-Heidelberg hatten Vermu-
tungen aufkommen lassen, dass die
Kalziumsupplementation die Gefäß-
verkalkung beschleunigen könnte und
damit möglicherweise das Risiko für
kardiovaskuläre Erkrankungen (CVD)
erhöht.
Auch bei höherer Dosis
Diesen Verdacht konnten Julie Paik
vom Brigham and Women’s Hospital
in Boston und Kollegen mit den Da-
ten von 74 245 Frauen der Nurses‘
Health Study (NHS) aus den Jahren
1984 bis 2008 ausräumen. Mittels
Fragebogen waren die Probandinnen
mehrfach zu ihren Substitutions- und
sonstigen Lebensgewohnheiten im vo-
rausgehenden Jahr befragt worden.
Studienendpunkte waren ein tödlicher
oder nicht-tödlicher Herzinfarkt bzw.
ein Schlaganfall. Innerhalb von 24 Jah-
ren erlitten 2709 zu Studienbeginn ge-
sunde Probandinnen einen Infarkt
(2151 nicht-tödlich, 558 tödlich) und
1856 einen Schlaganfall (1449 ischä-
misch und 407 hämorrhagisch).
Zwar lebten die Frauen, die Kalzi-
um supplementierten, insgesamt ge-
sünder, doch auch nach Berücksichti-
gung von Alter, BMI, diätetischem
Kalzium und Vitamin-D-Zufuhr sowie
von weiteren CVD-Risikofaktoren lag
das relative Risiko für eine kardiovas-
kuläre Erkrankung bei den Frauen, die
mehr als 1000 mg Kalzium pro Tag
einnahmen, sogar 18 Prozent unter
dem von Frauen ohne Supplementati-
on. Selbst wenn Kalzium über viele
Jahre supplementiert wurde, hatte dies
keinen negativen Einfluss auf das
CVD-Risiko.
Subgruppen: kein negativer Effekt
In Subgruppenanalysen war die Kalzi-
umeinnahme auch bei Nichtraucherin-
nen, Frauen, die regelmäßig Sport
trieben, oder Probandinnen, die nicht
an Hypertonie oder Cholesterinämie
litten, mit einem geringeren kardiovas-
kulären Risiko assoziiert (Osteoporos
Int, online 7. Mai 2014).
(st)
Selbst eine langjährige
Kalziumsupplementation
hat bei Frauen offenbar
keinerlei negativen
kardiovaskulären Einfluss.
Kalziumzusatz – kein höheres KHK-Risiko
Nach den publizierten Daten hat
die Mortalität nach kardiovaskulä-
ren und onkologischen Operationen
zwischen 1996 und 2006 abgenom-
men. Ob Gleiches für die Urologie
gilt, hat ein Team um den Versor-
gungsforscher Jesse Sammon (Hen-
ry Ford Health System, Detroit)
untersucht. Die Wissenschaftler
griffen auf die Daten von mehr als
7,7 Millionen stationär vorgenom-
menen urologischen Eingriffen aus
den Jahren 1998 bis 2010 zurück.
Knapp 55 000 Patienten (0,71%)
starben vor der Entlassung aus dem
Krankenhaus.
Von besonderem Interesse war
dabei die Rate an Todesfällen nach
potenziell erkennbaren bzw. ver-
meidbaren Komplikationen – bei-
spielsweise Sepsis, Pneumonie,
Thrombose,
Lungenembolie,
Schock, Herzstillstand oder Blutun-
gen im oberen Magen-Darm-Trakt.
Festzustellen war ein jährlicher
Rückgang stationärer urologischer
Eingriffe von 0,63 Prozent. Die Ge-
samtsterblichkeit ging pro anno um
ein Prozent zurück – doch der An-
teil an Rettungsversagen nahm Jahr
für Jahr um fünf Prozent zu: Hatte
dieser Anteil 1998 noch bei 41,1
Prozent gelegen, betrug er 2010 be-
reits 59,5 Prozent. Den Grund se-
hen Sammon und seine Mitarbeiter
in der steigenden Zahl ambulant
vorgenommener Operationen. (
rb)
Urologische OPs
in der Klinik
doch sicherer?
Laut einer US-Studie
nehmen Todesfälle durch
vermeidbare Komplikatio-
nen nach urologischen
Eingriffen zu. Folge von
mehr ambulanten OPs?
US-STUDIE
Bei Patienten mit Reizdarmsyn-
drom (IBS) lohnt sich ein Versuch,
Mono-, Di- und Oligosaccharide
sowie Polyole weitgehend zu ver-
meiden. In einer Studie gelang da-
mit eine gute Symptomkontrolle
(Gastroenterology
2014;146:67-
75). Sog. FODMAPs bestehen im
Wesentlichen aus Fructose, Lakto-
se, Polyolen, Fructanen und Galak-
to-Oligosacchariden. Unter FOD-
MAPs-armer Diät wiesen die IBS-
Patienten einen signifikant niedrige-
ren Symptomen-Score auf als unter
normaler australischer Diät (VAS
22,8 mm; CI: 16,7-28,8 mm vs.
44,9 mm; CI: 36,6-53,1 mm; p
0,001). Völlegefühl, Schmerzen
und Flatulenz gingen deutlich zu-
rück. Patienten aller IBS-Subtypen
waren mit der Stuhlkonsistenz un-
ter der FODMAPs-armen Diät zu-
friedener, allerdings änderten sich
nur bei vorwiegender Diarrhö die
Stuhlfrequenz und die King´s Stool
Chart Scores. Die Einhaltung der
Diät erfordert Schulungen und
dürfte selbstständig über längere
Zeit kaum durchzuhalten sein.
(eb)
Oligosaccharide
langfristig
vermeiden
REIZDARMSYNDROM