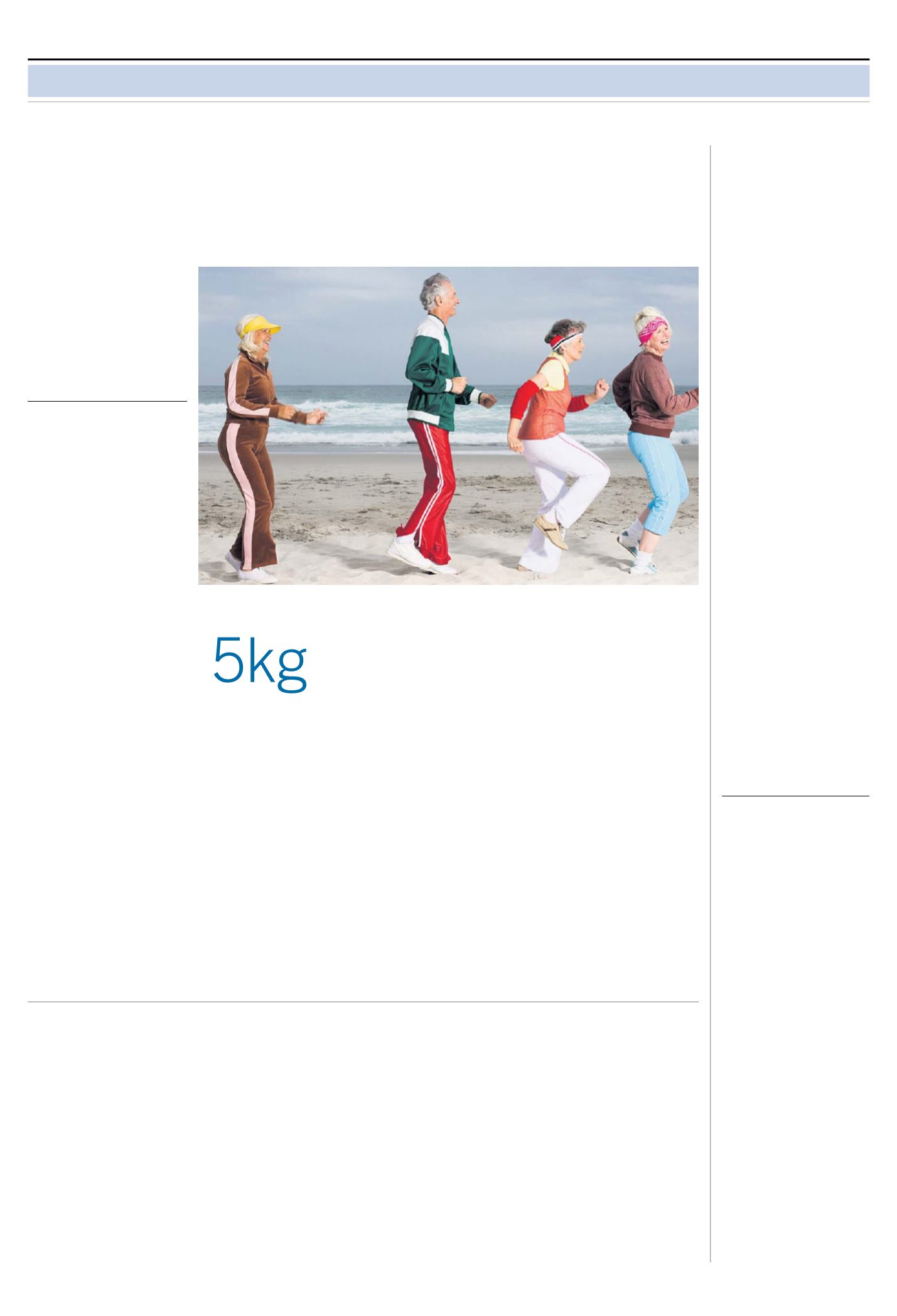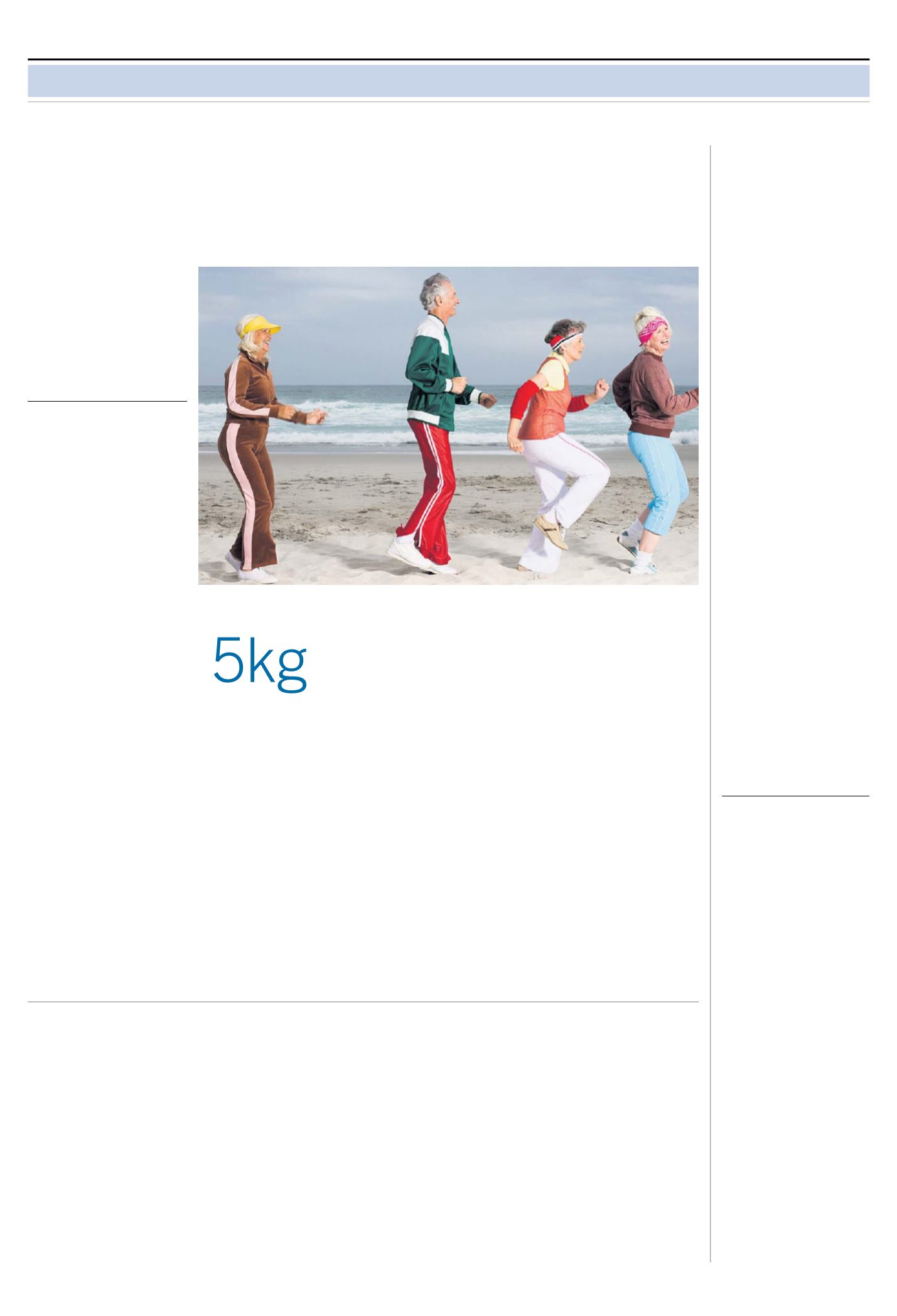
Medizin
BDI aktuell
Juli 2014
11
Dem Brustkrebs davonrennen – das
scheint tatsächlich möglich. Viele wis-
sen immer noch nicht, wie stark sich
der Lebensstil auf die Inzidenz und die
Prognose des Mammakarzinoms aus-
wirkt, sagte Professor Marion Kiechle,
Direktorin der Frauenklinik am Klini-
kum rechts der Isar in München auf
dem FOKO 2014 in Düsseldorf.
Im Fokus stehen Ernährung und
Sport. Ein Plus an körperlicher Aktivi-
tät, ein Minus an Gewicht auf der Ba-
sis einer gesunden Ernährung können
nachweislich die Brustkrebsinzidenz
senken und die Brustkrebsprognose
erheblich verbessern. Und die Effekte
sind in zahlreichen Studien gut belegt,
wie Kiechle zeigen konnte.
Drei Stunden Sport pro Woche
Jeden Tag spazieren zu gehen, ist aller-
dings nicht ausreichend. Für körperli-
che Aktivität und Brustkrebsinzidenz
konnte eine dosisabhängige Korrelati-
on gezeigt werden, mit einer Schwel-
lendosis von drei bis fünf Stunden
Sport pro Woche. Dann aber reduzier-
te sich das Risiko, an Brustkrebs zu er-
kranken, um 37 Prozent, bei schwerer
körperlicher Arbeit sogar um 52 Pro-
zent. Auch eine prospektive Studie mit
knapp 33 000 postmenopausalen
Frauen zeigte eine dosisabhängige
Korrelation mit einer signifikanten
Abnahme der Brustkrebsinzidenz bei
9-15 MET* h/Woche um 19 Prozent.
In einer Metaanalyse, die Studien zum
Einfluss körperlicher Aktivität bei
post- und prämenopausalen Frauen
berücksichtigte, konnte für beide
Gruppen eine Risikoreduktion um et-
wa ein Drittel erreicht werden.
Ganz erheblich ist auch der Einfluss
des Gewichts auf das postmenopausa-
le Brustkrebsrisiko. Je mehr die Frau-
en nach der Menopause zunehmen,
umso mehr steigt die Wahrscheinlich-
keit, dass sie an Brustkrebs erkranken.
In einer von der WHI durchgeführten
Ernährungsinterventionsstudie
zur
Brustkrebsinzidenz ließ sich durch ei-
ne Ernährung mit wenig Fett, viel
Vollkornprodukten und jeder Menge
frischem Obst und Gemüse innerhalb
von fünf Jahren die Zahl der Brust-
krebsfälle um 47 Prozent reduzieren.
„Und das, obwohl die Compliance
relativ schlecht war“, betonte Kiechle.
Dass es vor allem die tägliche Fettauf-
nahme ist, die das Risiko in die Höhe
treibt, zeigt der Blick auf das Brust-
krebsrisiko in Ländern mit unter-
schiedlicher Fettaufnahme. Danach ist
das Risiko in Asien mit einer täglichen
Fettaufnahme von 20 bis 40 g deutlich
niedriger als in Großbritannien oder
den USA mit einer täglichen Fettzu-
fuhr von 140 g und mehr.
Nach Diagnose oft Zunahme
Auch die Brustkrebsmortalität erhöht
sich mit dem BMI: bei einem BMI
über 30 kg/m
2
um das 1,63fache ge-
genüber normalgewichtigen Frauen
mit einem BMI zwischen 18,5 und
24,9 kg/m
2
, bei einem BMI über 40
kg/m
2
um das Doppelte. Das belegt ei-
ne Studie mit 500 000 Frauen, die
über 16 Jahre beobachtet wurden.
Körperliche Betätigung und ein nor-
maler BMI können demnach nicht nur
die Brustkrebswahrscheinlichkeit re-
duzieren. Sie verbessern bei bereits er-
krankten Frauen auch die Prognose.
Laut Kiechle nehmen gerade Frauen
nach der Diagnose Mammakarzinom
häufig zu, im Mittel um ein bis drei
Kilo im ersten Jahr. Insbesondere
übergewichtige Frauen schränken ihre
körperliche Aktivität oft ein, und nur
50 Prozent haben nach drei Jahren
wieder den Aktivitätslevel wie vor der
Erkrankung. Aber: Eine Gewichtszu-
nahme von mehr als 5 kg führt zu ei-
ner Verschlechterung des Gesamt-
überlebens von 20 Prozent.
Auch unter Chemotherapie ist das
Gewicht prognostisch relevant, zeigen
die Daten der ADEBAR-Studie: Das
Gesamtüberleben lag nach fünf Jahren
bei normalgewichtigen Frauen bei 87
Prozent, bei übergewichtigen mit ei-
nem BMI zwischen 25 und 30 kg/m
2
bei 83 Prozent und bei adipösen Frau-
en bei 73 Prozent. „Dies ist die erste
Studie, die den Einfluss des Körperge-
wichts auf das Überleben bei Frauen
mit lokal fortgeschrittenem Mamma-
karzinom zeigt, die eine Chemothera-
pie erhalten“, resümierte Kiechle. Der
Effekt war unabhängig von der Art der
Chemotherapie.
Und Frauen mit Brustkrebs aus der
Nurses‘ Health Study, die für zwei
Jahre ein moderates Sportprogramm
(9-15 MET* h/Woche) absolvierten,
hatten eine 50-prozentige Reduktion
der Rezidivrate und der Mortalitätsra-
te, und zwar unabhängig vom BMI.
Das Brustkrebsrisiko steigt
mit dem Alter an. Umso
wichtiger wird es, etwas
gegen die wichtigen Risiko-
faktoren Übergewicht und
Bewegungsmangel zu tun.
Gesunder Lebensstil verbessert
Prognose beim Mamma-Ca
Von Beate Fessler
Mit sportlichen Aktivitäten können Senioren Risikofaktoren für Krebs entgegenwirken.
© ZOE / IMAGESOURCE.COM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
und mehr Gewichtszunahme führt
bei Frauen nach der Diagnose
Mammakarzinom
durchschnittlich
zu einer Verschlechterung des
Gesamtüberlebens von 20 Prozent.
Akutes Nierenversagen nach herzchi-
rurgischen Eingriffen ist eine häufige
Komplikation. Sie kommt bei über 40
Prozent der Patienten vor, etwa ein bis
fünf Prozent sind danach oft lebens-
lang von der Dialyse abhängig. „Mit
herkömmlichen Verfahren ist es
schwer, eine Funktionsstörung der
Niere rasch nachzuweisen“, wird Pro-
fessor Alexander Zarbock in einer Mit-
teilung der Universität Münster zitiert.
„Die bisher analysierten Werte steigen
erst mit einer Verzögerung von bis zu
zwei Tagen nach der Nierenschädi-
gung an.“ Parameter sind ein Anstieg
des Serumkreatinins und/oder nach-
lassende Harnausscheidung.
In einer aktuellen Studie untersuch-
te der Intensivmediziner gemeinsam
mit Kollegen vom Universitätsklini-
kum für Anästhesiologie, operative In-
tensivmedizin und Schmerztherapie in
Münster 50 Patienten mit einem ho-
hen Risiko für ein akutes Nierenversa-
gen, die sich einer kardiopulmonalen
Bypass-Operation unter Einsatz einer
Herz-Lungen-Maschine unterziehen
mussten (PLOS ONE 2014, online
27. März). Die Forscher verglichen
herkömmliche Nierenfunktionstests
mit einem neuartigen, in den USA
entwickelten
Urintest
(Nephro-
check/Astute Medical). Dieser Test
nutzt eine einfache Technologie zum
Nachweis der Proteine TIMP-2 und
IGFBP-7 im Urin der Patienten. Die
Freisetzung dieser beiden Proteine
durch die Nierenzellen fungiert als ei-
ne Art biologisches Alarmsystem, das
signalisiert, wenn tubuläre Epithelzel-
len unter akutem Stress stehen und die
Gefahr eines akuten Nierenversagens
gegeben ist. Im weiteren Verlauf kann
diese wiederum zu dauerhaften Nie-
renschäden bis hin zu einem perma-
nenten Verlust der Nierenfunktion
führen. Internationale Richtlinien
empfehlen eine frühzeitige Risikobeur-
teilung der Nierenfunktion von Patien-
ten.
Testergebnis vier Stunden nach OP
Das Ergebnis der jetzt veröffentlichten
Studie zeigt, dass eine Schädigung der
Niere bereits vier Stunden nach einer
Herzoperation zuverlässig nachgewie-
sen werden kann, so die Universität.
In weiteren Studien soll untersucht
werden, ob die Verwendung des
Nephrocheck-Tests in Verbindung mit
der Umsetzung nierenschützender
Maßnahmen zu weniger Komplikatio-
nen und damit zu einem schnelleren
Heilungsverlauf führen kann.
(eb)
Anhand zweier Proteine im
Harn kann eine Nierenschä-
digung bei Patienten nach
herzchirurgischen Eingrif-
fen früher erkannt werden.
Schnelltest auf Nierenschaden post Herz-OP
In einer aktuellen Studie konnte be-
stätigt werden, dass Anämie bei
herzinsuffizienten Patienten die
Mortalität deutlich erhöht, d. h. die
1-Jahresmortalität steigt von 65 auf
73 Prozent. „10 bis 20 Prozent aller
Patienten mit Herzinsuffizienz ha-
ben eine Anämie und bei ca. 80
Prozent findet sich ein absoluter
oder funktioneller Eisenmangel“,
sagte Professor Wolfram Döhner
von der kardiologischen Universi-
tätsklinik der Charité in Berlin auf
der DGIM-Jahrestagung. Ursachen
des absoluten Eisenmangels bei die-
sen Patienten seien Mangelernäh-
rung, Malabsorption und chroni-
scher Blutverlust durch die anti-
thrombotischen Medikamente. Der
funktionelle Eisenmangel mit der
gestörten Eisenverfügbarkeit ist
Folge der chronischen Inflammati-
on und der häufig bestehenden
chronischen Niereninsuffizienz.
Im Rahmen der Studie FAIR-
HF konnte eine i.v.-Eisentherapie
bei diesen Patienten den klinischen
Status und somit auch die Lebens-
qualität deutlich verbessern, und
zwar unabhängig vom Hb-Wert;
denn der Eisenmangel hat bei Vor-
liegen einer Herzinsuffizienz einen
doppelt ungünstigen Effekt auf den
Sauerstoff-Stoffwechsel. So kommt
es einmal zu einer funktionellen Be-
einträchtigung aerober Enzyme und
somit zu einer Störung der oxydati-
ven Phosphorylierung, d. h. die
O
2
-Nutzung ist beeinträchtigt. Zum
anderen setzt niedriges Hb den
O
2
-Transport herab. „Und beides
vermindert die körperliche Leis-
tungsfähigkeit“, so Döhner.
(eb)
Eisenmangel bei
Herzinsuffizienz
vermeiden
Anämie erhöht bei herz-
insuffizienten Patienten
offenbar die Mortalität.
ANÄMIE
Ein höherer Ressourceneinsatz im
Gesundheitswesen führt zu mehr
Versorgungsqualität und zu besse-
ren Überlebenschancen bei Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.
Diesen
Zusammenhang hat ein Forscher-
team am Hamburg Center for
Health Economics (HCHE) zumin-
dest für Herzinfarktpatienten nach-
gewiesen. Nach den Ergebnissen
der aktuellen Studie kostet ein zu-
sätzlich gewonnenes Lebensjahr für
Herzinfarktpatienten im Durch-
schnitt 267 000 Euro. Ein um 100
Euro höherer Einsatz würde die
Ein-Jahres-Sterblichkeit
eines
durchschnittlichen Herzinfarktpati-
enten laut HCHE von 8,7 auf 8,66
Prozent senken.
Das HCHE, ein gemeinsames
Institut des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf (UKE) und
der Universität Hamburg hat für
seine Untersuchung Routinedaten
der Techniker Krankenkasse von
über 12 000 Patienten ausgewertet.
Keine Aussage lässt sich bislang
darüber ableiten, ob der erhöhte
Ressourceneinsatz beim Personal
oder in der Technik wirksamer ist.
Der Zusammenhang kann auch in-
dividuell stark abweichen, heißt es
in der Mitteilung.
(di)
Ein Lebensjahr
mehr kostet
267 000 Euro
HERZINFARKT