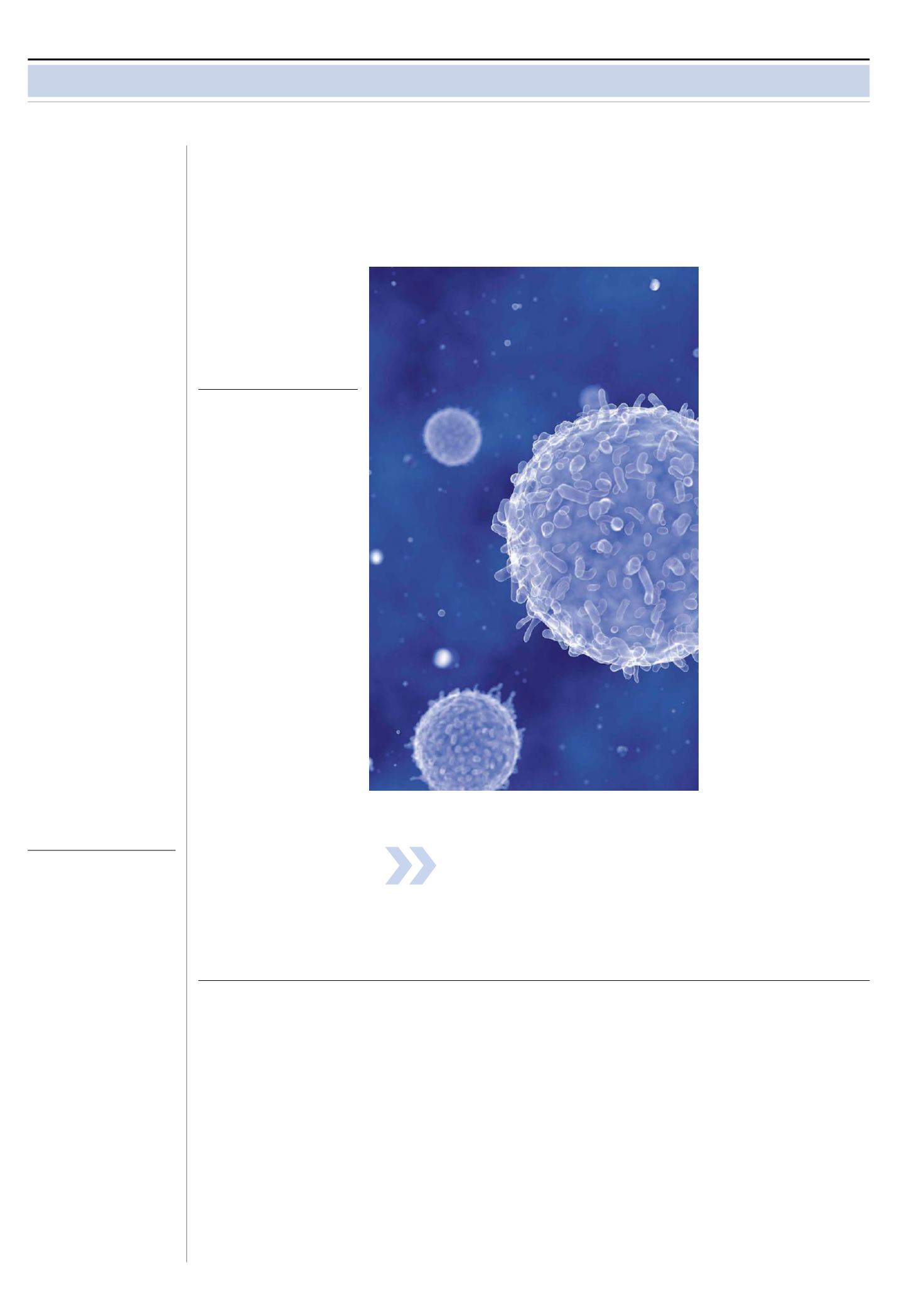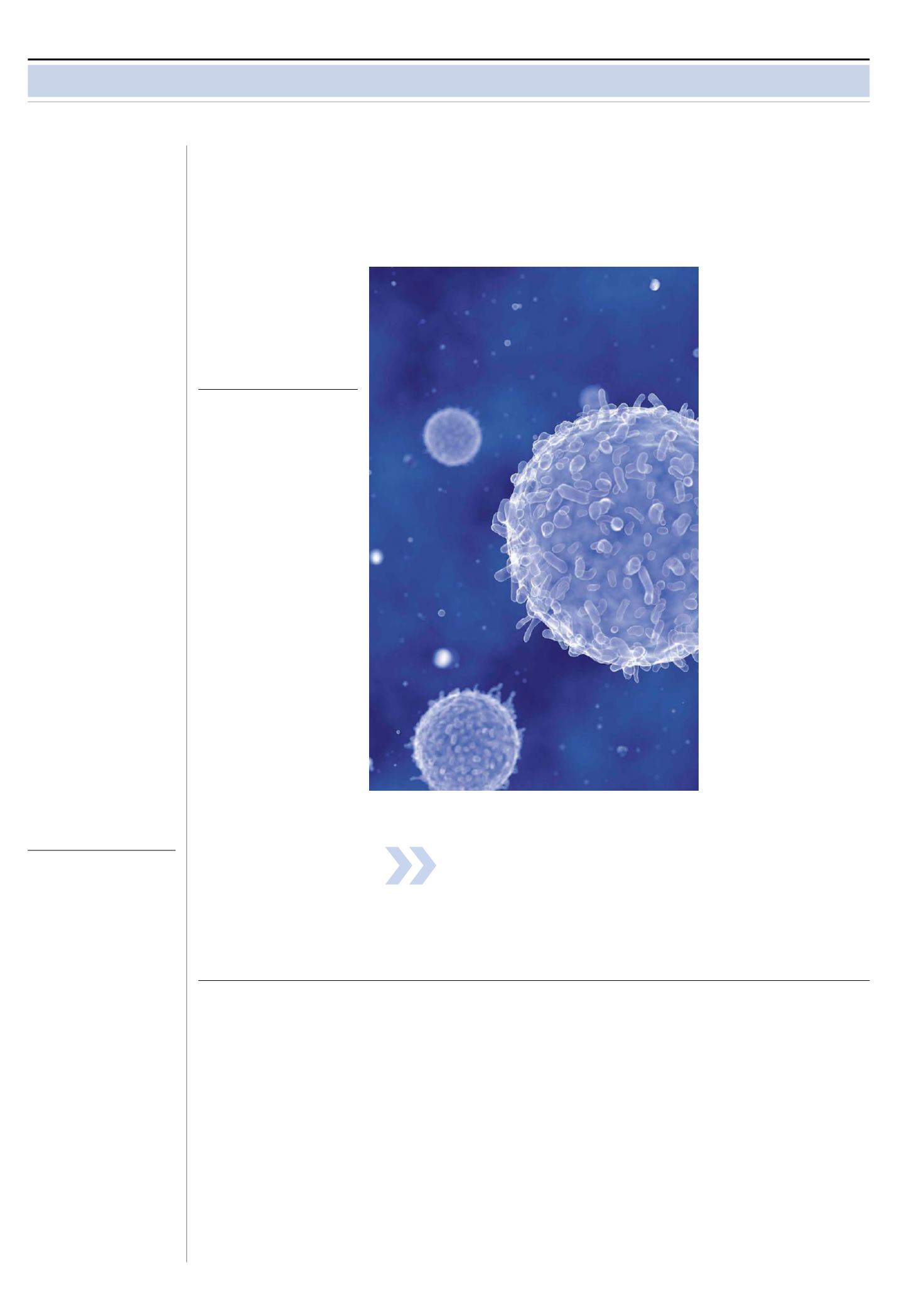
14
Juli 2014
BDI aktuell
Medizin
Die hämophagozytische Lymphohisti-
ozytose (HLH) mit ihrer überschie-
ßenden, aber wirkungslosen Immun-
antwort kommt zum Beispiel häufig
bei Patienten mit HIV-Infektion vor,
ist aber nicht auf Infektionskrankhei-
ten wie diese beschränkt, sondern wird
darüber hinaus auch bei Patienten mit
Malignomen diagnostiziert. Hier sind
vor allem Erwachsene betroffen. HLH
tritt dann meist bei Patienten mit Leu-
kämien oder Lymphomen auf, wie
Professor Gritta E. Janka vom Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
während der Jahrestagung der Ameri-
can Society of Hematology (ASH) in
New Orleans berichtet hat. HLH ist in
Hamburg einer von fünf klinischen
Schwerpunkten.
Primäre Form: Morbus Farquhar
HLH kann vererbt oder erworben
sein. Nach Angaben von Janka sind in-
zwischen vier verschiedene genetische
Defekte bekannt, die im Zusammen-
hang mit der familiären Form der Er-
krankung – früher als Morbus Far-
quhar bezeichnet – stehen. Allerdings:
Bei etwa 14 Prozent der Patienten mit
familiärer HLH in Deutschland konn-
ten diese Gendefekte nicht nachgewie-
sen werden. Als Hinweise auf die fa-
miliäre Form der Erkrankung, die sich
bei 80 Prozent der Betroffenen noch
vor dem ersten Lebensjahr manifes-
tiert, dienen ein abnormaler Granula-
tionstest und eine anhaltend einge-
schränkte Aktivität der natürlichen
Killerzellen.
HLH ist ein Entzündungssyndrom,
das durch eine übermäßige Aktivie-
rung von Lymphozyten und Makro-
phagen entsteht, mit der Folge, dass
massiv Zytokine ausgeschüttet werden,
vor allem Gamma-Interferon, weniger
dagegen Interleukin 6, betonte Janka.
Transplantation oder Suppression
Ziel der Behandlung ist deshalb, diese
übermäßige Zytokinausschüttung zu
bremsen oder zu beenden. Bei Patien-
ten mit der familiären Form geht das
mithilfe der Transplantation hämato-
poetischer Stammzellen, wie Janka
sagte. Damit lässt sich der Immunde-
fekt korrigieren. Die erforderliche my-
eloablative Konditionierung sei zudem
heute weniger aggressiv als früher,
nachdem sich gezeigt hatte, dass die
ursprünglich intensive Konditionie-
rung mit einer erhöhten Mortalität as-
soziiert war, so die Pädiaterin und
Hämatoonkologin.
Immunsuppression ist zweischneidig
Bei erworbener HLH ist das Ziel, die
überschießende Entzündungsreaktion
pharmakologisch in den Griff zu be-
kommen. Für die Immunsuppression
stehen Kortikosteroide, Immunglobu-
line, Ciclosporin A sowie gegen
Zytokine gerichtete Antikörper zur
Verfügung. Natürlich gleiche die
HLH-Therapie einem zweischneidi-
gen Schwert, so Janka, da die Immun-
suppression dazu führen könne, dass
der ursprüngliche infektiöse Trigger –
etwa eine Infektion mit dem Epstein-
Barr-Virus (EBV), das auch T-Zellen
befällt – wieder die Oberhand be-
kommt. In Studien der internationalen
Histiocyte Society seien zum Beispiel
Dexamethason, Etoposid und Ciclo-
sporin A verwendet und damit eine
Fünf-Jahres-Überlebensrate von 54
Prozent erreicht worden. Noch immer
sterbe allerdings etwa jeder dritte Pati-
ent im Zusammenhang mit der Thera-
pie.
Killerzellen drastisch gedrosselt
Außer Fieber, Hepatosplenomegalie
und Zytopenien zählen ein Hb 9
g/dl (bei Säuglingen jünger als vier
Wochen 10 g/dl) sowie eine Hyper-
triglyzeridämie und/oder Hypofibrino-
genämie zu den Diagnosekriterien.
Das Ferritin liegt über 50 g/dl, die
Zahl der Thrombozyten 100 000/ l
und der Neutrophilen 1000/ l. Die
Aktivität der natürlichen Killerzellen
ist drastisch vermindert oder gar nicht
nachweisbar. Im Knochenmark, im Li-
quor, in der Milz oder in den Lymph-
knoten finden sich schließlich Zeichen
einer Hämophagozytose: Makropha-
gen verleiben sich etwa Granulozyten
oder Erythrozyten ein.
Mit fünf der insgesamt acht Kriteri-
en lasse sich eine HLH korrekt diag-
nostizieren, betonte Janka auf der Ver-
anstaltung. Diagnostische Kriterien
und Therapieoptionen haben die Mit-
glieder der Mitte der 1980er-Jahre ge-
gründeten Histiocyte Society entwi-
ckelt.
Fieber, Hepatosplenomega-
lie und Zytopenien – Anlass
zu prüfen, ob eventuell eine
hämophagozytische
Lymphohistiozytose (HLH)
die Ursache ist.
Fieber, vergrößerte Milz und
Zytopenie: Histiozytose?
Von Peter Leiner
Bei der hämophagozytischen Lymphohistiozytose sind Lymphozyten übermäßig
aktiviert.
© JUAN GÄRTNER / FOTOLIA.COM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Mit fünf der insgesamt acht Kriterien lässt sich
eine HLH korrekt diagnostizieren.
Prof. Dr. Gritta E. Janka
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Kryotherapie entfernt eine aktinische
Dermatose ebenso wirksam wie eine
CO
2
-Laserablation und die Patienten
bleiben damit länger in Remission. Ein
Team um Professor Piergiacomo
Calzavara-Pinton von der Universität
in Brescia in Italien hat in einer kont-
rollierten Studie bei 200 Patienten mit
isolierten Läsionen die Laserablation
mit der Kryotherapie verglichen. Die
Patienten hatten insgesamt 543 Haut-
läsionen im Gesicht und auf dem
Schädel. Ferner zeigten sie keine oder
nur eine geringe lichtbedingte Alte-
rung der umgebenden Hautareale.
Vereisung entfernt dicke Läsionen
Die Hälfte der Patienten bekam eine
Kryobehandlung: Die Ärzte tunkten
ein Baumwollstäbchen in flüssigen
Stickstoff und drückten es für 10 bis
20 Sekunden auf die Hautläsionen.
Die übrigen Patienten wurden dreimal
mit einem C0
2
-Laser während einer
Therapiesitzung bestrahlt (Pulse mit
500 Mikrosek./50 Hz und 2,3 Watt).
Nach drei Monaten ließ sich bei 72
Prozent der Patienten mit Kryothera-
pie und bei 65 Prozent derer mit La-
serablation eine Komplettremission
feststellen, der Unterschied war jedoch
nicht signifikant. Schauten sich die
Dermatologen um Calzavara-Pinton
die Gesamtzahl der Läsionen an, dann
lag die Remissionsrate mit Kryothera-
pie bei 78 Prozent und mit Laser bei
72 Prozent auf einem vergleichbaren
Niveau. Ein signifikanter Unterschied
zeigte sich jedoch bei besonders di-
cken Läsionen: Grad-III-Keratosen re-
mittierten per Vereisung zu 80 Pro-
zent, per Laser nur zu 60 Prozent.
Die Patienten mit Komplettremissi-
on wurden ein Jahr nachbeobachtet.
Mit Kryotherapie blieben 53 von 73
Patienten in Remission (73%), von
den Laserbehandelten nur 14 von 64
(22%). Von allen Läsionen blieben mit
flüssigem Stickstoff 67 Prozent, mit
den Lichtpulsen nur 37 Prozent in Re-
mission. Auch hierbei zeigte sich, dass
Patienten mit dicken Läsionen besser
auf die Kryotherapie ansprachen.
In der kosmetischen Beurteilung
gab es nach drei Monaten keine Un-
terschiede, sowohl die Patienten selbst
als auch die Dermatologen kamen in
beiden Gruppen zu ähnlichen Ergeb-
nissen. Allerdings war die Zufrieden-
heit mit der Therapie bei Patienten
mit Vereisung signifikant höher. Insge-
samt halten die Studienautoren eine
Kryotherapie bei Patienten mit isolier-
ten aktinischen Keratosen und gerin-
ger lichtbedingter Hautalterung für
überlegen. Die Vereisung mit Stick-
stoff, so vermuten sie, führt im Ver-
gleich zur Laserablation zur vollständi-
geren und gleichmäßigeren Zerstörung
des Epithels. In Studien habe sich aber
bei Patienten mit multiplen leichten
Läsionen die photodynamische Thera-
pie als effektiver erwiesen.
(mut)
Bei aktinischer Keratose
bringt die Kältetherapie
Vorteile gegenüber der
Laserablation.
Aktinische Keratose: Kälte schlägt Laser
Es gibt keine Labortests, mit der
sich Psoriasis-Arthritis (PsA) sicher
erkennen ließe. Knifflig wird die
Differenzialdiagnose, wenn Patien-
ten keine ausgeprägten Psoriasis-
Effloreszenzen aufweisen und die
Gelenkbeteiligung den Befunden
bei rheumatoider Arthritis (RA) äh-
nelt. Wissenschaftler um Dario
Graceffa, Rom, haben mittels Na-
gelfalz-Kapillaroskopie untersucht,
ob die jeweiligen morphologischen
und rheologischen Veränderungen
in der Mikrozirkulation die Unter-
scheidung zwischen PsA und RA
erleichtern. In der unmittelbaren
Aufsicht fällt auf, dass PsA- im Ver-
gleich zu RA-Patienten mehr ge-
wundene Kapillaren bei geringerer
Kapillardichte aufwiesen. Die Un-
terschiede weisen womöglich auf
pathogenetische Differenzen hin,
die sich für die korrekte Diagnose
nutzen lassen, meinen die Autoren.
Die Kapillaroskopie könnte sich
dann durchaus eignen, zwischen
PsA und RA zu trennen.
In beiden Fällen ist die Kapillar-
permeabilität beeinträchtigt, die
Verbindung des Endothels mit der
extrazellulären Matrix gestört. Ab-
lesen lässt sich dies an abnorm
strukturierten und geformten Ka-
pillaren in den dermalen Papillen.
Kapillarmorphologisch zeigten
sich allerdings keine Unterschiede
bei den Probanden einer Studien-
gruppe, die aus 30 Patienten mit
PsA, 30 mit RA und 30 gesunden
Kontrollpersonen bestand. Die
Zahl der Megakapillaren, Hämor-
rhagien, Ramifikationen und avas-
kulären Gebiete differierte nicht si-
gnifikant.
(rb)
Kapillaroskopie
bringt den
Durchblick
Spärliche psoriatische
Hautzeichen machen es
schwierig, die Gelenkver-
änderungen einer Psoria-
sis- oder rheumatoiden
Arthritis zuzuordnen.
RA ODER PSA?
Menschen, die in sozioökonomisch
benachteiligten Regionen leben,
sind häufiger von Typ-2-Diabetes
und Adipositas betroffen. Dies zeigt
eine aktuelle Analyse von Daten der
telefonischen
Gesundheitsbefra-
gung GEDA durch Wissenschaftler
des Helmholtz-Zentrums München
und des Robert Koch-Instituts in
Berlin. Die Ergebnisse sind im
Fachjournal PLOS ONE veröffent-
licht. In Regionen mit der höchsten
Benachteiligung lag die Häufigkeit
eines Typ-2-Diabetes bei 8,6 Pro-
zent der Befragten und für Adiposi-
tas bei 16,9 Prozent, gegenüber 5,8
bzw. 13,7 Prozent in nur gering be-
nachteiligten Regionen. Demnach
hatten Personen in den Gebieten
mit der höchsten Deprivation eine
rund 20 Prozent höhere Wahr-
scheinlichkeit für Typ-2-Diabetes,
verglichen mit den am wenigsten
benachteiligten Regionen. Bei Adi-
positas lag sogar eine um fast 30
Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit
in Zusammenhang mit höherer De-
privation vor.
(art)
Umfeld hat
Einfluss auf die
Gesundheit
DIABETES/ADIPOSITAS