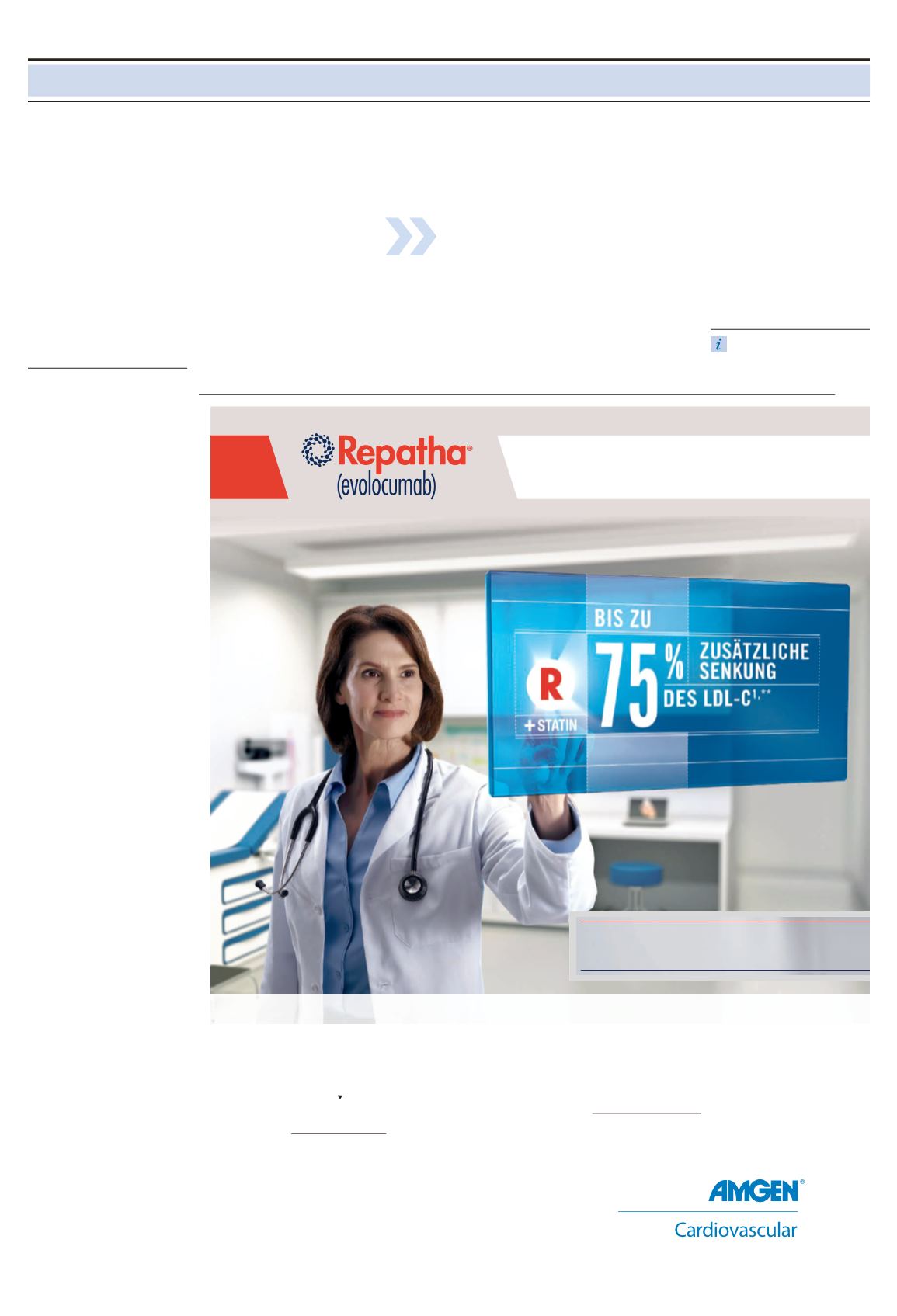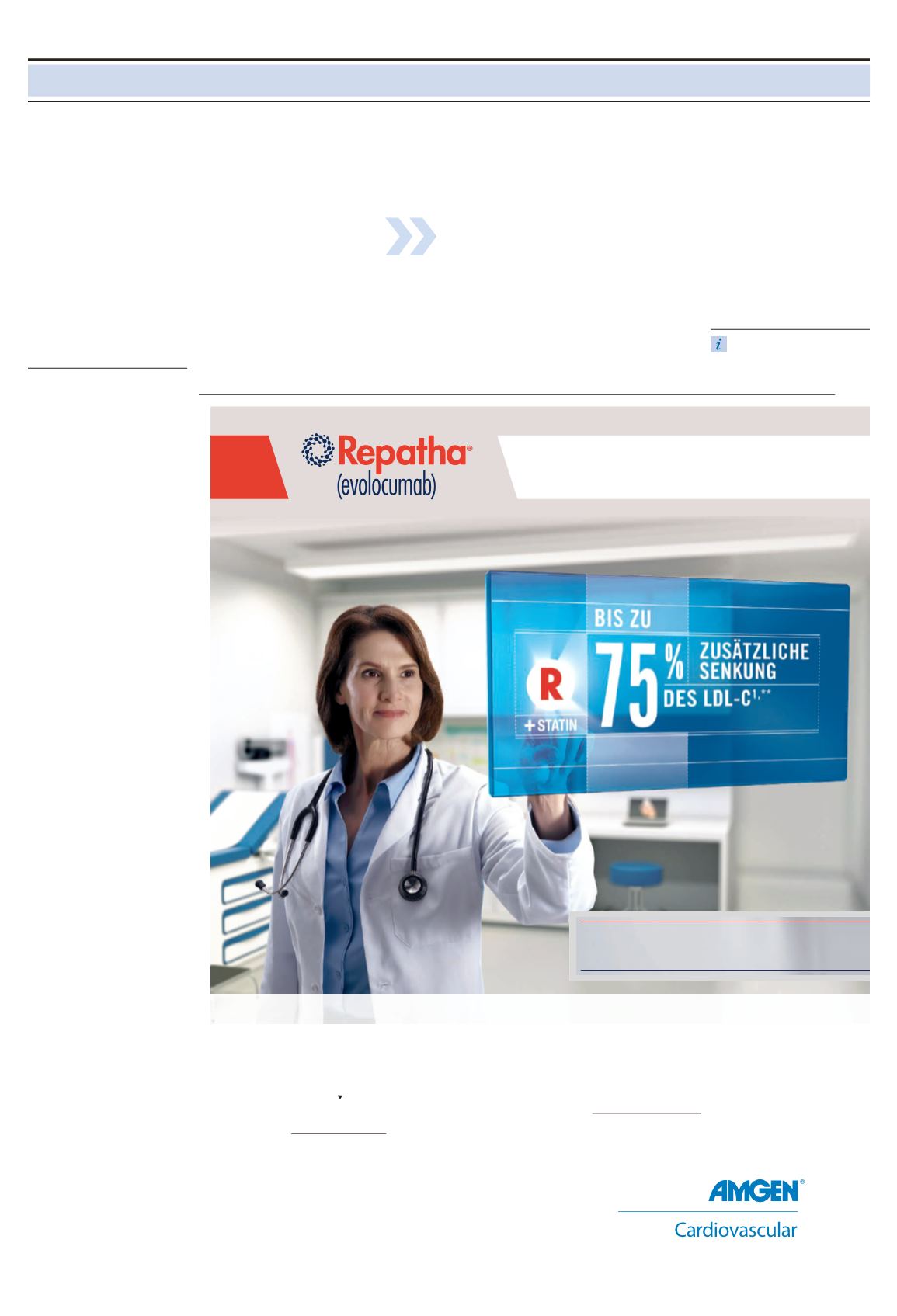
Werden Fehlbildungen wie Mikroze-
phalien bei Säuglingen in Brasilien
wirklich durch Zika-Virus-Infektionen
bei den Müttern verursacht? Dies
wurde kürzlich mangels verlässlicher
Zahlen zur Epidemiologie von Mikro-
zephalien in dem Land bezweifelt. So
war dort die normale Inzidenz der
Fehlbildungen mit unter 200 pro Jahr
angegeben worden. Die Quote von 0,5
pro 10000 Geburten nach Geburtsur-
kunden liege aber deutlich unter dem
zu erwartenden Niveau, berichtet
„Medpage Today“. Zum Vergleich: In
den USA werde die Rate auf 2 bis 12
pro 10000 geschätzt, was 4000 bis
25000 Fälle jährlich bedeute.
Mehr als 4700 Fälle von Mikroze-
phalie waren in Brasilien zwischen
Mitte 2015 und Januar 2016 regist-
riert worden. Die Häufung fand
gleichzeitig
zu
einem
großen
Zika-Virus-Ausbruch statt, der sich in-
zwischen auf 26 Länder in Lateiname-
rika ausgedehnt hat. Die WHO hat
wegen der Fehlbildungen den globalen
Gesundheitsnotstand ausgerufen.
Brasilien bildet Task-Force
Das brasilianische Gesundheitsminis-
terium hat eine Task-Force gebildet,
die den Zusammenhang zwischen den
Infektionen und den Fehlbildungen
untersuchen soll. Darin eingebunden
sind auch die US-Centers for Disease
Control and Prevention (CDC). Die
oberste Seuchenbehörde der USA hat
jetzt starke Hinweise für einen kausa-
len Zusammenhang zwischen Zika-
Viren und Fehlbildungen gefunden
und publiziert. CDC-Chef Dr. Tom
Frieden hat die Befunde vor Politikern
in Washington als „bisher stärkste Evi-
denz“ des möglichen fruchtschädigen-
den Effekts von Zika-Viren bezeichnet,
berichtet „BBC News“. Ein Beweis für
die Teratogenität sind die Daten aller-
dings nicht.
CDC-Forscher um Dr. Roosecelis
Brasil Martines hatten die Gewebe-
proben aus Brasilien bereits im De-
zember untersucht. Die Proben
stammten von zwei gestorbenen Säug-
lingen mit Mikrozephalie einschließ-
lich Plazentagewebe sowie von zwei
Föten von Fehlgeburten aus der 11.
und
13.
Schwangerschaftswoche
(MMWR 2016; 65; 1–2). Alle Mütter
hatten im ersten Schwangerschafts-
trimester klinische Zeichen einer
Zika-Infektion gehabt, einschließlich
des typischen Ausschlags und Fieber.
Die Frauen waren allerdings während
der Geburt oder der Fehlgeburt nicht
akut erkrankt. Die CDC-Forscher ha-
ben die Formalin-fixierten Proben mit
einem PCR-Verfahren (RT-PCR) auf
Virus-RNA untersucht. In allen vier
Fällen wurden Zika-Viren gefunden;
eine Feintypisierung ergab, dass die
Erreger mit den in Brasilien zirkulie-
renden Virusstämmen übereinstimm-
ten. Bei den gestorbenen Neugebore-
nen fanden sich die Viren ausschließ-
lich im Gehirn. Bei einem toten Kind
fanden sich die Virus-Antigene dabei
in mononukleären Zellen, Vorstufen
von Gliazellen und Neuronen.
Auch histopathologische Verände-
rungen fanden sich bei den toten Ba-
bys nur im Gehirn: Verkalkungen des
Parenchyms, Knoten in der Mikroglia,
degenerierte Zellen und Nekrosen.
Tests möglicher alternativer Ursachen
für die Fehlbildungen wie Toxoplas-
mose, Röteln, Cytomegalie, Herpes
simplex und HIV waren bei den Müt-
tern negativ gewesen. Auch Tests auf
eine mögliche alternative Infektion mit
Dengue-Viren waren negativ.
Virus auch in Chorionzotten
Bei einem Fötus wurden die Virus-
spuren zudem in den Chorionzotten
gefunden. Auch hier ergaben sich his-
topathologische Veränderungen wie
heterogene Chorionzotten mit Verkal-
kungen, Fibrosen, Fibrin-Ablagerun-
gen, Entzündungen der Plazentazotten
(Villitis).
Zika-Viren wurden also im Gewebe
der Kinder nachgewiesen, betonen die
Wissenschaftler. Hirnzellen sowie frü-
hes Plazenta-Gewebe seien offenbar
die bevorzugten Stellen für die Virus-
Diagnostik post-mortem. Um die Pa-
thogenese der Infektion besser verste-
hen zu können, müsse jetzt der Effekt
der Erkrankung der Mütter in ver-
schiedenen Stadien der Schwanger-
schaft untersucht werden, so die For-
scher.
Die Zika-Forschung wird in den
USA forciert, weil ein Übergreifen des
Ausbruchs auf Puerto Rico und ande-
re US-Regionen befürchtet wird. Trotz
großer Anstrengungen werde es Jahre
dauern, bis ein Impfstoff zur Verfü-
gung steht, so die Behörde. Die CDC
wollen nun gefährdete US-Staaten bei
der Bekämpfung der Überträger-
mücken unterstützen.
Die WHO hat Schutzmaßnahmen
für Frauen in Zika-Regionen zusammen-
gestellt:
zika-pregnancy/en
US-Forscher haben Gewe-
beproben toter Säuglinge
mit Mikrozephalie unter-
sucht. Die Befunde erhär-
ten den Verdacht, dass
Zika-Viren die Ursache von
Fehlbildungen sind. Viele
Fragen bleiben offen.
Zika-Viren in Hirnzellen nachgewiesen
Von Wolfgang Geissel
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Das ist die bisher
stärkste Evidenz
zum Effekt der
Zika-Viren auf
Babys.
Dr. Tom Frieden,
Direktor der US-
Seuchenbehörde CDC
ANZEIGE
DE-P-145-1115-119885
LDL-C = Low-density lipoprotein cholesterol
Repatha
®
140 mg Injektionslösung in einem Fertigpen
Wirkstoff:
Evolocumab Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Jeder Verdachtsfall einer Nebenwirkung sollte gemeldet werden.
Zusammensetzung:
Arzneilich wirksamer Bestandteil: Jeder Fertigpen
enthält 140 mg Evolocumab in 1 ml Lösung. Evolocumab ist ein humaner monoklonaler IgG2-Antikörper, der mittels rekombinanter DNA-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) hergestellt wird. Sonstige Bestandteile:
Prolin, Essigsäure 99%, Polysorbat 80, Natriumhydroxid (zur pH-Wert Einstellung), Sorbitol, Wasser für Injektionszwecke.
Anwendungsgebiete:
Hypercholesterinämie und gemischte Dyslipidämie Repatha wird bei Erwachsenen mit primärer
Hypercholesterinämie (heterozygot familiär und nicht-familiär) oder gemischter Dyslipidämie zusätzlich zu diätetischer Therapie angewendet: • in Kombination mit einem Statin oder einem Statin mit anderen lipidsenkenden Therapien bei
Patienten, die mit der maximal tolerierbaren Statin-Dosis die LDL-C-Ziele nicht erreichen, oder • allein oder in Kombination mit anderen lipidsenkenden Therapien bei Patienten mit Statinintoleranz oder für welche ein Statin kontraindiziert
ist. Homozygote familiäre Hypercholesterinämie Repatha wird bei Erwachsenen und Jugendlichen im Alter von 12 Jahren und älter mit homozygoter familiärer Hypercholesterinämie in Kombination mit anderen lipidsenkenden Therapien
angewendet. Die Wirkung von Repatha auf kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität wurde bisher noch nicht nachgewiesen.
Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.
Nebenwirkungen:
Häufig: Influenza, Nasopharyngitis, Infektion der oberen Atemwege, Hautausschlag, Übelkeit, Rückenschmerzen, Arthralgie, Reaktionen an der Injektionsstelle; gelegentlich: Urtikaria.
Weitere Angaben:
s. Fach- und Gebrauchsinformation.
Verschreibungspflichtig. Stand der Information:
Juli 2015
AMGEN Europe B.V., 4817 ZK Breda, Niederlande; (Örtlicher Vertreter Deutschland: AMGEN GmbH, 80992 München)
* Hochrisiko-Patienten definiert nach den Kriterien der deutschen Arzneimittelrichtlinie zur Verordnung von Lipidsenkern: Patienten mit
bestehender vaskulärer Erkrankung (KHK, cerebrovaskulärer Manifestation, pAVK) und Patienten mit hohem kardiovaskulären Risiko
(über 20% Ereignisrate auf der Basis der zur Verfügung stehenden Risikokalkulatoren).
AM-RL-III-Verordnungs-einschraenkung_2015-09-02.pdf
** Patienten mit primärer Hypercholesterinämie und gemischter Dyslipidämie; mit Repatha
®
wurde bereits ab Woche 1 eine LDL-C Absenkung
um etwa 55% bis 75% erreicht und während der Langzeittherapie aufrecht erhalten.
Behandlungseffekte von Repatha
®
im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit primärer Hypercholesterinämie und gemischter Dyslipidämie.
1
Fachinformation Repatha
®
, Stand Juli 2015.
Erfahren Sie mehr unter:
ZUSÄTZLICHE LDL-C-SENKUNG
1
FÜR IHRE HOCHRISIKO-PATIENTEN*
DER ERSTE
ZUGELASSENE
PCSK9-INHIBITOR
IN DEUTSCHLAND!
1
Medizin
BDI aktuell
März 2016
11