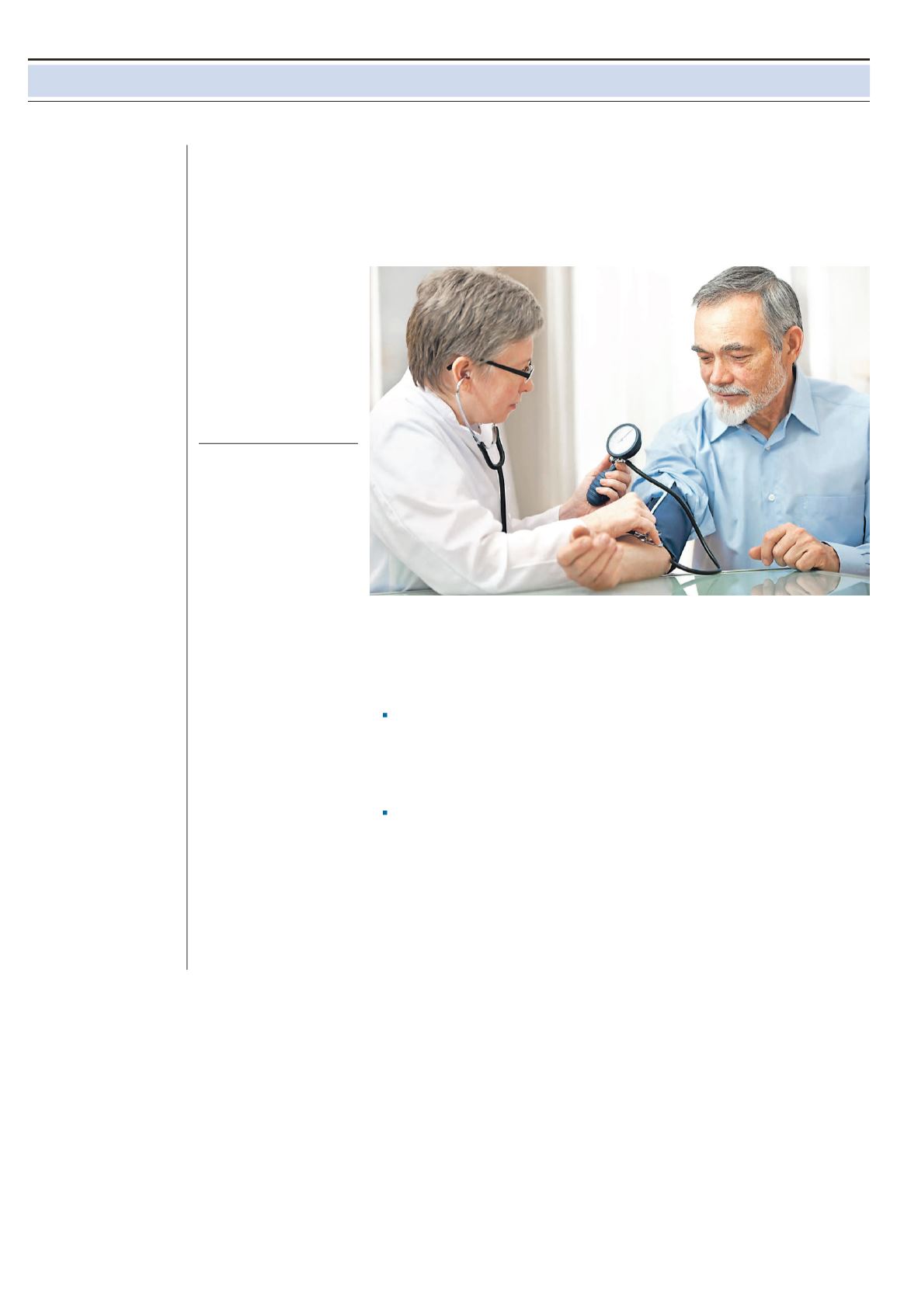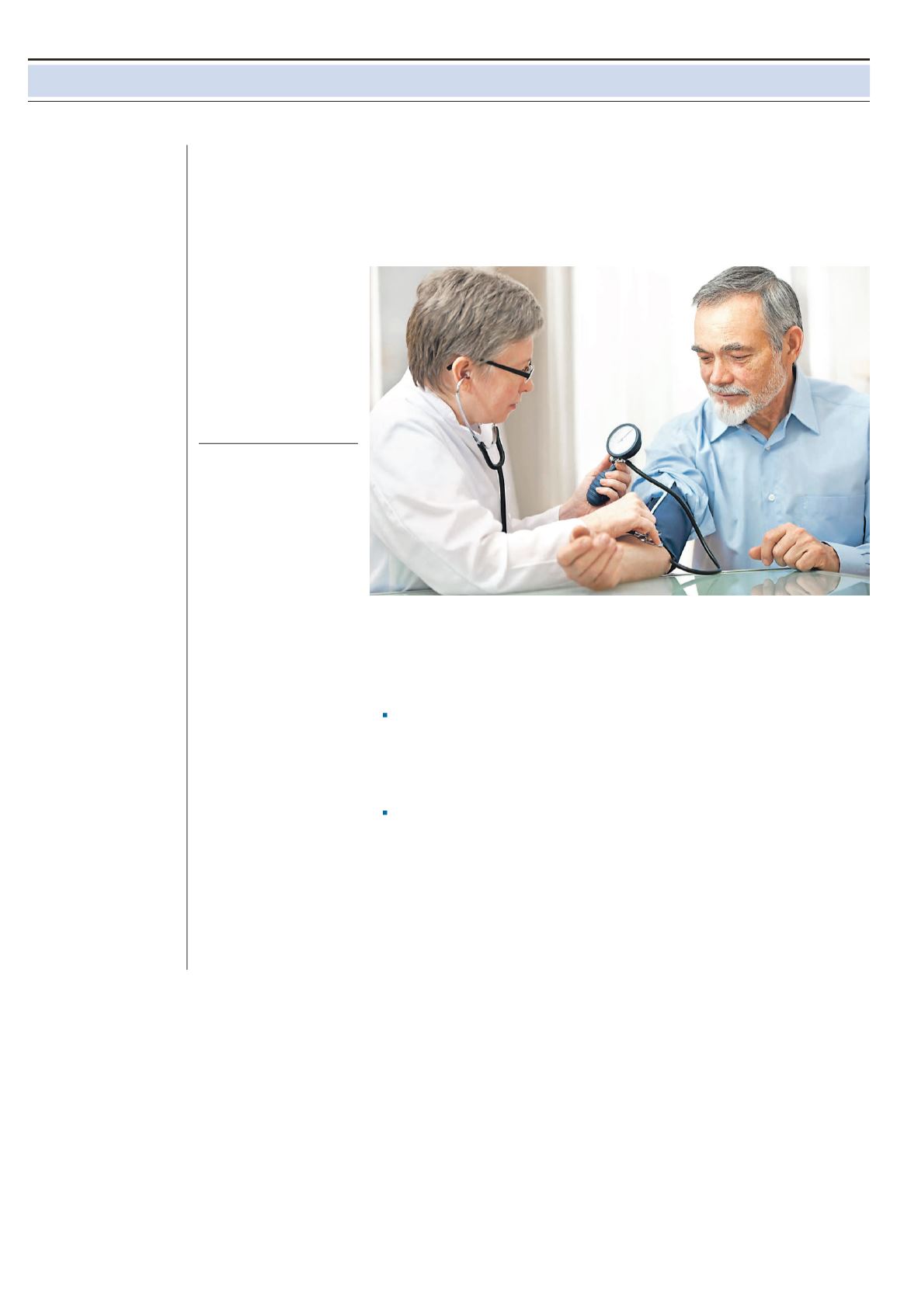
Menschen mit extremer Adipositas
(Body-Mass-Index, BMI 40) haben
eher geringe Chancen auf einen The-
rapieerfolg mit konservativen Maßnah-
men, selbst wenn sie psychologisch be-
gleitet werden. Deshalb hat sich im
Adipositas-Stadium III die bariatrische
Chirurgie als Therapie der Wahl etab-
liert. Mit einem solchen Eingriff kann
sich auch ein Typ-2-Diabetes substan-
ziell verbessern. Zudem kristallisiert
sich immer mehr der Einfluss gastroin-
testinaler Operationen auf den Gluko-
semetabolismus, unabhängig vom Ge-
wichtsverlust, heraus.
Liegen Folge- und Begleiterkran-
kungen wie Diabetes oder Hypertonie
vor, ist die Adipositaschirurgie bereits
ab Stadium II (BMI
$
35 kg/m
2
) indi-
ziert. Im Einzelfall kann bei einem
Typ-2-Diabetiker sogar schon bei
einem BMI zwischen 30 und 35 kg/m
2
eine bariatrische Operation erwogen
werden. Dabei werde, so Professor
Thomas Hüttl, Ludwig-Maximilians-
Universität München, keines der der-
zeit praktizierten Verfahren pauschal
empfohlen. Vielmehr sollten bei der
Wahl der Methode neben Komorbidi-
täten auch BMI, Alter, Geschlecht,
Adhärenz und Beruf berücksichtigt
werden.
Schon die ersten Daten belegten
den Wert des operativen Verfahrens.
Nach zwei Jahren waren 95 Prozent
der Typ-2-Diabetiker mit BMI
$
35
kg/m
2
nach biliopankreatischer Diver-
sion (BPD) und 75 Prozent nach
Roux-en-Y-Bypass in Remission. In
Langzeitstudien zeigte sich bei jedem
zweiten Diabetiker mit Adipositaschir-
urgie eine Langzeitremission des Dia-
betes über fünf Jahre (37 Prozent aus
der Bypass-Gruppe, 63 Prozent aus
der BPD-Gruppe). Unter medikamen-
töser Standard-Diabetestherapie allein
gelang dies dagegen bei keinem Pati-
enten. Auch fünf Jahre nach Magenby-
pass-Operation oder BPD lag bei 42
Prozent beziehungsweise 68 Prozent
der Patienten der HbA
1c
-Wert bei
#
6,5 Prozent. Außerdem verbesserten
sich in beiden Op-Gruppen die Plas-
malipidwerte und das kardiovaskuläre
Risiko. Zudem sank der Medikamen-
tenverbrauch (Lancet 2015; 386:
964-973).
Auf lange Sicht sehen Professor
Geltrude Mingrone und Kollegen von
der Universität in Rom eine Operation
für adipöse Typ-2-Diabetiker als effek-
tiver an als die rein medikamentöse
Behandlung. Die Tatsache, dass bei 53
Prozent der Patienten mit Magenby-
pass und 37 Prozent mit BPD fünf
Jahre nach der Operation ein Diabe-
tesrezidiv festgestellt wurde, obwohl
die Patienten drei Jahre zuvor noch in
Remission waren, mache deutlich, wie
wichtig langfristige glykämischen Kon-
trollen seien.
Auch Dr. Vojtech Pavlicek vom
Kantonsspital Münsterlingen wertet in
seinem Kommentar zu der Studie die
bariatrische Therapie - und insbeson-
dere Magenbypass und BPD - als viel-
versprechende Therapieoptionen zur
Behandlung von Adipositas und Dia-
betes. Er weist neben der relativ hohen
Diabetes-Rezidivrate fünf Jahre nach
dem Magenbypass aber auch auf eini-
ge Gefahren wie etwa eine mögliche
Mangelernährung, hin (Diabetologe
2015; 11: 591-592).
(St)
Die chirurgische Adipositas-
therapie wirkt bei extrem
adipösen Typ-2-Diabetikern
besser als eine medikamen-
töse Diabetesbehandlung.
Das belegen erste Lang-
zeitdaten.
Bei adipösen Diabetikern zeigt bariatrische Op Erfolg
14
März 2016
BDI aktuell
Medizin
Die von den National Institutes of
Health finanzierte SPRINT-Studie
hatte im Jahr 2015 gezeigt, dass hyper-
tensive Patienten von einer Absenkung
des systolischen Zielblutdrucks auf
120 mmHg im Vergleich zum aktuel-
len Leitlinienziel 140 mmHg im Hin-
blick auf kardiovaskuläre Ereignisse
aller Art stark profitieren. Die
SPRINT-Studie berücksichtigte dabei
ein sehr breites Spektrum von Patien-
ten mit und ohne Begleit- und Folge-
erkrankungen, hatte aber aus der Sicht
vieler Experten einen Schönheitsfeh-
ler: Diabetespatienten waren ausge-
schlossen.
Seither tobt die Diskussion darüber,
ob ein niedrigerer Zielwert von 120
mmHg systolisch nicht auch bei Dia-
betespatienten von Vorteil sein könnte.
Bei der Jahrestagung der American
Heart Association (AHA) in Orlando
nahm sich der Studienleiter der
ACCORD-Studie, Dr.William Cush-
man vom VA Medical Center in Mem-
phis im US-Bundesstaat Tennessee
dieser Frage an.
Daten aus ACCORD-Studie
Die ACCORD-Studie war eine Diabe-
tes-Studie im Faktorialdesign, die so-
wohl eine aggressive Blutzuckersen-
kung als auch eine aggressive Lipid-
und Blutdrucksenkung im Vergleich
zum jeweiligen Standard evaluiert hat-
te. Von Blutdruckseite waren, ähnlich
wie in der SPRINT-Studie, die systoli-
schen Zielwerte 140 mmHg und 120
mmHg verglichen worden.
Anders als in der SPRINT-Studie
gab es in der ACCORD-Studie bei
den Patienten mit Diabetes-Erkran-
kung allerdings nur eine nicht signifi-
kante Senkung des Risikos für kardio-
vaskuläre Todesfälle, nicht tödliche
Herzinfarkte und Schlaganfälle (pri-
märer Endpunkt) um 12 Prozent.
Heißt das, dass sich die SPRINT-Stu-
die nicht auf Diabetiker übertragen
lässt?
Vielleicht doch. Cushman betonte
in Orlando, dass die Blutdruck-Sub-
studie der ACCORD-Studie mit ihren
gut 4700 Teilnehmern, einem mittle-
ren Follow-up-Zeitraum von 4,9 Jah-
ren und einer deutlich geringer als an-
tizipierten Ereignisrate möglicherweise
statistisch unterpowert war. Zum Ver-
gleich: Die SPRINT-Studie war dop-
pelt so groß.
Auch vor diesem Hintergrund
haben sich Cushman und Kollegen in
einer ACCORD Follow-on (ACCOR-
DION) genannten Nachauswertung
der ACCORD-Studie die Entwicklung
der ACCORD-Patienten im Langzeit-
verlauf angesehen. Dafür konnten sie
immerhin 87 Prozent jener Patienten
ausfindig machen, die am offiziellen
Ende der ACCORD-Studie noch am
Leben waren.
Das Ergebnis ist zunächst im Ein-
klang mit dem ursprünglichen Ergeb-
nis: Da die Patienten nach Studien-
ende nicht mehr intensiver behandelt
worden waren, verringerte sich der
Blutdruckunterschied zwischen den
Gruppen, und auch der 12-prozentige
Vorteil der intensiver blutdruckthera-
pierten Gruppe beim primären End-
punkt verringerte sich nach nun
8,8 Jahren auf noch immer nicht
signifikante 9 Prozent.
Unterschiede bei langem Follow-up
Aber: Nach dem langen Follow-up-
Zeitraum zeigt sich, was sich am Ende
der ursprünglichen Studie schon ange-
deutet hatte, nämlich eine klare, jetzt
auch statistisch signifikante Interaktion
zwischen Blutdruckintervention und
Blutzuckerintervention
in
der
ACCORD-Studie. Wurden nur jene
Patienten ausgewertet, die eine nicht
intensive Blutzuckersenkung erhielten,
war der Nutzen der intensiven Blut-
drucksenkung nachweisbar, und zwar
in derselben Größenordnung wie in
der SPRINT-Studie.
Klar ist, dass diese nachträgliche
Analyse einer Subgruppe nichts wirk-
lich beweisen kann. Sie deutet aber
doch darauf hin, dass es sich lohnen
könnte, die intensive Blutdrucksen-
kung auch bei Diabetespatienten noch
einmal gezielt zu evaluieren, ohne
dabei gleichzeitig den Blutzucker in
Bereiche zu senken, von denen heute
klar ist, dass sie für die Patienten
gefährlich waren.
Seit der SPRINT-Studie gilt
ein Blutdruckziel unter 120
mmHg bei Risikopatienten
wieder als legitim. Diabeti-
ker waren an SPRINT aber
nicht beteiligt. Daten der
ACCORD-Studie sprechen
aber auch für einen Nutzen
bei Diabetikern.
Diabetiker profitieren wohl auch
von intensiver Blutdrucksenkung
Von Philipp Grätzel von Grätz
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ergebnisse der
ACCORD-Studie
Nach dem langen Follow-up-
Zeitraum zeigt sich,
was sich
am Ende der ursprünglichen
Studie schon angedeutet hatte,
nämlich eine klare, jetzt auch
statistisch signifikante Interaktion
zwischen Blutdruckintervention
und Blutzuckerintervention.
Wurden nur jene Patienten aus-
gewertet,
die eine nicht
intensive Blutzuckersenkung
erhielten, war der Nutzen der
intensiven Blutdrucksenkung
nachweisbar, und zwar in der-
selben Größenordnung wie in der
SPRINT-Studie.
Blutdruckmessung: Was ist der ideale Zielwert für Diabetes-Patienten?
© ALEXANDER RATHS / FOTOLIA.COM
Forscher haben zwei Gene ent-
deckt, die bei Diabetikern das Risi-
ko für eine Albuminurie erhöhen
(Diabetes 2015; online 2. Dezem-
ber). An der Studie war ein interna-
tionales Team von mehr als 120
Wissenschaftlern beteiligt, die im
CKDGen-Konsortium zusammen-
geschlossen sind, teilt die Universi-
tät Greifswald mit.
Im Rahmen der Studie wurden
die genetischen Informationen von
mehr als 50000 Teilnehmern aus
30 Studien weltweit ausgewertet.
Die beiden identifizierten Gene
wurden durch eine genomweite
Analyse entdeckt und standen bis-
her noch nicht im Zusammenhang
mit Nierenerkrankungen beim
Menschen. Es wurde festgestellt,
dass pro beobachteter Modifikation
in den identifizierten Risikogenen
sich der durchschnittliche Anteil
von Albumin im Urin bei Diabeti-
kern um bis zu 21 Prozent erhöhte.
Dieses genetische Risiko fehlt indes
vollständig bei Nicht-Diabetikern
und ist somit ein nachgewiesenes
Beispiel einer Gen-Umwelt-Interak-
tion. Der genetische Zusammen-
hang konnte auch in einem Experi-
ment an Ratten bestätigt werden,
heißt es in der Mitteilung.
(eb)
Risikogene für
Albuminurie
identifiziert
NEPHROPATHIE
Neue Studienergebnisse erweitern
die Erkenntnisse zur Bedeutung
von verminderter Insulinwirkung
im Gehirn für Typ-2-Diabetes. Sie
weisen darauf hin, dass eine Insu-
linresistenz im Gehirn schon in ute-
ro angelegt sein könnte, teilt das
Uniklinikum Tübingen mit. Gesta-
tionsdiabetes verlangsame die Hirn-
reaktion des Fetus nach einer
Mahlzeit (J Clin Endocrinol Metab
2015; online 14. Oktober). Bei Kin-
dern von Schwangeren mit Gestati-
onsdiabetes reagierte im Vergleich
zur gesunden Kontrollgruppe das
Gehirn auf Töne eine Stunde nach
einer Mahlzeit später. Die Autoren
nähmen an, dass eine Prägung des
fetalen Stoffwechsels durch den der
Mutter stattfindet, die Konsequen-
zen für das spätere Diabetesrisiko
des Kindes haben kann.
(eb)
Diabetes bremst
Gehirnreaktion
des Fötus
GESTATIONSDIABETES