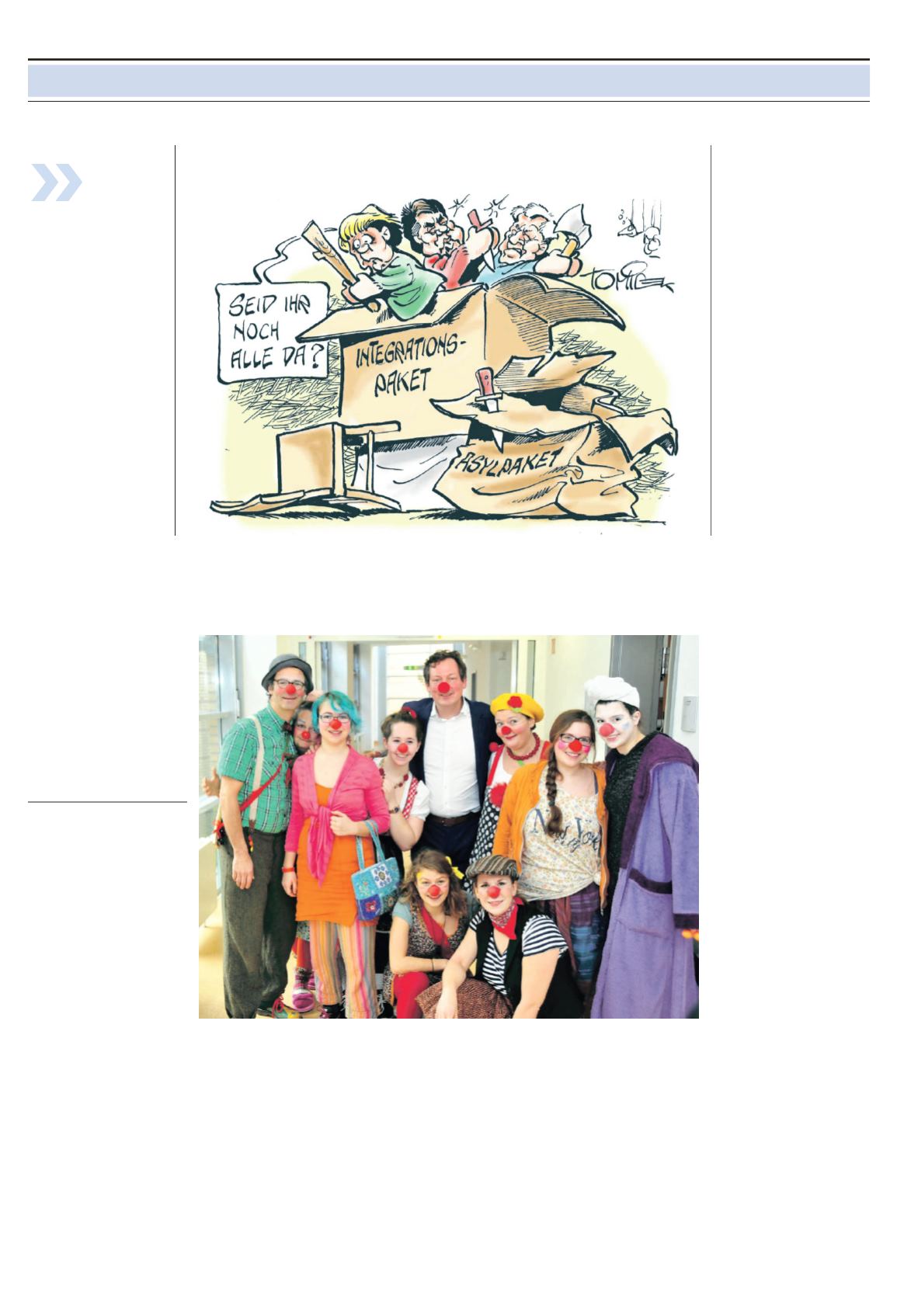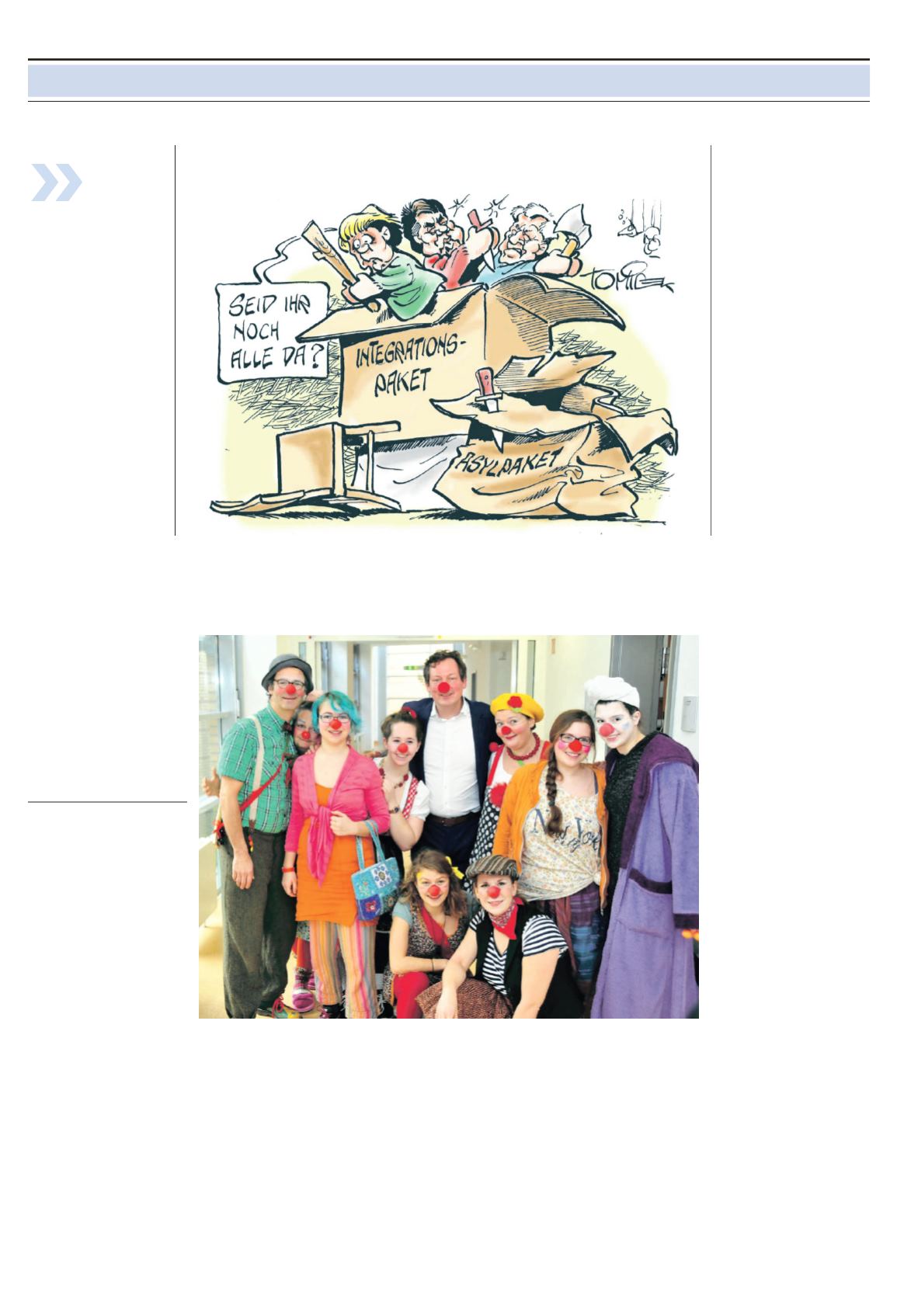
16
März 2016
BDI aktuell
Panorama
ZITIERT
Wir leben in einem
Land des großen
Heilsversprechens,
jede politische
Richtung gewährt
dem Bürger im
Gesundheitssystem
grenzenlose Freiheit.
Sie verspricht ihm die
Gewährleistung einer
qualitativ optimalen
Versorgung zu jeder
Tages- und Nachtzeit
... völlig kosten- und
verantwortungsfrei.
Dr. Monika Schliffke.
Vorstandsvorsit-
zende der KV Schleswig-Holstein beim
Neujahrsgespräch des Ersatzkassenver-
bandes (vdek) Schleswig-Holstein zum
Thema Portalpraxen und überfüllte
Klinik-Notaufnahmen.
Ein paar Gramm gute Wolle, acht
Maschen pro Nadel, vier Nadeln
und rund zwei Stunden Zeit. Das ist
alles, was Inge Döblinger braucht,
um Eltern und ihre Neugeborenen
glücklich zu machen. Die OP-
Schwester aus Bayern strickt Baby-
söckchen – und zwar Hunderte. Seit
16 Jahren bekommt jedes neugebo-
rene Kind der Klinik Kitzinger
Land ein Paar Babysöckchen ge-
schenkt. Alles in allem dürften auf
diese Weise bisher rund 7000 kleine
Wollsocken-Paare entstanden sein.
„Ich habe schon immer viel ge-
strickt. Und irgendwann habe ich
aus den Resten mal einen kleinen
Sockenanhänger für die Tasche
meiner Tochter gestrickt“, erinnert
sich die 57-Jährige. Der kam so gut
an, dass auch deren Freundinnen
welche wollten. Schließlich begann
Döblinger den Müttern nach ei-
nem Kaiserschnitt ein Paar Söck-
chen für das Baby zu schenken.
Und dann wollten die anderen na-
türlich auch welche haben.
(dpa)
Die strickende
OP-Schwester
aus Bayern
AUCH DAS NOCH
TOMICEK’S WELT
Rappelkisten
Sie sind albern, tollpatschig und schei-
tern an den einfachsten Aufgaben: Kli-
nikclowns sind besonders für die Kin-
der unter den Patienten eine willkom-
mene Abwechslung. Ärzte reduzieren
die Wirkung von Klinikclowns gerne
hierauf und bleiben ansonsten auf Dis-
tanz. Mal einen Spaß mitmachen, mal
über sich selbst lachen oder gar Kli-
nikclowns in das Stationsteam einbin-
den - dafür bietet die Welt der evi-
denzbasierten Medizin scheinbar kei-
nen Raum.
Tatsächlich ist der Erfolg von Kli-
nikclowns stark von Faktoren wie Kre-
ativität, Improvisation und Individuali-
tät abhängig, Standardisierung gehört
nicht dazu. Dass Klinikclowns und ihr
Humor trotzdem heilen helfen, ahnt
zwar jeder, der schon einmal bei einem
Auftritt am Krankenbett dabei war.
Und Aushängeschilder wie Dr. Eckart
von Hirschhausen kämpfen seit Jahren
darum, Humor in der Medizin salon-
fähig zu machen. Wissenschaftlich
nachgewiesen ist der Erfolg bislang
aber nicht.
Erster Schritt zur Humorforschung
Die kürzlich in Greifswald vorgelegten
vorläufigen Ergebnisse einer Pilotstu-
die in der Kinderchirurgie lassen von
Hirschhausen, der Schirmherr der
Studie ist, nun auf einen Durchbruch
hoffen. Er spricht von einem „wichti-
gen Schritt zu einer ernsthaften Hu-
morforschung. Studienleiter Professor
Winfried Barthlen berichtet von einem
um 30 Prozent gestiegenen Oxytocin-
Spiegel und deutlich verminderten
Angstgefühlen bei Kindern, die von
Klinikclowns besucht wurden. Zu den
Gruppen von Kindern zwischen vier
und 13 Jahren zählten 17 Kinder in
der Interventionsgruppe und 14 Kin-
der in der Kontrollgruppe. Befragt
wurden Kinder, Eltern, Klinikmitar-
beiter und die beteiligten Klinikclowns
von den „Grypsnasen“. Mal traten die
in der Ambulanz (durchschnittliche
Auftrittsdauer: 55 Minuten), mal auf
Station am Krankenbett (acht Minu-
ten) auf. Die Ergebnisse waren stets
die gleichen: Eltern berichteten, dass
sich die Kinder mit Clownkontakt
wohler gefühlt haben als in der Kont-
rollgruppe, Kinder und Mitarbeiter
äußerten sich positiv über die Auftrit-
te. Nun sollen die Ergebnisse über ei-
ne umfassende Anschlussstudie wis-
senschaftlich abgesichert werden.
Das ist sinnvoll, damit die im deut-
schen Medizinbetrieb bestehenden
Vorbehalte gegen Humor am Kranken-
bett endlich abgebaut werden. Dafür
gibt es gute Gründe: Lachen befreit
nicht nur von Spannungen und steigert
die Lebensfreude. Lachen im Kranken-
zimmer lenkt auch den Blick auf die
Welt jenseits der Klinikmauern. Kein
Patient möchte sich 24 Stunden am
Tag mit den bedrohlichen Folgen sei-
ner Erkrankung oder einer bevorste-
henden Operation auseinandersetzen.
Und wenn doch, zumindest nicht im-
mer bierernst. Der Klinikclown zwi-
schen Arztvisite und Angehörigenbe-
such ist für Kinder oft das Erlebnis, das
sie vom Krankenhausaufenthalt am
stärksten in Erinnerung behalten. Und
manchmal sind die Auftritte so beein-
druckend, dass Kinder am Entlas-
sungstag ein paar Stunden heraus-
schinden wollen, damit sie den Klinik-
clown noch einmal erleben. Ein Grund,
warum die Clowns bei den Kleinen so
gut ankommen, ist die Zeit, die sie sich
für sie nehmen. Sie beschäftigen sich
während der Auftritte nur mit den Kin-
dern im jeweiligen Raum.
Finanziert von den Kassen?
Niemand wünscht sich alberne oder
tollpatschige Ärzte am Krankenbett,
ein wenig mehr Humor aber könnte
manchmal nicht schaden. Für viele
Mediziner ist das schwer vorstellbar.
Barthlen erinnert sich an ein früheres
Vorstellungsgespräch, in dem er den
Verantwortlichen eine „fröhliche Kin-
derchirurgie“ ankündigte – und bei ih-
nen auf völliges Unverständnis stieß.
Barthlen zeigt in Greifswald, dass sich
Seriosität und der Einsatz von Klinik-
clowns nicht widersprechen. Hirsch-
hausen würde sich mehr Kollegen vom
Schlage Barthlens wünschen. Am liebs-
ten wäre ihm ein geregelter Einsatz, der
nicht länger von Vereinen getragen
wird und von Spenden abhängig ist.
Was aber wäre die Folge? Krankenkas-
sen, die für die Finanzierung von Kli-
nikclowns zuständig sind? Von Hirsch-
hausen wäre nicht von Hirschhausen,
wenn er dieses Szenario nicht auskos-
ten würde. „Kommen dann Dokumen-
tationspflichten für Klinikclowns? Und
müssen sich Klinikclowns dann recht-
fertigen, weil sie nur zu 89 Prozent so
lustig waren wie der Kollege?“
Wie auch immer die Finanzierung
geregelt wird, von Hirschhausen hätte
den Klinikclown am liebsten als festen
Bestandteil im Klinikteam. „Das wäre
eine gute Investition“, steht für ihn fest.
Andere Länder machen es vor. In der
Schweiz und in den Niederlanden sind
Clownbesuche am Krankenbett längst
selbstverständlich. Wer für den Einsatz
von Klinikclowns ist, muss aber auch
Coaching und Supervision einplanen,
gibt von Hirschhausen zu bedenken.
Tatsächlich sind die lustigen Auftritte
harte Arbeit, von der sich die Klinik-
clowns belastet fühlen. Die Konfronta-
tion mit Leid und Tod erfordern, dass
sich die Clowns nach den Einsätzen
untereinander austauschen.
Erhalten Kinder Besuch
vom Klinikclown, fühlen sie
sich besser und haben
weniger Angst. Das zeigen
erste Auswertungen einer
Greifswalder Studie.
Die Initiatoren hoffen, dass
Clowns bald fest zum
Klinikteam gehören.
Klinikclowns: Studie belegt Wirkung
Dr. Eckart von Hirschhausen (Mitte) ist Schirmherr der Greifswalder Studie.
© UMG/JANKE
Von Dirk Schnack
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
30%
höher war der Oxytocin-Spiegel
von Kindern, die während ihres
Klinikaufenthaltes von einem
Klinikclown besucht wurden.