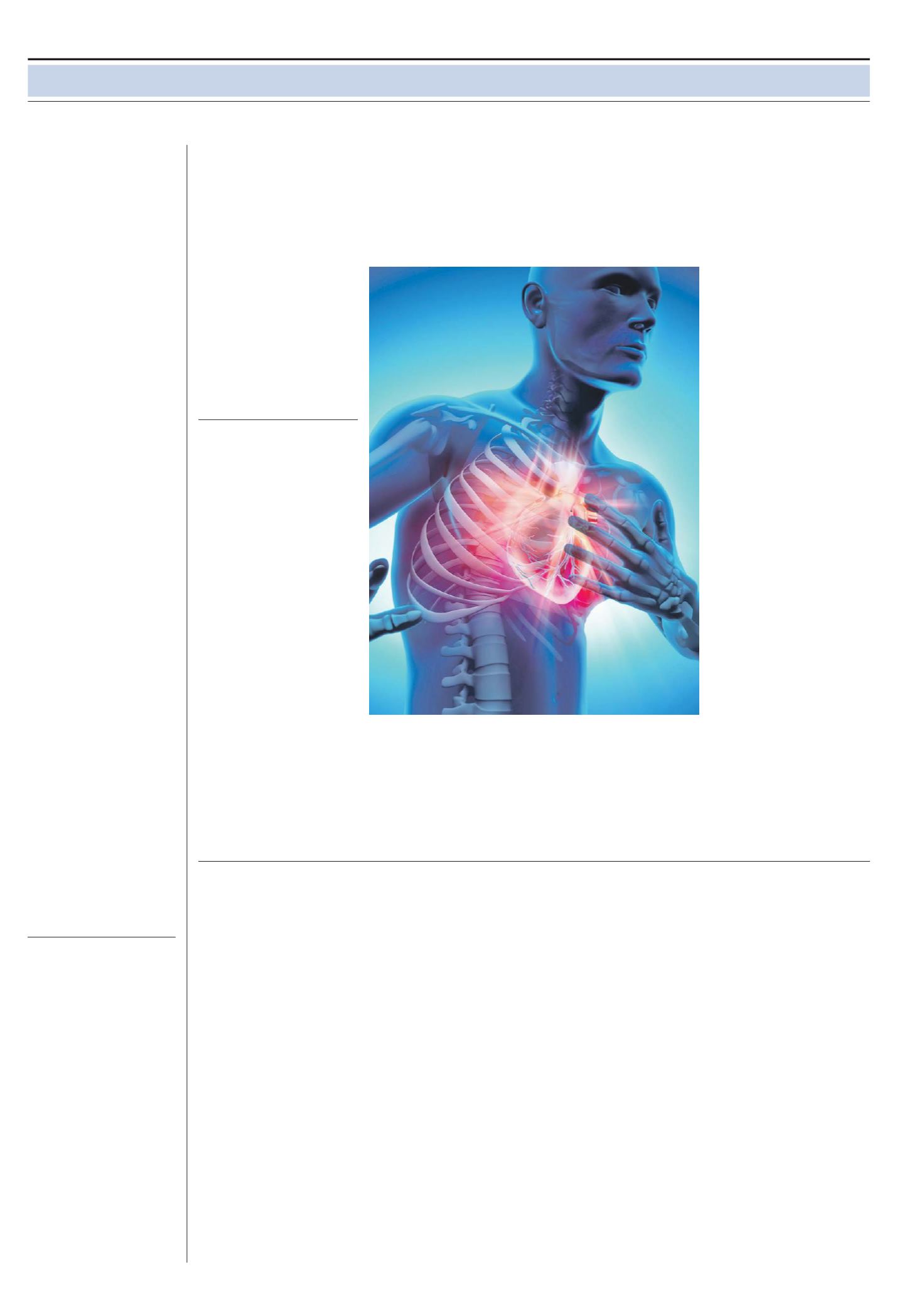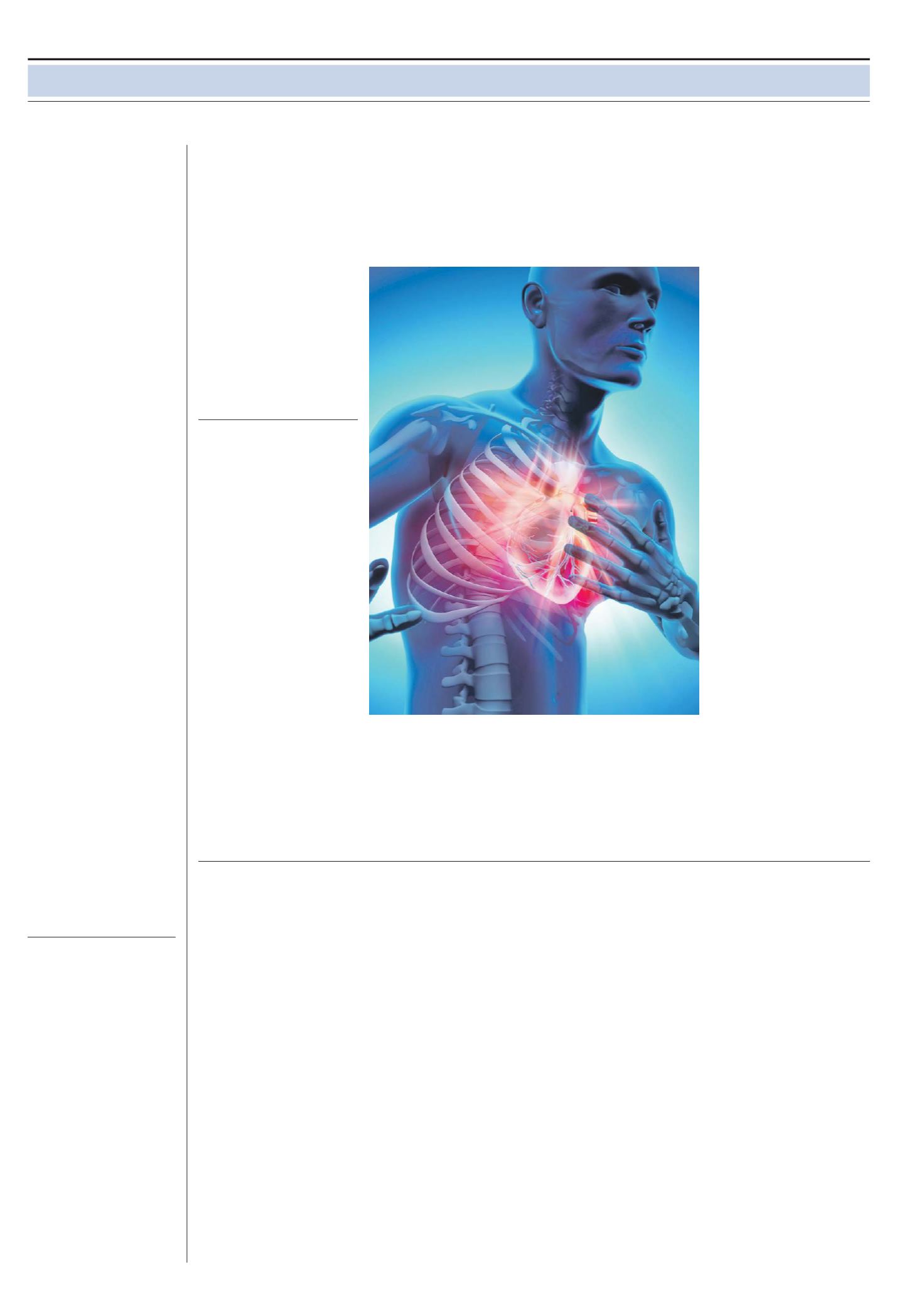
Bei resistenter Hypertonie ist der
Blutdruck trotz Kombitherapie mit
drei Antihypertensiva (meist ACE
Hemmer, Kalziumantagonist plus
Diuretikum) nicht in den Griff zu
bekommen. Ein Team um Professor
Bryan Williams aus London hat
versucht, bei solchen Patienten
trotzdem mit Medikamenten den
Blutdruck zu senken. Die Hoffnung
der Forscher richtete sich auf den
Aldosteronblocker Spironolacton.
Ergebnisse ihrer randomisierten
placebokontrollierten PATHWAY
2Studie haben sie beim ESCKon
gress in London vorgestellt.
Teilnehmer der Studie waren
335 Patienten mit resistenter Hy
pertonie nach gängigen Kriterien.
Alle sollten vier jeweils zwölfwöchi
ge Behandlungszyklen durchlaufen:
mit Spironolacton, dem Alphablo
cker Doxazosin, dem Betablocker
Bisoprolol und Placebo. Basis für
den Vergleich der Wirksamkeit wa
ren die bei der häuslichen Selbst
messung festgestellten systolischen
Blutdruckwerte der Teilnehmer.
Die Forscher verglichen zu
nächst Spironolacton mit Placebo
und belegten so die grundsätzliche
Wirksamkeit von Spironolacton bei
resistenter Hypertonie: Der sys
tolische Blutdruck nahm darunter
signifikant um im Mittel 8,7 mmHg
stärker ab als unter Placebo.
Die separaten Vergleiche mit
Doxazosin und Bisoprolol bestätig
ten die Überlegenheit von Spirono
lacton, das den Blutdruck jeweils
etwa doppelt so stark senkte wie Al
phablocker und Betablocker (4,03
mmg vs Doxazosin, 4,48 mmHg vs
Bisoprolol). Diese Überlegenheit
spiegelte sich auch im Anteil der
Hypertoniker wider, deren systoli
sche Blutdruckwerte am Ende im
angestrebten Zielbereich lagen (un
ter 135 mmHg). Unter Spironolac
ton betrug die Rate 57,8 Prozent,
im Vergleich zu 41,7 Prozent (Do
xazosin), 43,6 Prozent (Bisoprolol)
und 24,4 Prozent (Placebo).
(ob)
Option bei
resistenter
Hypertonie
Bei therapierefraktären
Hypertonikern konnte mit
Spironolacton der
Blutdruck unter Kontrolle
gebracht werden.
SPIRONOLACTON
Trotz nachgewiesenen Nutzens ei
ner i.v.Eisentherapie bei Herzinsuf
fizienz (HI) erhält in Deutschland
nur jeder zehnte HIPatient mit Ei
senmangel eine Substitutionsthera
pie. Dabei bekommen die meisten
Patienten die weniger wirksamen
Eisenpräparate zum Einnehmen,
nur 2,2 Prozent eine i.v.Therapie.
Das zeigen Auswertungen des
RAIDHFRegister, teilt die Deut
sche Gesellschaft für Kardiologie
zum ESCKongress mit. Unter
sucht wurden 671 HIPatienten.
Bei 56 Prozent der Patienten wurde
ein Eisenmangel nachgewiesen, und
38,5 Prozent von diesen hatten
auch eine Anämie, hingegen nur 25
Prozent der Patienten ohne Eisen
mangel.
(eb)
Eisenmangel
bleibt meist
unbehandelt
HERZINSUFFIZIENZ
Bisher empfahlen die kardiologischen
Leitlinien für den NichtSTHebungs
infarkt (NSTEMI) in Europa, bei Pa
tienten mit akutem Brustschmerz di
rekt bei Aufnahme und noch einmal
drei Stunden später Troponin zu be
stimmen. So werden heute in den
meisten Kliniken jene Patienten iden
tifiziert, bei denen wahrscheinlich ein
NSTEMI vorliegt und eine Katheter
untersuchung daher nötig ist.
Anders war das in der BACC (Bio
markers in Acute Cardiovascular
Care)Studie, die Privatdozent Dirk
Westermann vom Uniklinikum Ham
burgEppendorf beim Europäischen
Kardiologenkongress präsentiert hat.
Die Kardiologen verglichen bei 1045
Patienten mit akuten Brustschmerzen
das gängige Vorgehen, bei dem hoch
sensitives Troponin T (hsTNT) sofort
und nach drei Stunden gemessen wird,
mit einer Messung des hoch sensitiven
Troponin I (hsTNI) sofort und nach
nur einer Stunde.
Grenzwert von 6 ng / l
Dabei wurde für eine optimale Sensiti
vität bei der Ausschlussdiagnostik
(ruleout) für beide Messungen ein
sehr niedriger Grenzwert von 6 ng/l
gewählt. Auf Basis dieses Grenzwerts
hätten nach einer Stunde knapp 40
Prozent der Patienten entlassen wer
den können. Dabei berechneten die
Hamburger Kardiologen einen nega
tivprädiktiven Wert von 99,7 Prozent
(Sensitivität 99,1 Prozent) für den
NSTEMI Typ 1. Das heißt: Maximal
einer von 100 Patienten wird entlas
sen, obwohl ein NSTEMI vorliegt.
Das war nicht schlechter als beim 3
StundenAlgorithmus auf Basis des
hsTNT. Die hsTNIDaten seien an
zwei weiteren, unabhängigen Kohor
ten validiert worden, so Westermann,
nämlich an den Teilnehmern der Stu
dien APACE und ADAPT. In diesen
Validierungskohorten lag der negativ
prädiktive Wert bei 99,2 Prozent und
99,7 Prozent. Damit könne der auf
hsTNI mit einem Grenzwert von 6
ng/l basierende EinStundenAlgorith
mus klinisch zur Ausschlussdiagnostik
eingesetzt werden.
Am Universitätsklinikum Hamburg
Eppendorf soll er jetzt eingeführt wer
den. Die Hamburger stehen damit auf
dem Boden der in London vorgestell
ten Neufassung der europäischen
NSTEMILeitlinie, die einen 1Stun
denAlgorithmus dann erlaubt, wenn
der Test angemessen dafür validiert
wurde.
Positivprädiktiver Wert: 81,5 Prozent
Etwas komplexer ist die Situation bei
der im klinischen Alltag etwas weniger
kritischen definitiven Diagnose (ru
lein). Der Hamburger Algorithmus
sah hier so aus, dass ein NSTEMI an
genommen wurde, wenn das hsTNI in
der Messung sofort nach Aufnahme
größer war als 6 ng/l und binnen einer
Stunde um mindestens 12 ng/l anstieg.
Das ergab einen positivprädiktiven
Wert für den NSTEMI von 87,1 Pro
zent (Spezifität 98,0 Prozent). In den
beiden Validierungskohorten APACE
und ADAPT lag der positivprädiktive
Wert bei 80,4 Prozent und 81,5 Pro
zent.
Auch das sei nicht schlechter als
der 3StundenAlgorithmus, so Wes
termann. So kann bereits nach einer
Stunde bei 11,9 Prozent der Patienten
ein NSTEMI diagnostiziert und eine
Katheteruntersuchung empfohlen wer
den. Übrig bleiben 46,9 Prozent der
Patienten, bei denen sich der akute In
farkt nach einer Stunde durch hsTNI
weder definitiv ausschließen noch be
stätigen lässt.
Diese Patienten gebe es in ähnlicher
Häufigkeit auch beim dreistündigen
Algorithmus, betonte der Kardiologe.
Sie können nicht entlassen werden,
sondern erhalten in der Regel die Ka
theteruntersuchung, um keinen Herz
infarkt zu übersehen. In der BACC
Kohorte war die 6MonatsMortalität
am größten bei jenen Patienten, bei
denen das Troponin keine eindeutige
Diagnose oder Ausschlussdiagnose er
laubte.
Ein neuer Algorithmus für
die Troponinbestimmung
bei Patienten mit Verdacht
auf Myokardinfarkt kann die
Notfallversorgung
beschleunigen. Er liefert
eine Ausschlussdiagnose
innerhalb einer Stunde.
InfarktVerdacht: In einer
Stunde zur Ausschlussdiagnose?
Von Philipp Grätzel von Grätz
Brustschmerz: Zum Ausschluss eines Myokardinfarkts dient der Troponintest mit hoher
Sensitivität.
© PSDESIGN1/FOTOLIA.COM
Die bei der Jahrestagung der Europäi
schen Gesellschaft für Kardiologie
vorgestellte Neuauflage der ESCLeit
linie zur infektiösen Endokarditis be
hält bei der Antibiotikaprophylaxe die
bisherigen, restriktiven Empfehlungen
bei, wie Professor Bernhard Iung, Pa
ris, betonte. Demnach sollten Hochri
sikopatienten bei Eingriffen mit höchs
tem Bakteriämierisiko eine Prophylaxe
erhalten, sonst aber niemand. Als
Hochrisikopatienten gelten Patienten
mit Klappenersatz, außerdem Patien
ten mit einer Endokarditisanamnese
sowie Patienten mit zyanotischem an
geborenem Herzfehler.
Keine Prophylaxe benötigen dage
gen Patienten mit nativen Klappener
krankungen ohne Klappenersatz. Ge
nerell wird eine Prophylaxe nur bei
zahnmedizinischen Eingriffen durch
geführt, bei denen umfangreich am
Zahnfleisch manipuliert werden muss.
Weder die Kariestherapie noch Wur
zelbehandlungen noch die Applikation
von Lokalanästhetika in nicht infizier
tes Zahnfleisch fallen in diese Katego
rie. Generell keine Prophylaxe nötig ist
auch bei Eingriffen an Atemwegen,
Verdauungstrakt und Urogenitaltrakt,
sofern sie nicht infiziertes Gewebe be
treffen.
Größere Änderungen gibt es in den
neuen Leitlinien bei den Diagnosekri
terien. Weiterhin kann eine Endokar
ditis dann definitiv diagnostiziert wer
den, wenn zwei MajorKriterien oder
ein MajorKriterium und drei Minor
Kriterien oder fünf MinorKriterien
erfüllt sind. Diese Kriterien wurden al
lerdings angepasst, wie Professor Pilar
Tornos, Barcelona, betonte. So wurde
das MajorKriterium infektiöse En
dokarditis in der Bildgebung erwei
tert. Es gilt jetzt auch dann als erfüllt,
wenn in der 18FFDG PET/CT oder
in der Leukozyten SPECT/CT patho
logische Aktivität im Gebiet eines (vor
mindestens drei Monaten implantier
ten) Klappenersatzes nachweisbar ist.
Als MinorKriterium gelten künftig
außerdem vaskuläre Auffälligkeiten
wie Embolien, septische Lungenin
farkte oder infektiöse Aneurysmen,
und zwar auch dann, wenn diese aus
schließlich in bildgebenden Untersu
chungen, insbesondere in der Tho
raxCT, nachweisbar sind.
Ziel der neuen Kriterien sei es vor
allem, die Zahl der Patienten, bei de
nen auf Basis des bisherigen Kriterien
katalogs nur eine mögliche Endokar
ditis diagnostizierbar war, zu verrin
gern. Tornos konnte in einer eigenen,
im Fachblatt Circulation vorab ver
öffentlichten Untersuchung zeigen,
dass durch die 18FFDG PET/CT 45
von 50 Patienten mit möglicher En
dokarditis reklassifiziert werden
konnten. Bei 22 wurde die definitive
Diagnose gestellt, bei 23 wurde die
Diagnose ausgeschlossen und nur bei
5 blieb sie unklar.
Kleinere Änderungen gab es in der
neuen Leitlinie auch bei der Therapie
von Patienten mit infektiöser Endokar
ditis. So sollte ein multidisziplinäres
Team bei der Behandlung Standard
sein. Neu ist außerdem ein geänderter
Antibiotikaalgorithmus bei der Sta
phylokokkenEndokarditis.
(gvg)
Bei der infektiösen Endo
karditis hat die ESC die
Diagnosekriterien angepasst
und berücksichtigt jetzt
auch CT und Nuklear
medizin. Die Antibiotika
prophylaxe bleibt in engen
Grenzen erhalten.
Endokarditis: Bildgebung wird wichtiger
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
45
von 50 Patienten
mit möglicher
Endokarditis konnten durch die
18FFDG PET/CT reklassifiziert
werden: Bei 22 wurde die definitive
Diagnose gestellt, bei 23 wurde die
Diagnose ausgeschlossen und nur
bei 5 blieb sie unklar.
12
Oktober 2015
BDI aktuell
Medizin