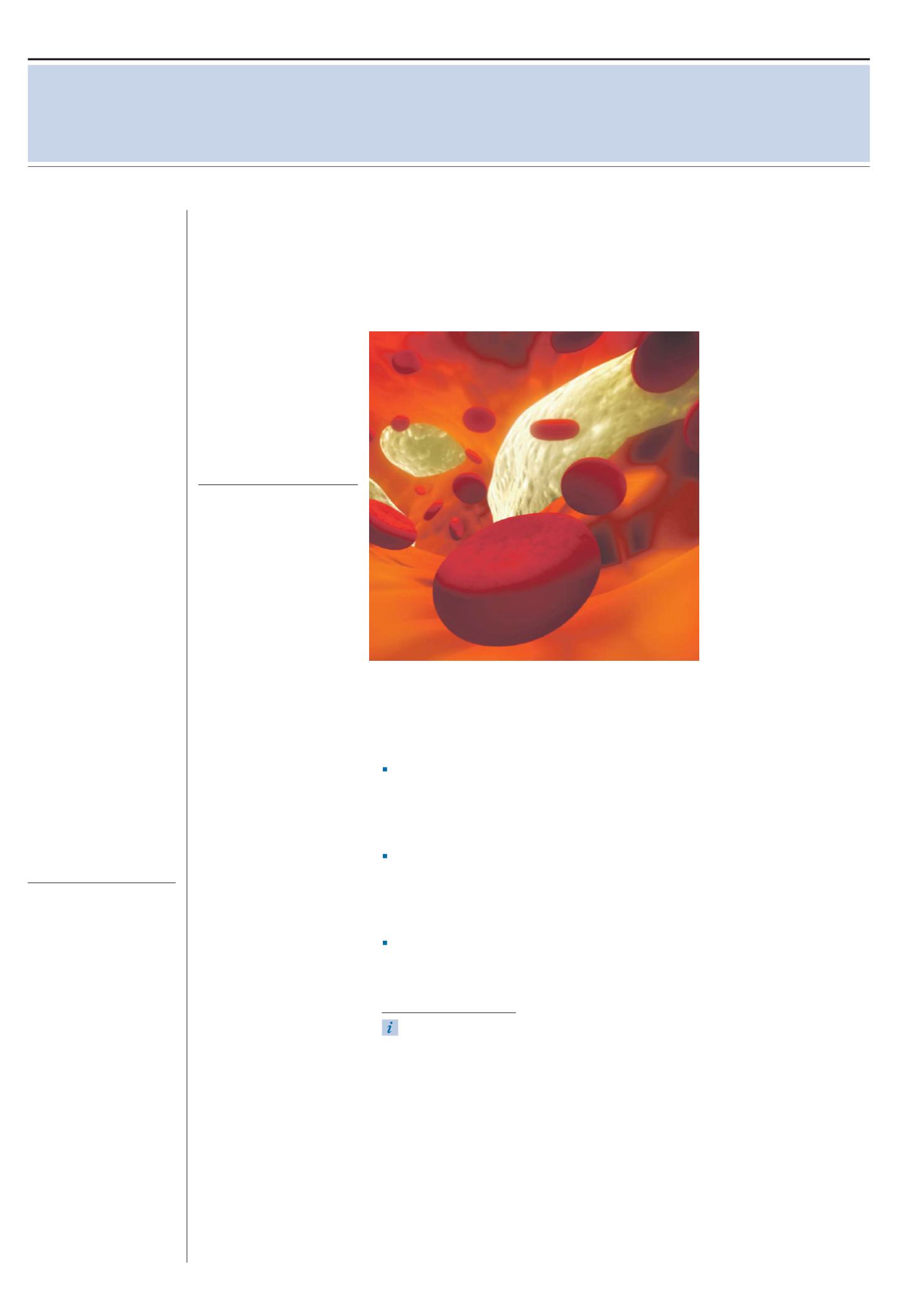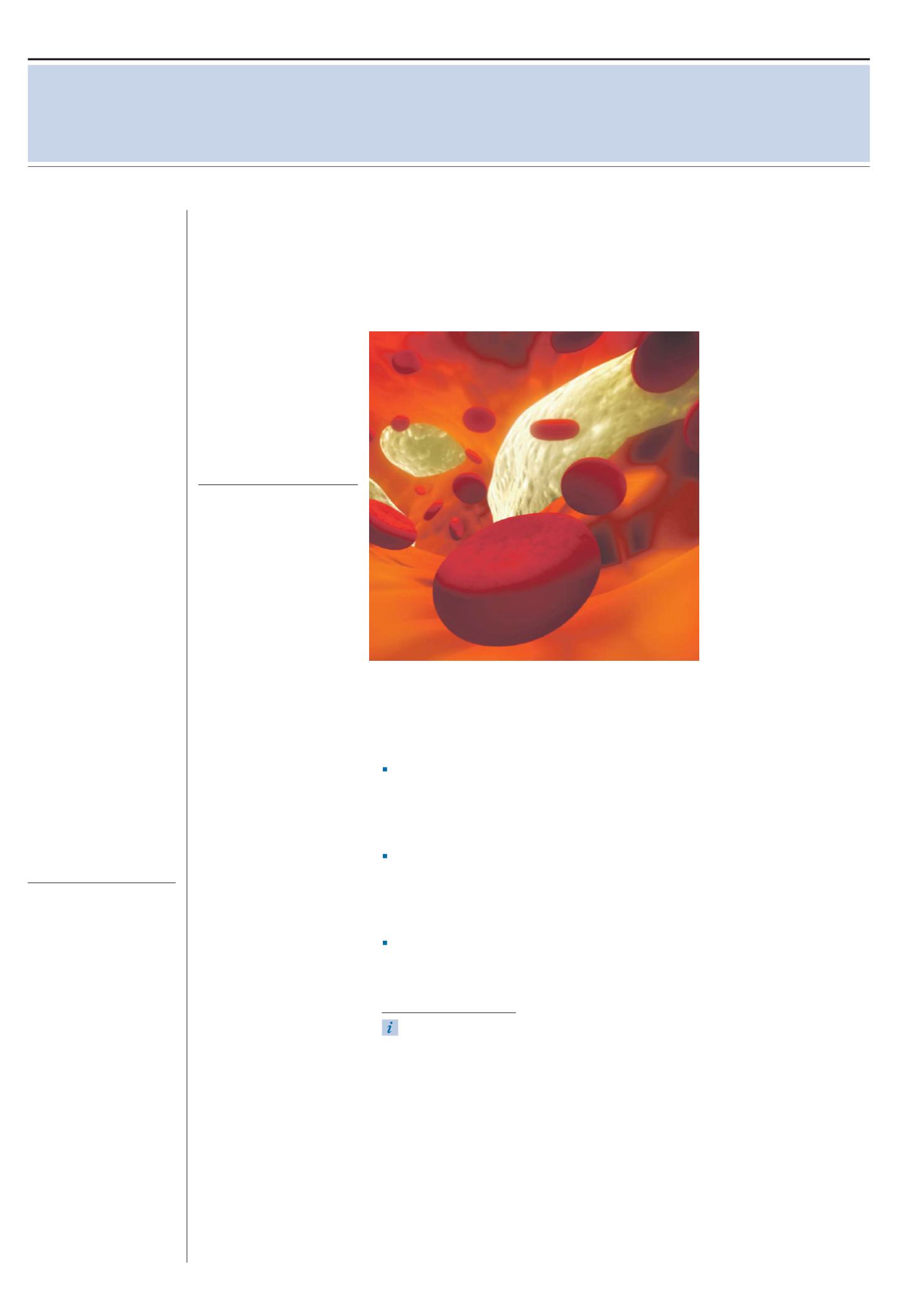
Antidepressiva blockieren die Wie
deraufnahme von Serotonin auch in
die Thrombozyten und können so
Blutungskomplikationen Vorschub
leisten. Das gilt vor allem, wenn ein
Patient weitere Medikamente ein
nimmt, die die Plättchenfunktion
beeinträchtigen. So ist einer Meta
analyse zufolge die Wahrscheinlich
keit für gastrointestinale Blutungen
nochmals höher, wenn SSRI zu
sammen mit NSAR eingenommen
werden. Die Kombi aus Antide
pressiva und NSAR könnte auch
die Entstehung von Hirnblutungen
fördern. Einer retrospektiven Studie
aus Südkorea zufolge haben Patien
ten mit der KoTherapie ein um 60
Prozent höheres 30TagesRisiko
als Patienten unter Monotherapie
mit einem Antidepressivum (BMJ
2015; 351: h3517).
Für die Untersuchung wurden
Versicherungsdaten von Patienten
herangezogen, die zwischen 2010
und 2013 erstmals ein Antidepres
sivum erhalten hatten. Jedem Pati
enten, der zusätzlich NSAR anwen
dete, wurde jeweils ein Patient ohne
NSARTherapie gegenübergestellt.
Versicherte mit bekannten zerebro
vaskulären Erkrankungen waren
ausgeschlossen. Die Gesamtkohorte
umfasste 4,15 Millionen Patienten.
Unter Berücksichtigung von Un
terschieden in der Einnahme weite
rer blutungsfördernder Medika
mente ergab sich ein Anstieg der
Hirnblutungsrate um 60 Prozent
innerhalb von 30 Tagen nach Be
ginn der antidepressiven Therapie.
Die Steigerung ließ sich nicht auf
eine bestimmte Substanzklasse zu
rückführen.
(bs)
Vorsicht bei
Antidepressiva
plus NSAR
Die KoTherapie mit
NSAR und Antidepressiva
könnte auch Hirnblutun
gen fördern.
ERHÖHTE BLUTUNGSGEFAHR!
10
BDI aktuell
Oktober 2015
Medizin
Mit der neuen S3Leitlinie Sekun
därprophylaxe ischämischer Schlag
anfall und transitorische ischämische
Attacke erhalten Ärzte auf 25 ent
scheidende Fragen klare Antworten
und, wenn sie wollen, in der 60
seitigen Langfassung auch detaillierte
Erläuterungen, wie die beteiligten
medizinischen Fachgesellschaften, Be
rufsverbände und anderen Organisati
onen zu ihren Empfehlungen kamen.
Veröffentlicht wurde bisher nur der
erste Teil der Leitlinie zur Sekundär
prophylaxe ischämischer Schlaganfälle
und transitorischer ischämischer Atta
cken: Die Therapie mit Thrombozy
tenfunktionshemmern, die orale Anti
koagulation bei Vorhofflimmern sowie
die Behandlung bei Hyperlipidämie
und Hypertonie. Der zweite Teil der
S3Leitlinie zu Maßnahmen wie
Lebensstiländerungen befindet sich
derzeit noch in der Entwicklung.
Die wichtigsten Empfehlungen der
LeitlinienAutoren auf einen Blick:
Thrombozytenfunktionshemmer:
Grundsätzlich sollen alle Patienten mit
ischämischem Schlaganfall oder tran
sitorischer ischämischer Attacke (TIA)
einen Thrombozytenfunktionshemmer
(TFH) erhalten, sofern keine Indikati
on für eine orale Antikoagulation vor
liegt. Bei der Medikation können sich
Ärzte zwischen ASS allein, ASS in
Kombination mit Dipyridamol sowie
einer Therapie mit Clopidogrel ent
scheiden. Die Leitlinienexperten sehen
zwischen diesen Optionen aufgrund
der Studienlage keine klaren Unter
schiede bei der Prävention kardiovas
kulärer Ereignisse. Vielmehr betrach
ten sie ASS plus Dipyridamol sowie
Clopidogrel als Alternativen zu einer
ASSMonotherapie. Zwar hatten die
beiden Alternativen in Studien zum
Teil besser abgeschnitten als eine
ASSMonotherapie, allerdings waren
die Unterschiede meist recht gering,
zudem wurden oft sehr niedrige ASS
Dosen verwendet.
Auch die Kombination von ASS
plus Clopidogrel ist nach Ansicht der
Leitlinienexperten einer ASSMono
therapie nicht überlegen. Wenn, dann
sollten Ärzte diese Kombination nicht
langfristig zur Schlaganfallprophylaxe
verwenden, es sei denn, es bestehen
zusätzliche Indikationen wie ein akutes
Koronarsyndrom oder eine koronare
Stentimplantation.
Auch bei der Dosierung gibt es kla
re Empfehlungen: Patienten mit einer
ASSMonotherapie sollten 100 mg/d
bekommen, für ASS plus Dipyridamol
wird eine Dosierung von 25/200 mg
und für Clopidogrel eine Dosierung
von 75 mg genannt. Die Behandlung
sollte möglichst innerhalb von 48
Stunden nach dem Schlaganfall oder
der TIA begonnen werden, Studien
hatten ein um etwa 30 Prozent redu
ziertes Risiko für Tod und Behinde
rungen bei einer frühen TFHThera
pie ergeben – trotz eines etwas erhöh
ten Blutungsrisikos.
Ein Problem sind möglicherweise
Patienten mit gastrointestinalen Risi
ken: Bei abgeheilten Magengeschwü
ren können Ärzte die TFHTherapie
mit einem Protonenpumpenhemmer
begleiten.
Kommt es trotz Sekundärprophyla
xe mit Thrombozytenfunktionshem
mern zu erneuten zerebrovaskulären
Ereignissen, ist dennoch keine Dosi
seskalation nötig. Auch für einen
TFHFunktionstest sieht die Leitlinie
dann keinen Anlass. Es lägen nicht ge
nügend Daten vor, die einen solchen
Test rechtfertigten, heißt es.
Einmal begonnen, soll die TFH
Therapie dauerhaft erfolgen, es sei
denn, dass Kontraindikationen auftre
ten oder im Verlauf sich eine Indikati
on zur Antikoagulation ergibt (A
Empfehlung).
Hyperlipidämie:
Grundsätzlich wird allen Patienten mit
TIA oder ischämischem Schlaganfall
unabhängig vom Subtyp ein Statin
empfohlen. Anzustreben sind dabei
LDLWerte unter 100 mg/dl (2,6
mmol/l). Eine Ausnahme sind Patien
ten mit Hirnblutungen: Wegen des er
höhten Blutungsrisikos unter Statinen
in einigen Studien wird Ärzten hier ei
ne gründliche NutzenRisikoAbwä
gung empfohlen. Möglichst sollten der
Hirninfarkt oder die TIA bei solchen
Patienten nicht die einzige Indikation
für die Statintherapie sein. Die Leitli
nie rät ebenfalls zu einer dauerhaften
Therapie, notfalls auch per Magenson
de.
Gegenüber anderen Medikamenten
äußern sich die Leitlinienexperten kri
tisch: Nikotinsäurederivate, Fibrate
oder Ezetimibe sollen bei Patienten
nach ischämischem Schlaganfall oder
TIA zur Sekundärprophylaxe nicht
routinemäßig eingesetzt werden. Für
die Wirksamkeit solcher Therapien al
leine oder in Kombination mit einem
Statin sei die Evidenz nicht ausrei
chend.
Vorhofflimmern:
Generell wird bei Vorhofflimmern
(VHF) nach einem zerebralen ischä
mischen Ereignis eine orale Antiko
agulation empfohlen – auch bei älteren
Patienten. Höheres Lebensalter sei per
se keine Kontraindikation. Thrombo
zytenfunktionshemmer sollten bei
VHFPatienten jedoch nicht mehr ver
wendet werden, es sei denn, es liegen
noch kardiologische Indikationen da
für vor. Ähnliches gilt auch für Anti
arrhythmika.
Bei der Wahl der Medikation über
lässt es die Leitlinie den Ärzten, ob sie
lieber auf die neuen direkten oralen
Antikoagulanzien (DOAK) oder auf
die bewährten VitaminKAntagonis
ten (VKA) setzen, die Autoren tendie
ren aber vorsichtig zu den DOAK:
Diese sollten aufgrund des günstige
ren NutzenRisikoProfils zur Anwen
dung kommen. So wird festgestellt,
dass damit bei Patienten mit nicht val
vulärem Vorhofflimmern unter den
drei erhältlichen DOAK Rivaroxaban,
Dabigatran und Apixaban weniger le
bensbedrohliche oder fatale sowie we
niger intrakranielle Blutungen auftre
ten als mit VKA – bei ähnlich guter
antiembolischer Wirksamkeit.
Gefordert wird jedoch eine Über
prüfung der Nierenfunktion mindes
tens einmal pro Jahr. Eine Kreatinin
Clearance unter 30 ml/min stellt eine
Kontraindikation für Dabigatran dar,
unter 15 ml/min darf auch nicht mit
Apixaban oder Rivaroxaban behandelt
werden. Bei Patienten über 75 Jahren
und bei Patienten mit eingeschränkter
Nierenfunktion muss zudem die Do
sierung nach Herstellerangaben ange
passt werden. Dies ist auch der Fall,
wenn eine Verschlechterung der Nie
renfunktion zu erwarten ist, etwa bei
Hypovolämie oder Dehydrierung.
In einem Fall spricht sich die Leitli
nie für ein bestimmtes DOAK aus:
falls Patienten für eine VKATherapie
nicht infrage kommen und daher bis
lang mit TFH behandelt wurden. Sie
sollen nun eine Therapie mit Apixa
ban erhalten. Grundlage der Empfeh
lung ist eine Studie, in der bei solchen
Patienten die ApixabanTherapie einer
TFHBehandlung deutlich überlegen
war. Alternativ zu Apixaban können in
dieser Konstellation jedoch auch die
beiden anderen DOAK verordnet wer
den.
Hypertonie:
Für hypertone Schlaganfall und
TIAPatienten wird eine langfristige
antihypertensive Therapie mit systoli
schen Zielwerten zwischen 120 und
140 mmHg empfohlen. Auf jeden Fall
sollten die Werte nicht darüber liegen,
sie sollten aber auch nicht medika
mentös unterhalb dieses Korridors ge
drückt werden. Liegt zusätzlich ein Di
abetes vor, müssen Ärzte auch die
diastolischen Werte im Blick haben.
Hier liegt der Zielkorridor zwischen 70
und 90 mmHg. Studien haben erge
ben, dass nicht nur erhöhte Blutdruck
werte das Rezidivrisiko erhöhen, es
traten auch vermehrt neue Schlagan
fälle bei einer Blutdrucksenkung un
terhalb der genannten Zielwerte auf.
Schlaganfall: S3Leitlinie zur
Sekundärprophylaxe
Von Thomas Müller
Neurologen und Schlag
anfallexperten haben den
ersten Teil einer neuen
S3Leitlinie vorgestellt. 25
Schlüsselfragen mit konkreten
Antworten sollen Ärzten die
SchlaganfallSekundär
prävention erleichtern.
Gestörte Durchblutung: Die S3Leitlinie zur SchlaganfallSekundärprophylaxe gibt auf
25 entscheidende Fragen klare Antworten.
© NATALIA LUKIYANOVA / ISTOCK / THINKSTOCK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Das empfehlen die
Leitlinienexperten
Einen Thrombozytenfunktions
hemmer
sollen grundsätzlich
alle Patienten mit ischämischem
Schlaganfall oder transitorischer
ischämischer Attacke erhalten,
sofern keine Indikation für eine
orale Antikoagulation vorliegt.
Bei Vorhofflimmern
nach einem
zerebralen ischämischen Ereig
nis wird generell eine orale Anti
koagulation empfohlen auch
bei älteren Patienten. Höheres
Lebensalter sei per se keine
Kontraindikation.
Für hypertone Schlaganfall und
TIAPatienten
wird eine langfris
tige antihypertensive Therapie
mit systolischen Zielwerten
zwischen 120 und 140 mmHg
empfohlen.
Die S3Leitlinie Sekundärprophy
laxe ischämischer Schlaganfall
und transitorische ischämische
Attacke Teil 1 ist im Internet
einsehbar auf:
/
leitlinien/inhaltenachkapiteln
Studienergebnisse belegen, dass
Migräne und Schlaganfall einen
zentralen Mechanismus gemeinsam
haben: Enorme elektrochemische
Wellen, die über weite Teile des
Hirngewebes wandern (Neuron
2015; 86: 902922). Insgesamt
seien die Wellen bereits bei mehre
ren hundert Patienten nachgewie
sen worden, heißt es in einer Mit
teilung der Charité Berlin. Mittler
weile wurde die Riesenwelle bei ei
ner ganzen Reihe von Erkrankun
gen des Gehirns identifiziert. Im
Unterschied zu Migränepatienten
kann sie bei anderen Erkrankungen
ein Signal an die Hirngefäße sen
den, sich extrem zu verengen. Dann
steigt der Blutfluss nicht an, son
dern versiegt. Auf diese Weise pro
voziert die Riesenwelle den massen
haften Untergang von Hirngewe
be, wird Professor Jens Dreier vom
Centrum für Schlaganfallforschung
der Charité zitiert.
(eb)
Migräne und
Apoplex haben
Gemeinsamkeit
FORSCHUNG