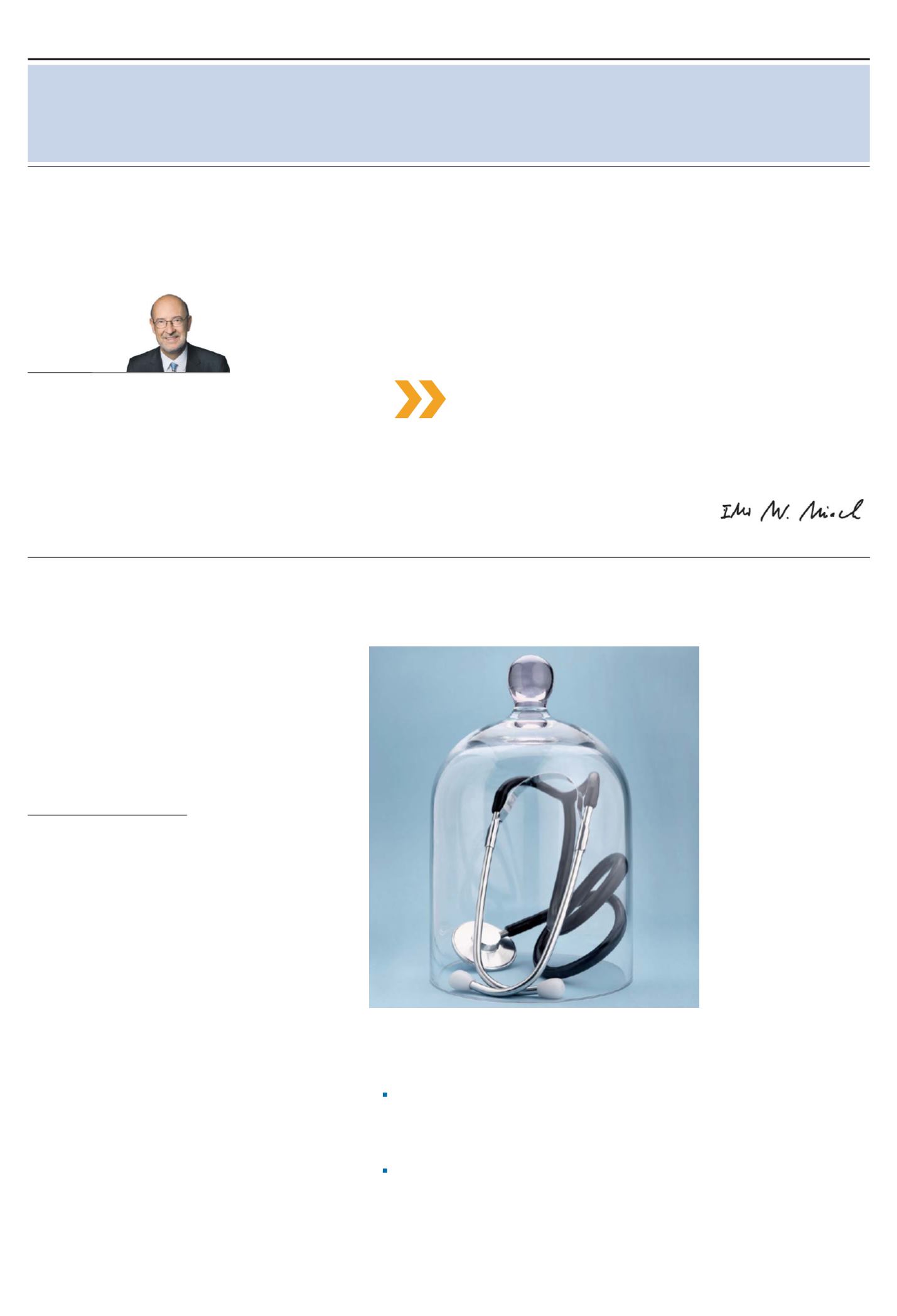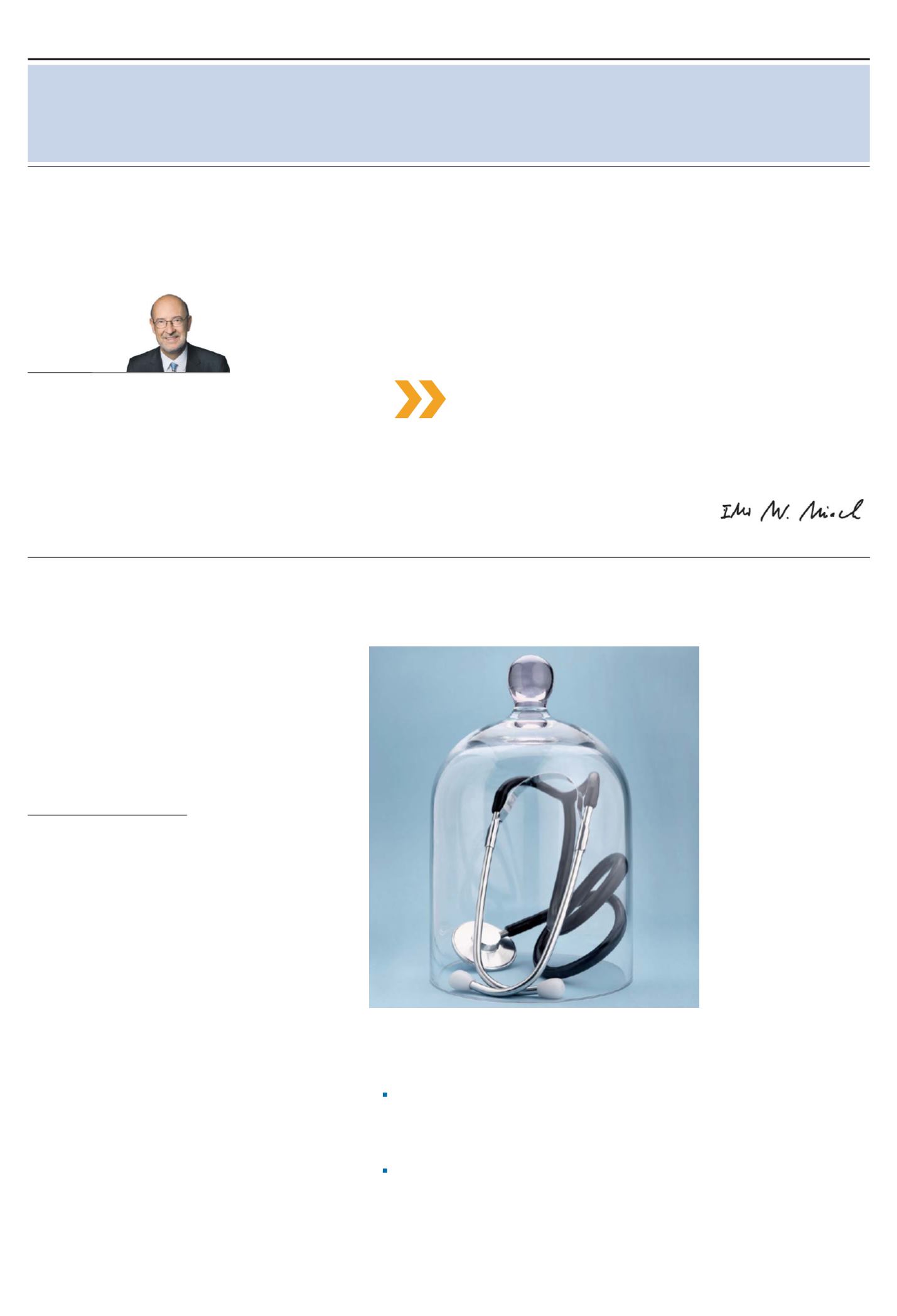
2
BDI aktuell
Oktober 2015
Berufspolitik
pps erobern den Gesundheitsmarkt. Sie do
kumentieren die tägliche Kalorienzufuhr,
zählen die gelaufenen Schritte und geben
Tipps für gesunde Ernährung. Mit FitnessArm
bändern und Smartwatches lassen sich Körper
funktionen so exakt messen wie nie zuvor. Diese
Daten gehen dann weiter an große Onlinekonzer
ne oder die Anbieter einzelner FitnessApps. Der
neueste Clou ist die AppleWatch. Sie ist nicht nur
schick und teuer, sondern soll sich auch um Fit
ness und Gesundheit ihrer Käufer kümmern.
Die Menschen gehen sehr sorglos mit ihren
Gesundheitsdaten um. Jeder Dritte würde per
A
sönliche Gesundheits und Fitnessdaten an seine
Krankenversicherung weiterleiten, wenn es für
die mit SmartphoneApps, FitnessTrackern
oder anderen Messgeräten gesammelten Infor
mationen im Gegenzug Vorteile gibt. Das ist das
Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfra
ge der Marktforschungsfirma
YouGov aus Dezember 2014.
Eine AOK spendiert jetzt so
gar 50 Euro für den Kauf einer
Apple Watch. Das erinnert an
Zeiten, als die Krankenkassen
im Wettbewerb untereinander
mit Schiffsreisen und Urlaubs
zielen um Mitglieder buhlten.
Jetzt also mit der AppleWatch.
Die Verbraucherzentralen
warnen zu Recht vor einem sorglosen Umgang
mit persönlichen Daten bei digitalen Gesund
heitsangeboten. Der Chef des Verbraucherzent
ralenBundesverbands, Klaus Müller, sieht in
diesen neuartigen Modellen, die bei gesundem
Lebenswandel geringere Tarife in Aussicht stell
ten, eine Abkehr von der solidarischen Versiche
rung.
Big Brother is watching you: In der Versiche
rungsbranche gibt es Überlegungen, die Fitness
daten von Versicherten zu sammeln und einen
gesunden Lebensstil zu belohnen. Angeblich pla
nen die ersten Versicherungen bereits Beitragsra
batte für Nutzer, die ihnen laufend Fitness und
Gesundheitsdaten übermitteln. Die AppDaten
können mit Angaben in sozialen Netzwerken
oder mit den Daten von Kundenkarten zusam
mengeführt werden, um Profile zu erstellen.
Transparenz à la Google ist nicht das, was wir
Ärzte uns zum Nutzen unserer Patienten wün
schen. Der Datenkonzern ist momentan dabei,
durch eine Neukonstruktion des Unternehmens
seine Krakenarme noch weiter auszustrecken,
um mehr Marktmacht zu erhalten. Mich er
schreckt, dass die Öffentlichkeit bislang so sorg
los mit diesen Risiken umgeht.
Telemedizin mit ihren sinnvollen und nützli
chen Möglichkeiten, die bei uns erst am Anfang
stehen, das TeleMonitoring in ärztlich unterver
sorgten Regionen und alle anderen wichtigen Te
leFunktionen dürfen nicht in die Hände von ge
winnorientierten Unternehmen gelangen. Hier
muss der Gesetzgeber im eHealthGesetz Schran
ken setzen. Eine App kann einen Arztbesuch nicht
ersetzen. Jeder Patient braucht eine individuelle
Behandlung. Und das geht am besten im persönli
chen Gespräch mit dem behandelnden Arzt, meint
Ihr Wolfgang Wesiack
Die App: Big Brother oder Gesundheitshelfer?
EDITORIAL
Von Dr. Wolfgang Wesiack
Präsident des BDI
Das erinnert an Zeiten, als die
Krankenkassen im Wettbewerb
untereinander mit Schiffsreisen
und Urlaubszielen um Mitglieder
buhlten.
Wenn es um freiberufliche Tätigkeit
geht, werden zuerst Ärzte und Rechts
anwälte genannt. Dabei ist das Spek
trum deutlich weiter gefasst und betrifft
nicht nur die freien Heilberufe, sondern
etwa auch Tierärzte und Apotheker ge
nauso wie Steuerberater und Wirt
schaftsprüfer. Der Europäische Ge
richtshof hat in einem Urteil vom
11.01.2001 die freien Berufe charakteri
siert: Freie Berufe sind Tätigkeiten, die
ausgesprochen Intellektuellen Charakter
haben, eine Qualifikation verlangen und
gewöhnlich einer genauen und strengen
berufsständischen Regelung unterlie
gen. Bei der Ausübung einer solchen
Tätigkeit hat das persönliche Element
besondere Bedeutung, und diese Aus
übung setzt auf jeden Fall eine große
Selbstständigkeit bei der Vornahme der
beruflichen Handlung voraus.
Selbstständigkeit nicht zwingend
Soweit der Europäische Gerichtshof.
Freiberuflichkeit ist wie viele immer
noch glauben, somit nicht an eine be
rufliche Selbstständigkeit gebunden.
Der Status spielt keine Rolle, auch ein
angestellter Arzt oder Anwalt genießt
die Rechte des freien Berufes und hat
dessen Pflichten einzuhalten.
Bleiben wir beim Arzt und seiner
Tätigkeit. Das ArztPatientenVerhältnis
wird geprägt durch das persönliche Ele
ment und die Sicherheit, dass dieses
Verhältnis der Schweigepflicht unter
liegt. Dazu dienen neben gesetzlichen
Regelungen auch selbst gesetzte berufs
ständische Verpflichtungen, die auch
durch Selbstverwaltungsorgane mit Be
rufsrecht hinterlegt sind. Damit ist etwa
die Ärztekammer gemeint. Sie hat auf
diesem Weg hoheitliche Aufgaben.
Der Patient kann damit davon ausge
hen, dass seine Angaben in diesem
ArztPatientenVerhältnis geheim
bleiben, selbst seinen direkten Verwand
ten gegenüber, genauso gegenüber
Behörden oder seinem Arbeitgeber. Er
kann mit seinem Arzt immer offen
reden, ohne befürchten zu müssen, vom
Staat verfolgt zu werden. Natürlich gibt
es Ausnahmeregelungen, die sehr eng
gesetzlich definiert sind.
Der Patient darf davon ausgehen,
dass sich der Arzt nur zum Wohle seines
Patienten leiten lässt und keine eigenen
oder fremden wirtschaftlichen Interes
sen im Spiel sind. Gebührenordnungen
der freien Berufe werden deshalb auch
vom Gesetzgeber erlassen, um zu ver
hindern, dass unzulässige Forderungen
das sensible Verhältnis belasten.
Der freie Beruf ist ein typisches
Merkmal eines demokratischen Staates,
der Wert darauf legt, dass seinen Bür
gern noch ein Rest Privatsphäre übrig
bleibt, auf den das Gemeinwesen keinen
Einfluss hat. Das ist insbesondere für
den Bürger bei Krankheit und Konflik
ten mit dem Gesetz von großer Bedeu
tung. Eine Demokratie muss sich also
auch daran messen lassen, wie sie freie
Berufe schützt. Nicht umsonst werden
in totalitären Regimen Ärzte und An
wälte sofort gleichgeschaltet und vom
Staat instrumentalisiert.
Wird der Gedanke des freien Berufes
auch im Alltag abgebildet? Wir leben in
einer Gesellschaft, in der Entscheidun
gen nahezu allein ökonomisch – nach
Profit oder Kostengesichtspunkten – ge
troffen werden. Das gilt gerade für un
ser Gesundheitswesen, sodass man fra
gen muss, ob unter solchen Bedingun
gen der freie Beruf überhaupt in seinen
Werten durchgehalten werden kann.
Basis der ökonomischen Steuerung
des Gesundheitswesens ist seit Gesund
heitsminister Horst Seehofer die einnah
menorientierte Ausgabenpolitik. Diese
Einnahmen sind lohnabhängig. Bei guter
Wirtschaftslage und niedriger Arbeitslo
senzahl steht mehr, bei schlechter weni
ger Geld zur Verfügung. Das damit defi
nierte Budget ergibt sich aus diesen Ein
nahmen. Dennoch fordert der Bürger zu
Recht eine umfassende Versorgung, die
den Fortschritt und eine höhere Morbi
dität einschließen lässt. Dies wird ihm
vom Politiker garantiert, in dem man et
wa eine Körperschaft wie die Kassen
ärztliche Vereinigung (KV) mit der Si
cherstellung der ambulanten Versorgung
insgesamt beauftragt. Sie erhält einen
Budgetanteil und darf das Geld an die
Ärzte verteilen, die bei ihr Zwangsmit
glied sind. Wird von den Ärzten viel an
gefordert, sinkt der Preis der einzelnen
Leistung. Die KV macht teils detaillierte
Vorgaben für Leistungen, aber auch bei
der Arzneiverordnung. Halten der ein
zelne Arzt oder die Ärzte als Fachgruppe
sich nicht daran, verfällt der Preis der
Leistung, oder es droht ein Regress.
Jeder Vertragsarzt steht somit auto
matisch unter den ökonomischen
Zwängen des Systems und muss die
Folgen seinen GKVPatienten verkau
fen. Durch diese ökonomische Steue
rung soll zwar die Finanzierbarkeit des
Systems gewährleistet werden, das
einzelne ArztPatientenVerhältnis
bleibt davon aber mit Sicherheit nicht
unbeeinflusst. Der Vertragsarzt hat
Mühe, seine Freiberuflichkeit in der
täglichen Praxis hochzuhalten.
Weniger Druck in der Klinik?
Wie geht es dem Arzt im Krankenhaus?
Er erhält ein Gehalt und kann somit
unbeeinflusst von seiner Honorierung
seine medizinischen Entscheidungen
treffen. Wirklich? Auch er steht unter
dem vermehrten ökonomischen Zwang,
der von seinem Klinikträger ausgelöst
wird. Die Krankenhäuser sind dual fi
nanziert: Die Länder sorgen für die In
vestitionen, die Kassen für die laufen
den Kosten. Da die Länder der Investi
tionsverpflichtung nur unvollständig
nachkommen, müssen Gewinne aus
den laufenden Posten generiert werden.
Dies geht nur durch Rationalisierung,
bei 60 Prozent Personalkosten über die
Zahl und durch Druck auf die Mitar
beiter. Zusätzlich muss man immer wie
der neue Leistungen einführen, bei de
nen man viel Rationalisierungspotenzial
vermutet. Noch mehr als in der Praxis
steht somit der Klinikarzt unter einem
ökonomischen Zwang.
Sollte man deshalb dem Arzt die Ent
scheidung frei geben, ohne auf wirt
schaftliche Zwänge zu achten? Hat diese
nicht auch der selbstständig tätige Arzt
als Unternehmer in seiner Praxis, die er
wirtschaftlich führen muss? Dies sind si
cher gewichtige Einwände gegen eine
rein ärztliche Steuerung des Systems.
Nur ein Arzt kann aber eine direkte per
sönliche Bindung zu seinem Patienten
aufbauen, die eine rein ökonomische Be
trachtung bei der Entscheidung über Be
handlung und Therapie kaum zulässt.
Das entscheidende Argument für
mehr ärztliche Freiberuflichkeit ist aber
das Berufsrecht, das den Patienten
schützt. Ein Verwaltungsleiter oder ein
Kassenvorstand kennt weder die persön
liche Verantwortung im Einzelfall, noch
dieses Berufsrecht. Im Interesse einer
guten Versorgungsqualität darf der Arzt
daher nicht als ökonomisch orientierter
Claqueur beim Patienten verkommen.
Ob in Praxis oder Klinik: Per
Definition gilt der Arzt als
freier Beruf. Die zunehmen
den wirtschaftlichen Zwänge
schränken den Entschei
dungsfreiraum von Ärzten
insbesondere in Diagnostik
und Therapie jedoch immer
mehr ein.
SCHWERPUNKT
Was bleibt vom freien Arztberuf?
Von Dr. HansFriedrich Spies
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Freiberufler im
Steuerrecht
Häufig wird
der freie Beruf mit
der Definition nach dem Steuer
recht (Einkommensteuergesetz)
gleichgesetzt. Das ist jedoch für
alle Bereiche außerhalb des
Steuersystems falsch.
Nach Paragraf 18 Abs.1 EStG
erzielt derjenige Einkünfte aus
selbstständiger Arbeit, der frei
beruflich tätig ist. Zu der frei
beruflichen Tätigkeit gehören die
selbstständig ausgeübte wissen
schaftliche, künstlerische ... Tä
tigkeit, die selbstständige Berufs
tätigkeit der Ärzte ...
Eingegrenzter Handlungsspielraum? Für Kassenärzte Alltag.
© POGONICI / FOTOLIA.COM