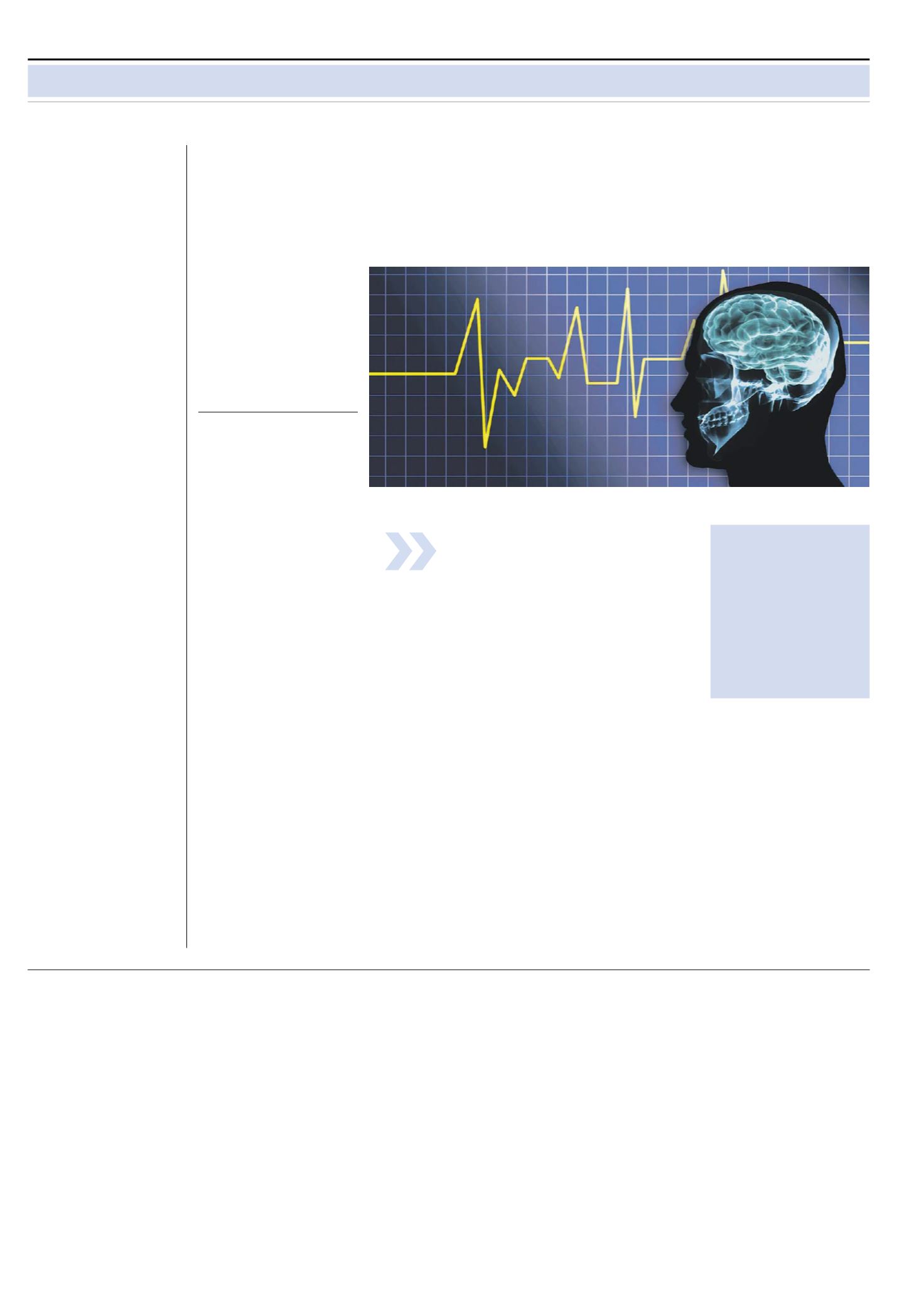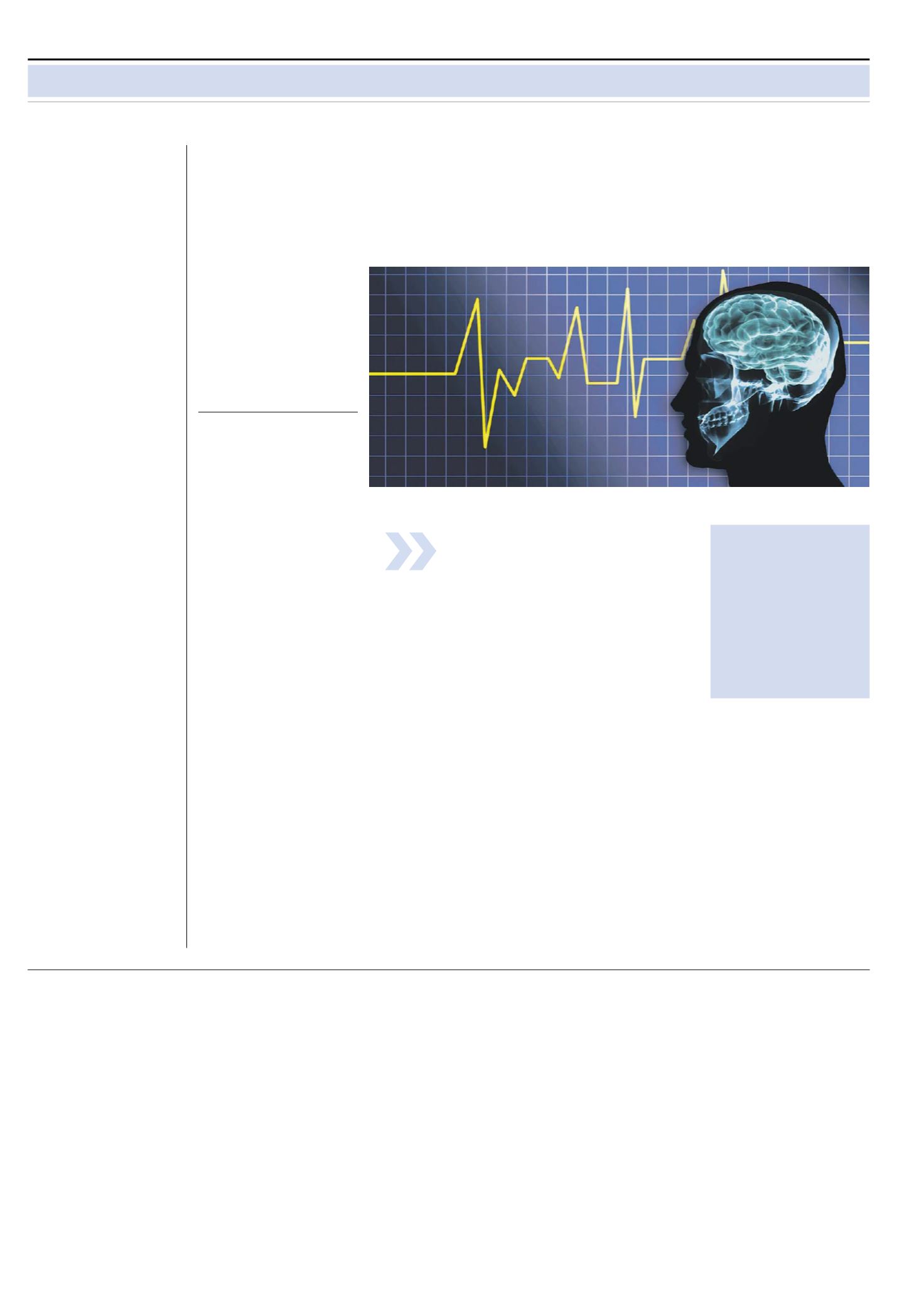
14
September 2014
BDI aktuell
Medizin
Eine 53-jährige Patientin klagt über
Druck in der Herzgegend und Herz-
stolpern bzw. kurz anhaltendes Herz-
rasen. Die Gabe eines Betablockers
führt zu keiner Besserung. Nach eini-
gen Wochen erfolgt die stationäre Auf-
nahme als Notfall bei anhaltender ven-
trikulärer Tachykardie, die mit Amio-
daron durchbrochen werden kann.
Im EKG finden sich Hinweise auf
eine Linksherzüberlastung und die
Farbdoppler-Echokardiografie zeigt ei-
ne konzentrische linksventrikuläre Hy-
pertrophie. Das Langzeit-EKG bildet
Bradykardien, zahlreiche supraventri-
kuläre und ventrikuläre Extrasystolen
mit Bigemini, Trigemini, Couplets
und rezidivierende, kurz anhaltende
ventrikuläre Tachykardien ab.
Als weiterführende Diagnostik wird
zunächst eine Koronarangiografie
durchgeführt. Sie ergibt einen unauf-
fälligen Koronarstatus. Anschließend
erfolgt eine Kernspintomografie. Hier
zeigt sich eine laterale und anteriore
Hypokinesie mit deutlichem Wandö-
dem, außerdem ein Late Enhance-
ment im Bereich der gesamten Late-
ralwand ausgehend vom Perikard auf
das Myokard übergreifend und eine
Signalanhebung des Perikards. Bei
Verdacht auf eine Systemerkrankung
wird noch eine Thorax-Computerto-
mografie durchgeführt, die keinen
krankhaften Befund ergibt. Als nächs-
tes wird der Patientin eine Myokardbi-
opsie empfohlen.
Lebensbedrohliche Erkrankung
Mehr oder weniger zufällig gibt die
Patientin an, dass sie einige Jahren
vorher wegen einer Entzündung der
Ohrspeicheldrüse mit Kortison behan-
delt worden sei. Die daraufhin ange-
forderten Befunde ergeben, dass bei
ihr damals eine Sarkoidose der Parotis
ohne Lungenbefall diagnostiziert wur-
de. Somit wird die Diagnose ohne
Myokardbiopsie gestellt: Es handelt
sich um eine Herzsarkoidose. Es wird
erneut eine Kortisontherapie begin-
nend mit 60 mg täglich mit wöchentli-
cher Dosisreduktion um 5 mg einge-
leitet, was rasch zu einer deutlichen
Besserung des klinischen Bildes führt.
Die Herzsarkoidose ist immer eine
potenziell lebensbedrohliche Erkran-
kung, die sich initial mit Dyspnoe
und/oder Herzrhythmusstörungen be-
merkbar macht. Betroffen ist vorrangig
der linke Ventrikel einschließlich des
Septums. Die Erkrankung kann zu ei-
ner linkskardialen Dekompensation
führen. Laborchemisch können Trop-
onin, Interleukin 2, ACE und BNP er-
höht sein. Meist finden sich EKG-Ver-
änderungen im Sinne einer Linksherz-
überlastung mit Linksherzschädigung
und ventrikulären Extrasystolen bis
hin zu ventrikulären Tachykardien.
Symptomatische Bradykardien bei AV-
oder SA-Block sind ebenso möglich
wie Vorhoftachykardien bis hin zum
Vorhofflimmern.
Die Echokardiografie bietet ein Bild
wie bei einer dilatativen oder hypertro-
phen Kardiomyopathie. Es können
aber auch regionale Wandbewegungs-
störungen und/oder ein Perikarderguss
nachweisbar sein. Typische Befunde
im MRT sind granulomatöse Verände-
rungen des Myokards und ein Late
Enhancement. Die am meisten ge-
fürchtete Komplikation ist der akute
Herztod. Bei anhaltend schlechter
Pumpfunktion (EF 35%) sollte des-
halb auch eine ICD-Implantation dis-
kutiert werden. Sogar eine Herztrans-
plantation kann erforderlich werden.
Bei malignen Herzrhythmusstörun-
gen und Kardiomyopathie sollte im-
mer auch an eine Herzsarkoidose ge-
dacht werden (Cardiovasc 2014/1).
Zur Sicherung der Diagnose ist eine
Myokardbiopsie erforderlich.
Ventrikuläre Tachykardien: Myokarditis – was sonst?
Ventrikuläre Tachykardien:
Echo und Kernspintomogra-
fie ergeben einen pathologi-
schen Befund. Vor einer
Myokardbiopsie löst die
Anamnese das Rätsel.
Eine als „asymptomatisch“ einge-
stufte Karotisstenose (ACS) kann
alles andere als asymptomatisch
sein, achtet man auch auf kognitive
Funktionen, so das Ergebnis einer
Studie, die auf der diesjährigen
AAN-Jahrestagung vorgestellt wur-
de. Möglicherweise müssen künftig
aggressive medikamentöse Thera-
pien und die Revaskularisierung
viel früher erwogen werden.
An der Studie nahmen 67 Perso-
nen mit ACS teil (mindestens 50-
prozentige Verengung des Karotis-
durchmessers) sowie 60 Personen,
die ebenfalls vaskuläre Risikofakto-
ren wie Diabetes, Bluthochdruck,
hohe Cholesterinspiegel und koro-
nare Herzkrankheit, aber keine
ACS aufwiesen. Die Stenosen wur-
den mittels Duplexsonografie er-
fasst und deren asymptomatischer
Status durch eine neurologische
Untersuchung sowie den NIH-
Stroke-Scale-Test festgestellt.
Die Teilnehmer unterzogen sich
umfangreichen Tests für die allge-
meine Denkfähigkeit sowie für spe-
zielle Domänen wie Verarbeitungs-
geschwindigkeit, Lernen, Gedächt-
nis, Entscheidungsfindung und
Sprache. Dabei wurden die kogniti-
ven Scores gemäß normativer Da-
ten für Alter, Geschlecht, Bildung
und Rasse angepasst. Berechnet
wurden ein Gesamtindex der kog-
nitiven Funktion sowie fünf domä-
nenspezifische Composite-Scores.
Die Gruppen wurden mit t-Tests
verglichen und Cohens d wurde be-
rechnet, um die Effektgrößen zu
bestimmen.
Die Patienten mit ACS schnitten
beim Gesamtindex der kognitiven
Funktion (t=2,8; p 0,01, d=0,52),
der Verarbeitungsgeschwindigkeit
(t=3,5, p 0,01, d=0,69) sowie Do-
mäne „Lernen/Gedächtnis“ (t=2,6,
p 0,05, d=0,48) deutlich schlech-
ter ab als die Gruppe der Patienten
mit Risikofaktoren aber ohne ACS.
Bei den Domänen „exekutive
Funktion“ sowie „Aufmerksam-
keit/Arbeitsgedächtnis“ bestand ein
Trend für eine schlechtere Leis-
tung, in der Domäne „Sprache“
unterschieden sich die beiden
Gruppen nicht signifikant.
(frg)
Wie stehts um
die kognitiven
Funktionen?
Eine als asymptomatisch
eingestufte Karotissteno-
se kann aber die Kogniti-
on negativ beeinflussen.
KAROTISSTENOSE
Nach derzeitigem Kenntnisstand ha-
ben bis zu 90 Prozent aller Thrombo-
embolien bei Vorhofflimmern ihren
Ursprung im linken Vorhofohr. Um
diese Emboliequelle auszuschalten,
können heute Verschluss-Systeme per-
kutan via Herzkatheter in das Vorho-
fohr eingebracht und dort verankert
werden.
Bisher ist erst ein System – das
WATCHMAN-Device – in einer pros-
pektiven randomisierten Studie im di-
rekten Vergleich mit dem Vitamin-K-
Antagonisten Warfarin erfolgreich auf
Wirksamkeit und Sicherheit geprüft
worden (PROTECT-AF-Studie). Stu-
dienteilnehmer konnten folglich nur
Patienten sein, bei denen es keine Be-
denken gegen eine Antikoagulation
gab.
Noch keine gleichwertige Alternative
Noch hat der interventionelle Vorhof-
ohrverschluss aber nicht den Status ei-
ner gleichberechtigten Alternative zur
Langzeit-Antikoagulation erreicht. In
der Praxis wird die Implantation eines
Verschluss-Systems primär als Option
bei Patienten genutzt, die ein hohes
Schlaganfallrisiko und Kontraindikati-
onen gegen eine orale Antikoagulation
haben. Diese Strategie hat inzwischen
auch Anerkennung in den 2012 aktua-
lisierten europäischen Leitlinien zum
Vorhofflimmern gefunden (Empfeh-
lungsgrad IIb, Evidenzlevel B).
Ein in der klinischen Praxis schon
seit längerem verwendetes System ist
der Amplatzer Cardiac Plug (ACP, St.
Jude Medical). Aufschluss über Si-
cherheit und Effektivität dieses Sys-
tems geben unter anderem neue Da-
ten aus einem Register (Iberian Regis-
try), die Dr. José Ramón López-Mín-
guez beim Kongress EuroPCR vorge-
stellt hat. In dieses Register sind an
zwölf Zentren in Spanien und Portugal
167 Patienten (Durchschnittsalter:
74,7 Jahre) mit Vorhofflimmern aufge-
nommen worden, bei denen vor allem
wegen bereits aufgetretener schwerer
Blutungen – am häufigsten waren gas-
trointestinale (30,5 Prozent) und kra-
niale Blutungen (22,8 Prozent) – eine
Antikoagulation kontraindiziert war.
Alle Patienten sollten das ACP-System
erhalten, das bei 158 Patienten (94,6
Prozent) erfolgreich implantiert wer-
den konnte. Die Rate der im Zusam-
menhang mit der Implantation aufge-
tretenen prozeduralen Komplikation
betrug 5,4 Prozent, darunter zwei kar-
diale Tamponaden (1,2 Prozent).
Die antithrombotische Therapie be-
stand aus den Thrombozytenhem-
mern Clopidogrel (über drei Monate)
und ASS (sechs bis zwölf Monate), die
Nachbeobachtung erstreckte sich über
24 Monate.
Weniger Ereignisse als erwartet
Vergleichsmaßstab für die Effizienz
der interventionellen Therapie waren
die Ereignisraten, die auf Basis vali-
dierter Scores für das Schlaganfallrisi-
ko (CHADS
2
, CHA
2
DS
2
-VASc) und
das Blutungsrisiko (HAS-BLED) im
Falle einer Nicht-Behandlung bei den
Patienten des Registers zu erwarten
waren.
Es zeigte sich, dass die innerhalb
von zwei Jahren beobachteten Ereig-
nisraten signifikant niedriger waren als
die aufgrund der Risikoscores zu er-
wartenden Raten. So lag der
CHADS
2
-Score der Patienten im
Schnitt bei 3 – was laut López-Míngu-
ez einer jährlichen Rate an Schlagan-
fällen oder transitorischen ischämi-
schen Attacken (TIA) von 9,6 Prozent
entsprochen hätte. De facto betrug
diese Rate nach ACP-Implantation
aber nur 2,4 Prozent (Cardio News
2014; 17(06):7).
Auch weniger Blutungen
Das Gleiche bei den Blutungen: Hier
hätte man auf Basis des durchschnittli-
chen HAS-BLED-Scores der Patien-
ten eine jährliche Blutungsrate von 6,6
Prozent prognostiziert – de facto lag
sie aber nur bei 3,1 Prozent. Der auf
diese Weise ermittelte Unterschied zu-
gunsten der interventionellen Therapie
war im zweiten Jahr der Beobachtung
– also nach Endothelisierung des Im-
plantats und Absetzen der plättchen-
hemmenden Therapie – besonders
ausgeprägt, betonte López-Mínguez.
Vorhofohrverschluss senkt
Schlaganfallrisiko
Nach neuen Registerdaten
verringert ein perkutaner
Vorhofohrverschluss das
Schlaganfallrisiko in ähnli-
chem Maß wie eine
Standardprophylaxe mit
Gerinnungshemmern.
Von Peter Overbeck
Vorhofflimmern ist für 15 bis 20 Prozent der ischämischen Schlaganfälle verantwortlich.
© PHOTOSANI / FOTOLIA.COM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Der Unterschied
zugunsten der
interventionellen
Therapie war im
zweiten Jahr beson-
ders ausgeprägt.
Prof. José Ramón López-Mínguez
Hospital Infanta Cristina de Badajoz
Bei Patienten mit stattgehabten
Blutungen und älteren Patienten
mit hohem Blutungsrisiko ist der
interventionelle Verschluss des
Vorhofohrs eine valide Alternati-
ve zur Schlaganfallprophylaxe
bei nichtvalvulärem Vorhofflim-
mern. Aufgrund der anatomi-
schen Komplexität und Variabili-
tät des linken Vorhofohrs sollte
der Eingriff in erfahrenen Zent-
ren erfolgen.
Vorhofohrverschluss