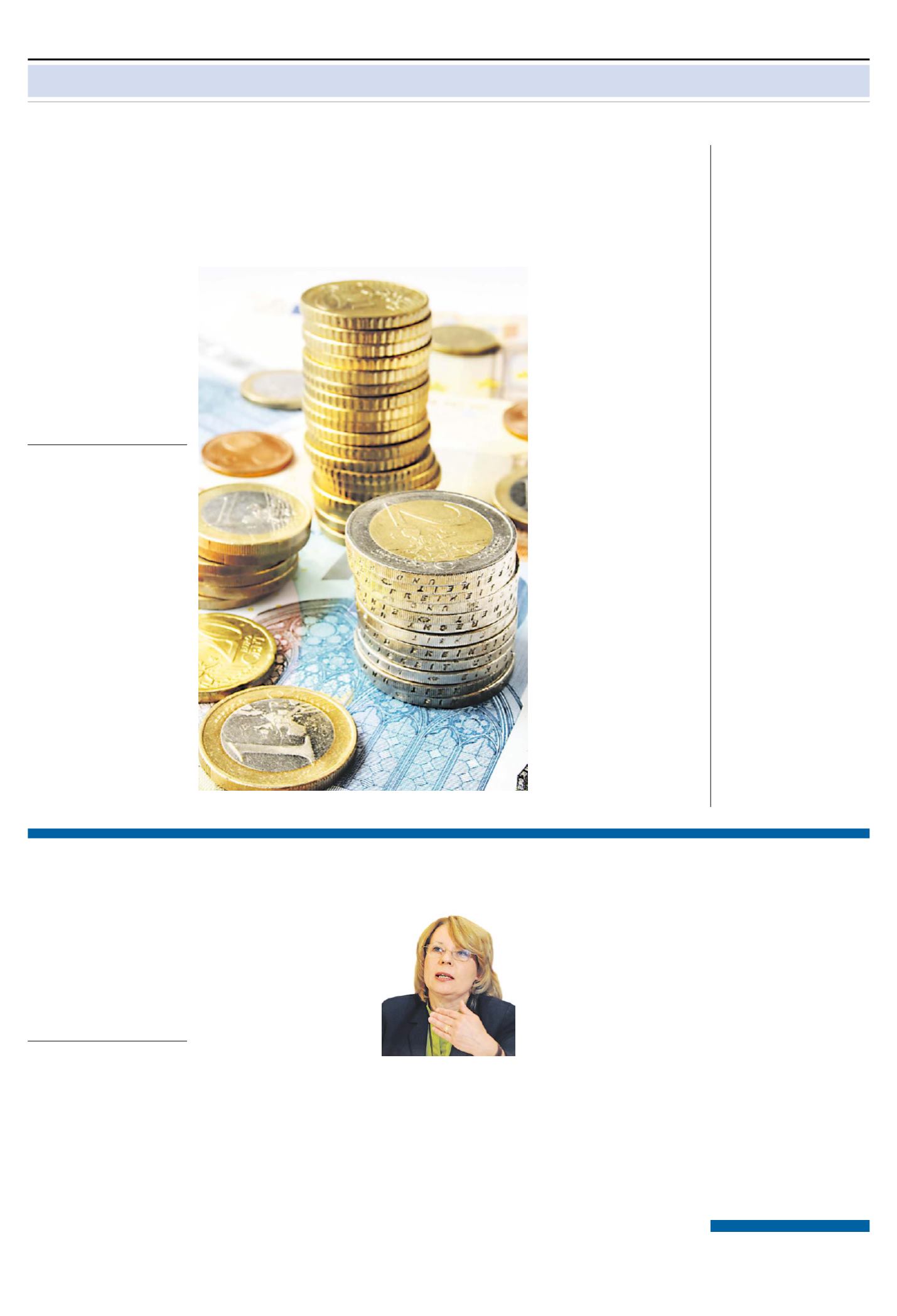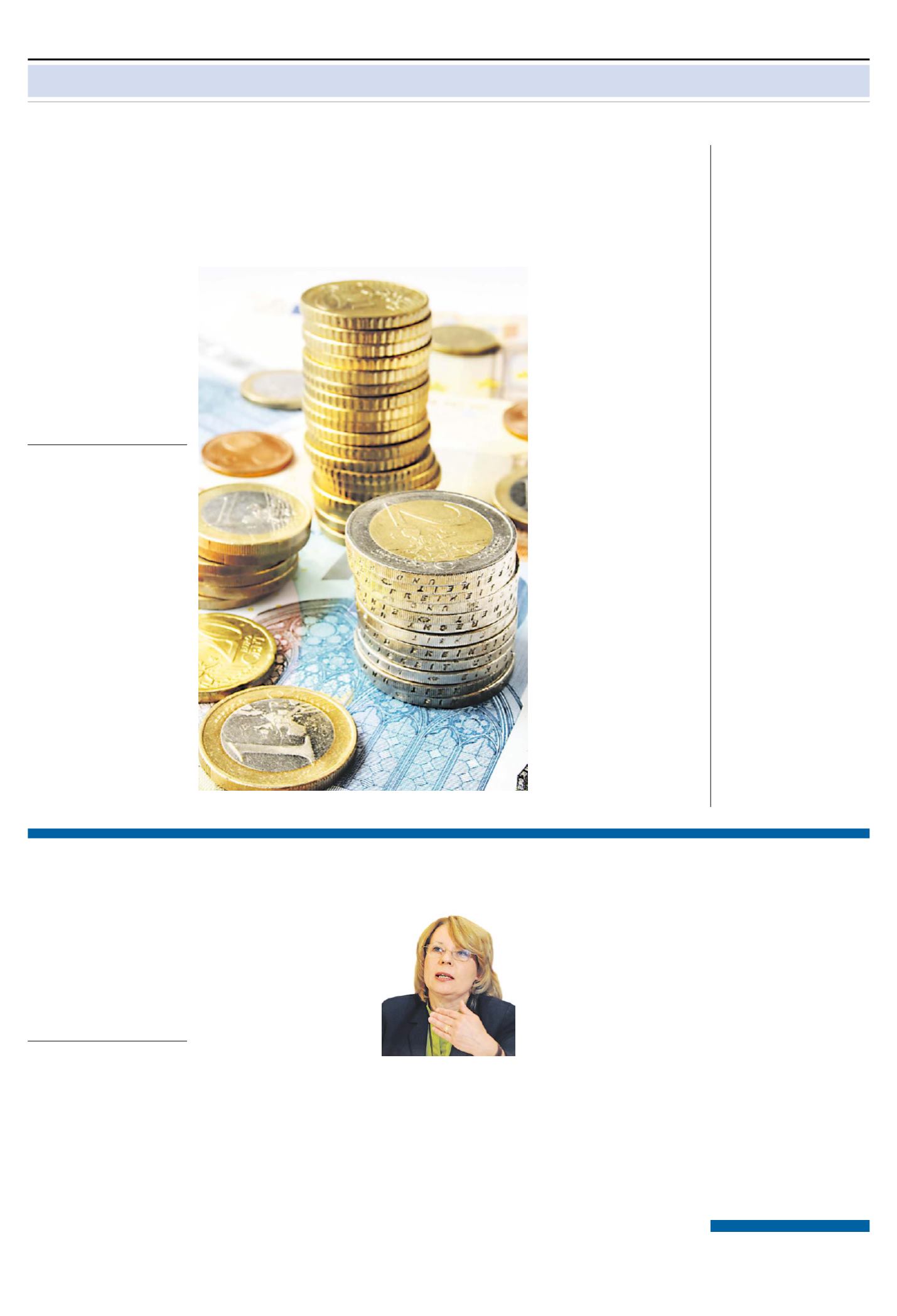
Berufspolitik
BDI aktuell
September 2014
5
Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung hat über die Honorarentwicklung
im vierten Quartal 2013 berichtet und
dabei erste Ergebnisse nach der
EBM-Reform im hausärztlichen Be-
reich mitgeteilt. Der Leistungsbedarf,
der weitgehend über den EBM gesteu-
ert wird, ist um 2,3 Prozent bundes-
weit gestiegen. Hier ergeben sich er-
hebliche regionale Differenzen zwi-
schen den Länder-KVen.
So hat Baden-Württemberg einen
Anstieg in der Leistungsbedarfsanfor-
derung von 13,1 Prozent, Mecklen-
burg-Vorpommern 4,2 Prozent, wäh-
rend Rheinland-Pfalz 0,4 Prozent we-
niger angefordert hat. Offensichtlich
ist noch nicht bei allen KVen der
EBM so angekommen, dass ein ein-
heitliches Leistungsmuster zu erken-
nen ist.
Bei den Fallwerten spielen neben
dem EBM auch die Honorarvertei-
lungsmaßstäbe eine entscheidende
Rolle. Auch hier liegt Baden-Würt-
temberg mit einer Steigerung des Fall-
wertes um 13,6 Prozent an der Spitze.
Hingegen ist es in Bayern zu einem
Verlust von 6,1 Prozent gekommen.
Damit wird deutlich, dass der EBM
durch die regionale Honorarverteilung
empfindlich korrigiert, wenn nicht so-
gar konterkariert wird. Der EBM ist
eben doch nicht der Maßstab für das
Honorar, das beim einzelnen Vertrags-
arzt ankommt. Regionale Verteilungs-
mechanismen scheinen eine deutlich
größere Rolle zu spielen, als die KVen
in der Öffentlichkeit zugeben.
200 Millionen Euro haben die
Krankenkassen für die Einführung von
geriatrischen und palliativmedizin-
ischen Leistungen zusätzlich zur Ver-
fügung gestellt. Sieht man die Zahl der
hausärztlich tätigen Vertragsärzte,
kann für den einzelnen Arzt nur ein
begrenztes Honorarvolumen zur Ver-
fügung stehen, sodass man diese Leis-
tungen von Anfang an quotiert hat.
Ähnliches scheint bei den Ge-
sprächsleistungen geschehen zu sein.
Betrachtet man das Ergebnis, so ist
der neue Hausarzt-EBM wieder ein
typisches Beispiel, wie im budgetierten
Vergütungssystem eine Reglementie-
rung eher zur Verunsicherung als zur
Sicherheit beiträgt. Vor allem ist zu er-
kennen, dass der Vertragsarzt durch
die regionalen Honorarverteilungs-
maßstäbe keine Planungssicherheit
durch den EBM hat. Dies gilt für
Hausärzte genauso wie für Fachärzte.
Ziel des neuen Hausarzt-EBM
scheint eine Nivellierung des hausärzt-
lichen Versorgungsspektrums zu sein.
Der EBM wird dazu benutzt, die
hausärztliche Praxis auf typisch haus-
ärztliche Leistungen einzugrenzen, in-
dem Leistungen außerhalb nicht mehr
abrechenbar sind oder reduziert be-
wertet werden. Wenn man dazu auch
noch den Bundesmantelvertrag ändert
und den Leistungsinhalt einer Haus-
arztpraxis verbindlich definiert, wird
an der Basis die Versorgungsflexibilität
aufgegeben.
Man kann der KBV nur empfehlen,
nicht über den EBM Versorgungs-
strukturen korrigieren zu wollen. Dies
ist zuerst Sache der Bedarfsplanung,
die der Gesetzgeber zu diesem Zweck
auf der regionalen Ebene mit mehr
Kompetenz ausgestattet hat.
Baden-Württembergs Ärzte
können sich freuen, Rhein-
land-Pfalz hat Nachholbe-
darf. Die EBM-Reform führt
in den KV-Regionen zu
unterschiedlichen Ergebnis-
sen. Versorgungsstrukturen
lassen sich so nicht
korrigieren.
Hausarzt-EBM: Reform mit
regional verschiedenen Effekten
Das Arzthonorar fällt regional sehr unterschiedlich aus.
© MELLIMAGE/FOTOLIA.COM
Von Dr. Hans-Friedrich Spies
Deutschland wird sich in den kom-
menden Jahren verändern. Der Anteil
älterer Menschen wird wachsen und
damit auch der Bedarf an gesundheit-
lichen und pflegerischen Dienstleis-
tungen, sowohl im ambulanten wie
auch im stationären Bereich. Das The-
ma Demografie und Gesundheit und
die damit verbundene Strukturierung
der für die Altersmedizin relevanten
medizinischen Fachgebiete ist deshalb
von besonderer Bedeutung.
Der Koalitionsvertrag der Großen
Koalition trägt dieser Herausforderung
Rechnung und auch in der Gesund-
heitsministerkonferenz unter dem Vor-
sitz Hamburgs stand die Zukunft der
Altersmedizin auf der Agenda. Geriat-
rische Patienten werden definiert
durch das hohe Lebensalter und Mul-
timorbidität, wie gleichzeitige Ein-
schränkungen des Bewegungsappara-
tes und Erkrankungen wie Diabetes
oder Demenz. Auch das erhöhte Auf-
treten von Komplikationen und Folge-
erkrankungen sowie eine teils erheb-
lich verzögerte Rekonvaleszenz sind
besondere Herausforderungen in der
Geriatrie und erfordern fachübergrei-
fende Behandlungen.
Die Altersmedizin beginnt dabei
keineswegs bei Null: Die medizin-
ischen Behandlungsmöglichkeiten für
ältere Menschen wurden in den letz-
ten Jahren deutlich erweitert. Dazu ge-
hören schonende Anästhesieverfahren
ebenso wie minimal-invasive Eingriffe,
die das Operationsrisiko deutlich redu-
zieren. Quantitativ steht neben Opera-
tionen am Herzen der Gelenkersatz im
Vordergrund. Ambulante Katarakt-
operationen oder ausgefeilte Hörhilfen
bewahren heute den Lebensstandard
älterer Menschen. Und geriatrische
Kenntnisse gehören auch bei Hausärz-
ten längst zur Grundkompetenz.
Ebenso bietet die technische Ent-
wicklung Chancen für die Altersmedi-
zin: Hoch spezialisierte medizinische
Angebote können technisch so ausge-
staltet werden, dass Patienten an ent-
fernten Orten telemedizinisch über-
wacht und künftig sogar therapiert
werden können. Darüber hinaus gibt
es in einzelnen Fachrichtungen spezifi-
sche Aktivitäten.
Die Deutsche Gesellschaft für Un-
fallchirurgie etwa geht von einer Ver-
doppelung bis Verdreifachung von Al-
tersbrüchen in den kommenden 20
Jahren aus und versucht, die unfallchi-
rurgische Versorgung von älteren
Menschen durch Alterstraumazentren
sicherzustellen.
Ein gutes Beispiel, aber ein abge-
stimmtes, umfassendes und besonders
wohnortnahes geriatrisches Versor-
gungskonzept ist auch in anderen Be-
reichen notwendig. Um die Versor-
gung einer älter werdenden Gesell-
schaft zu sichern, brauchen wir in Flä-
chenländern wie auch in Stadtstaaten
ambulante geriatrische Kompetenz-
zentren mit geriatrischen Institutsam-
bulanzen und einer speziellen Bera-
tung zur geriatrischen Rehabilitation.
Hier sollten niedergelassene Ärzte ge-
meinsam mit Kliniken die Versorgung
sicherstellen sowie eine fachkundige
Beratung zu Fragen der Altersmedizin
anbieten, die jedem zugänglich ist.
In Hamburg befassen wir uns ge-
meinsam mit den Kliniken bereits in-
tensiv mit der zukünftigen Versorgung
älterer Patienten in den Krankenhäu-
sern. Das Ziel ist es, die Selbstständig-
keit der älteren Menschen zu erhalten
und so weit wie möglich wieder herzu-
stellen. Die Kliniken sollen eine auf
das Bild der Multimorbidität abge-
stimmte multidimensionale geriatri-
sche Abklärung der verschiedenen
Krankheiten und ihrer jeweiligen Zu-
sammenhänge sowie eine darauf auf-
bauende geriatrische Akutbehandlung,
geriatrische Frührehabilitation, neuro-
logische Frührehabilitation und gege-
benenfalls gerontopsychiatrische Be-
handlung anbieten.
Nicht unerwähnt bleiben darf bei
einer Diskussion über die Zukunft der
Altersmedizin aber auch die Gefahr ei-
nes Fachkräftemangels in der Pflege.
Um diesem entgegen zu treten, müs-
sen wir junge Menschen, insbesondere
auch Männer, für den Pflegeberuf be-
geistern. Wir müssen dem Nachwuchs
nach einer generalistischen Ausbil-
dung, ohne Trennung in Alters- oder
Krankenpflege, eine Perspektive eröff-
nen. Ebenso müssen wir das Interesse
an einem Um- oder Wiedereinstieg in
den Pflegeberuf noch intensiver för-
dern. Nur so können wir die Heraus-
forderungen, die eine älter werdende
Gesellschaft mit sich bringt, bestehen.
Die Zukunft liegt in geriatrischen Kompetenzzentren
Die Bevölkerung wird
zunehmend älter. In der
Altersmedizin braucht es
daher wohnortnahe Versor-
gungskonzepte. Ein Bei-
spiel: ambulante geriatri-
sche Kompetenzzentren.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Cornelia Prüfer-Storcks ist Gesund-
heitssenatorin in Hamburg und
amtierende Vorsitzende der
Gesundheitsministerkonferenz.
© CHRISTIAN CHARIUS/DPA
Die Auffassung des Autoren deckt sich nicht
unbedingt mit der Meinung der Redaktion oder
des Berufsverbandes Deutscher Internisten e.V.
HINWEIS
Von Cornelia Prüfer-Storcks
Die ärztlichen Körperschaften,
Bundesärztekammer (BÄK) und
Kassenärztliche Bundesvereinigung,
haben signalisiert, wieder in den
Bundesverband freier Berufe zu-
rückzukehren. Sie waren Ende
2013 aus verschiedenen, teils inter-
nen Gründen ausgetreten.
Inzwischen hat sich der Bundes-
verband der Freien Berufe neu sor-
tiert – und die organisierte Ärzte-
schaft erwägt eine Rückkehr. Unter
anderem wurde als Grund für den
Austritt eine zu hohe Beitragslast
angegeben. Zuletzt musste allein
die BÄK rund 200000 Euro im
Jahr an den Bundesverband freier
Berufe überweisen. Diese Summe
könnte sich bei einer Rückkehr hal-
bieren, der Einfluss auf den Ver-
band jedoch erhöhen, heißt es nun.
Ein weiterer Grund scheint der
Einfluss des Verbandes in der poli-
tischen Lobbyarbeit zu sein. Von
manchen Regierungsinformationen
fühlt sich die Ärzteschaft seit dem
Austritt ausgeschlossen, heißt es.
Bei der BÄK hat sich wohl die
wichtige Erkenntnis durchgesetzt,
dass die Freiberuflichkeit nicht mit
der Selbstständigkeit im Berufsle-
ben verwechselt werden darf. Auch
angestellte Ärzte und angestellte
Anwälte sind freiberuflich tätig. Ge-
rade die Ärzte im Krankenhaus ha-
ben bei der zunehmenden Ökono-
misierung der Krankenhausversor-
gung eine Stärkung ihrer Freiberuf-
lichkeit dringend nötig.
Im Bundesverband freier Berufe
sind nicht nur Ärzte, sondern ne-
ben Anwälten, Steuerberatern und
Architekten, viele freiberuflich täti-
ge Berufsgruppen organisiert.
(HFS/af)
Bundesverband
Freie Berufe
im Aufwind
Bundesärztekammer und
KBV stellen in Aussicht,
in den Bundesverband
wieder einzutreten.
INTERESSENVERTRETUNG