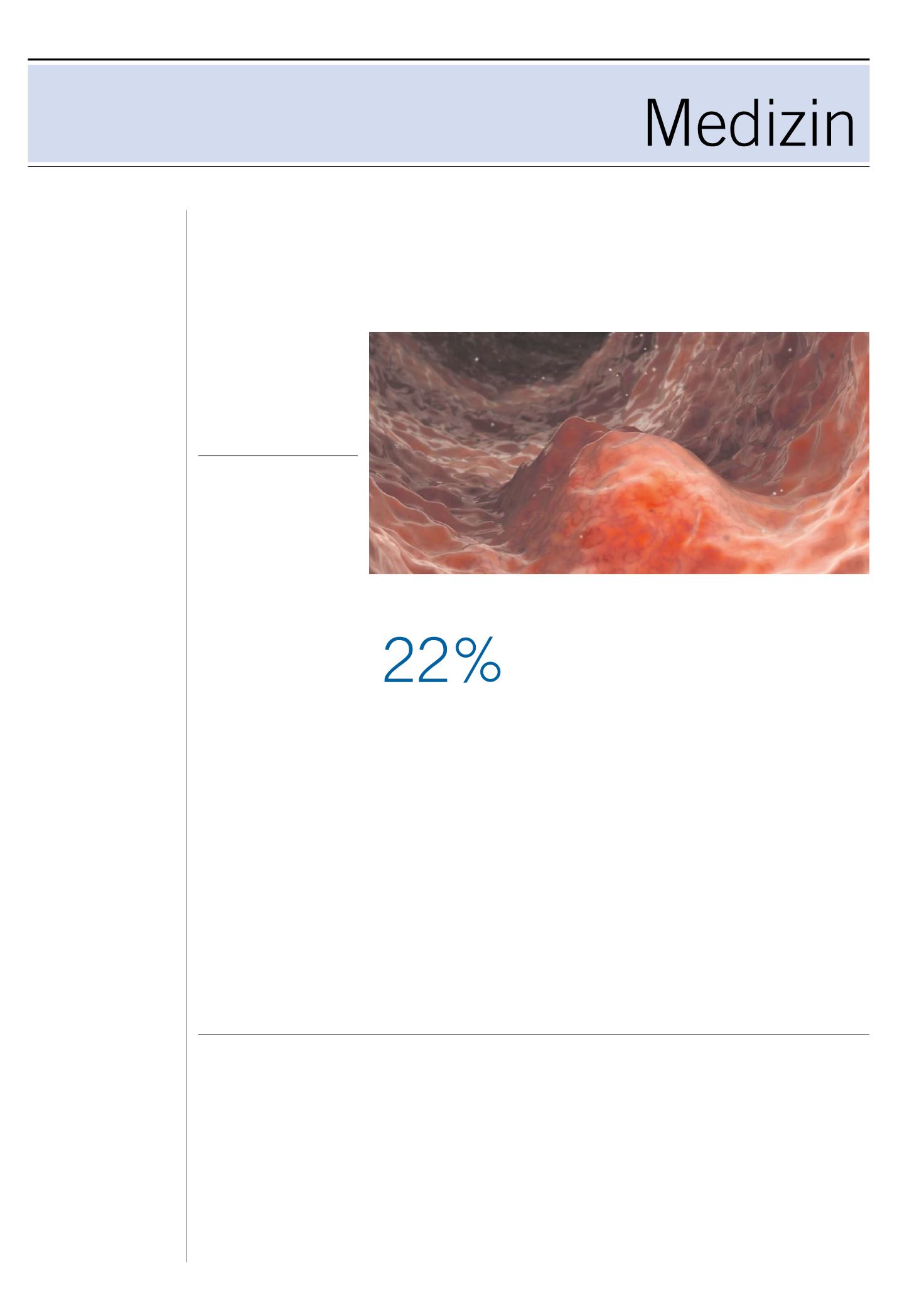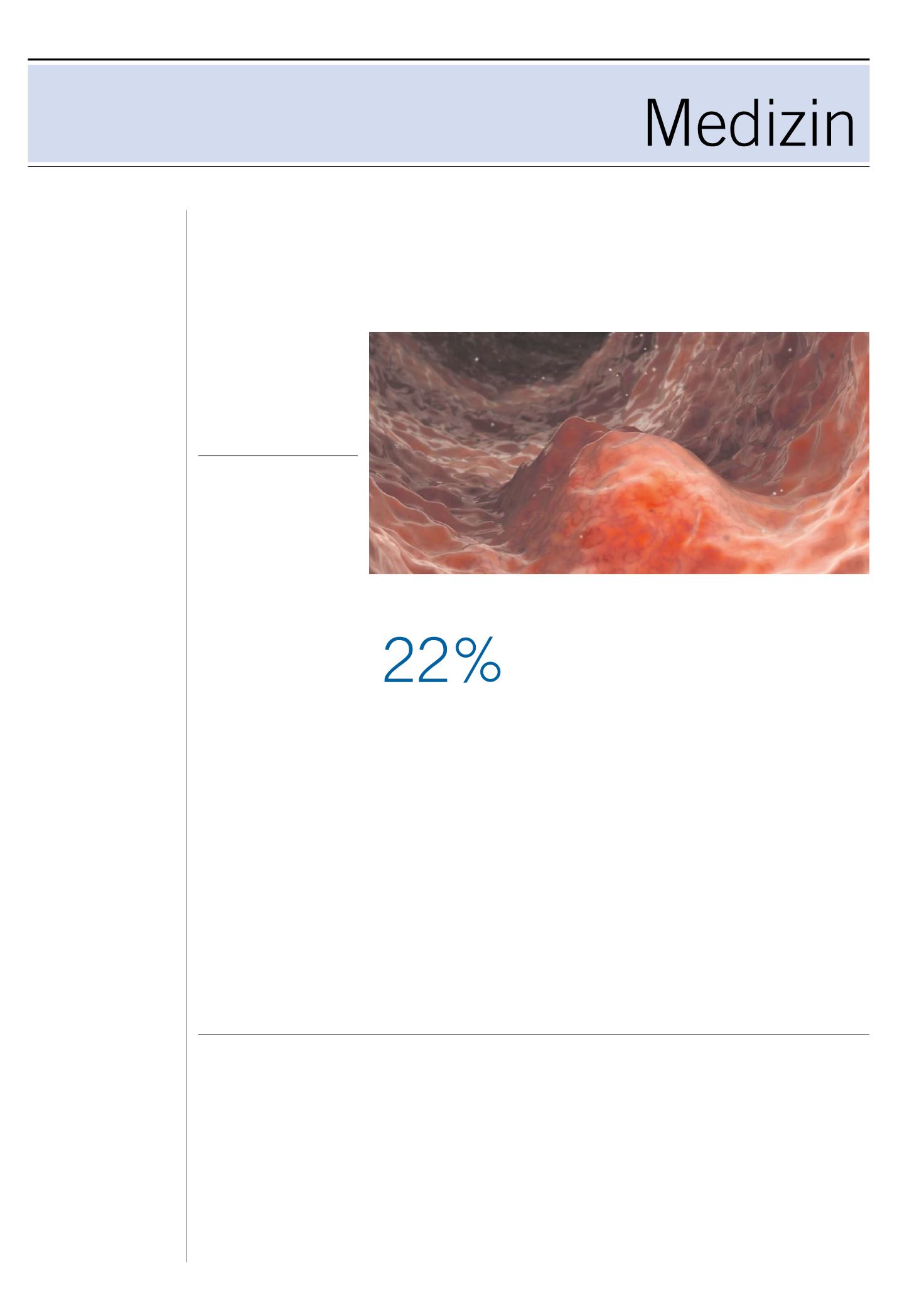
10
BDI aktuell
September 2014
Seit Zulassung von Imatinib für die
Therapie inoperabler oder metastasier-
ter gastrointestinaler Stromatumoren
(GIST) besserte sich die Prognose der
Patienten enorm: Das Langzeit-Upda-
te der SWOG-Intergroup-Studie
S0033 zeigt, dass die initiale Therapie
mit dem Tyrosinkinase-Inhibitor
(TKI) vielen von ihnen Überlebenszei-
ten von mehr als zehn Jahren ermög-
licht. Bei Resistenzen gegenüber Ima-
tinib werden neue Substanzen wichtig.
Gesamtüberleben median 52 Monate
Nur zwei Jahre nach Erstbeschreibung
von KIT-Mutationen bei GIST wurde
die randomisierte SWOG-Studie
S0033 aufgelegt, erinnerte Professor
George Demetri, Dana Farber Cancer
Center, Harvard/USA, auf der 50. Jah-
restagung der American Society of
Clinical Oncology (ASCO) 2014 in
Chicago. Sie verglich bei rund 700 Pa-
tienten mit fortgeschrittenen, KIT-ex-
primierenden GIST Imatinib in Do-
sen von 400 mg und 800 mg täglich.
Nach der US-Zulassung Anfang 2002
erhielten alle Teilnehmer eine Lang-
zeittherapie mit Imatinib; diese Patien-
ten werden inzwischen über zehn Jah-
re nachbeobachtet. Die Rate an Lang-
zeitüberlebenden (Gesamtüberleben
8 Jahre) unterscheidet sich in bei-
den Armen mit 27 Prozent (400 mg/d)
bzw. 25 Prozent (800 mg/d) nicht. Die
Überlebensrate im Gesamtkollektiv
liegt bei 22 Prozent, das mediane Ge-
samtüberleben bei 52 Monaten.
Laut Demetri konnte bei 395 Pati-
enten der GIST-Mutationsstatus erho-
ben werden. Mutationen im KIT-
Exon 11 waren mit 71 Prozent am
häufigsten; es folgten Mutationen im
KIT-Exon 9 mit 8 Prozent und weite-
re KIT- oder PDGFR-Mutationen mit
4 Prozent. Bei 17 Prozent der Teilneh-
mer wurden keine solchen Mutationen
festgestellt. Patienten mit genetischen
Anomalien in Exon 11 hatten mit 66
Monaten im Vergleich zu Patienten
ohne (40 Monate) oder mit anderen
Mutationen (38 Monate) ein signifi-
kant
längeres
Gesamtüberleben
(p=0,001 bzw. p 0,047).
Therapie nach Progress wichtig
Demetri betonte, dass die langen
Überlebenszeiten auch darauf zurück-
zuführen sind, dass mehr als die Hälfte
der Studienteilnehmer nach Progress
unter Imatinib weitere Therapien er-
hielten. Darauf verweist eine Subgrup-
penanalyse von 137 Langzeitüberle-
benden, von denen knapp die Hälfte
kontinuierlich Imatinib als einzige
Therapie erhielt. Bei den übrigen 51
Prozent kamen als weitere Optionen
Sunitinib (39%), Sorafenib (12%),
weitere Substanzen (31%), operative
Maßnahmen (30%), Radiofrequenz-
ablation (7%) und/oder Bestrahlung
(4%) zum Einsatz. Das Gesamtüberle-
ben dieser Patienten wird damit durch
On-Study- und Post-Study-Interventi-
onen beeinflusst, betonte Demetri.
Seit dieser frühen SWOG-Studie
hat sich die therapeutische Landschaft
beim GIST nach seinen Worten stark
verändert. Inzwischen wurden weitere
TKI für unter Imatinib progrediente
Patienten zugelassen.
In einer Phase-II-Studie geprüft
wurde der bislang bei Leukämien ein-
gesetzte TKI Ponatinib, der bei mu-
tierten Formen von KIT und PDGFR
eine hohe Aktivität besitzt, berichtete
Dr. Michael C. Heinrich, Cancer Care
Center, Portland/USA. Die Hälfte der
Teilnehmer, die zuvor bereits auf zwei
(46%) oder drei TKI (46%) nicht
mehr angesprochen hatten, profitierte
mit einem klinischen Benefit von der
Therapie; 14 Patienten werden nach
einem Follow-up von median sechs
Monaten weiterhin mit Ponatinib be-
handelt. Das progressionsfreie Überle-
ben beträgt sieben Monate: der Medi-
an im Gesamtüberleben ist noch nicht
erreicht.
Eine weitere Option ist Linsitinib,
ein selektiver dualer Inhibitor von
IGF-1- und Insulin-Rezeptor, berich-
tete Dr. Margaret von Mehren, Fox
Chase Cancer Center, Philadel-
phia/USA. Laut Interimsanalyse einer
Phase-II-Studie bei Patienten mit un-
mutierten GIST erreichten 85 Prozent
der Teilnehmer eine Tumorstabilisie-
rung, die bei 40 Prozent mindestens
neun Monate anhielt. Allerdings wur-
den keine objektiven Remissionen
nach RECIST (Response Evaluation
Criteria In Solid Tumors) beobachtet.
Professor Dr. Jon Trent, Universität
von Miami, wies in seiner Diskussion
jedoch darauf hin, dass die RECIST-
Kriterien für die Effektivitätsbestim-
mung bei GIST nicht optimal sind.
Seiner Meinung nach ist eine moleku-
lare Subtypisierung von Patienten mit
unmutiertem GIST erforderlich, um
diese Subgruppe besser zu charakteri-
sieren.
Viele Patienten mit inopera-
blen oder metastasierten
GIST können heute dank ei-
ner initialen TKI-Therapie
Überlebenszeiten von mehr
als zehn Jahren erreichen.
SWOG-Studie S0033: Mit GIST
kann man lange leben
Von Dr. Katharina Arnheim
Nahezu alle Erwachsenen mit metastasierten GIST weisen aktivierende Mutationen der Rezeptortyrosinkinase auf.
© SEBASTIAN SCHREITER, SPRINGER MEDIZIN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
beträgt die
Überlebensrate im
Gesamtkollektiv
der Patienten mit
GIST, die im Rahmen der SWOG-
Studie S0033 eine Langzeittherapie
mit Imatinib erhalten haben.
Auch bei prämenopausalen Patien-
tinnen mit hormonsensiblem Mam-
makarzinom hat sich die adjuvante
Aromatasehemmung jetzt im Ver-
gleich zu Tamoxifen als überlegen
erwiesen: Laut gemeinsamer Analy-
se der Phase-III-Studien SOFT
und TEXT wird durch die Kombi-
nation mit Exemestan und GnRH-
Agonist eine Verbesserung des
krankheitsfreien Überlebens um 28
Prozent erreicht. Die gemeinsame
Auswertung war notwendig, so Dr.
Olivia Pagani, Istituto Oncologica
della Svizzera Italiana, Bellinzo-
na/Schweiz, auf dem ASCO, da die
Ereignisrate in beiden Studien er-
heblich niedriger war als erwartet.
Daten zum Vergleich von Tamoxi-
fen mono versus Tamoxifen plus
ovarielle Suppression aus SOFT
werden Ende 2014 vorgestellt.
In TEXT wurde Tamoxifen mit
Exemestan, beides in Kombination
mit ovarieller Suppression, vergli-
chen. Die dreiarmige SOFT-Studie
verglich Tamoxifen allein versus
Tamoxifen plus ovarielle Suppressi-
on versus Exemestan plus ovarielle
Suppression. Alle Teilnehmerinnen
wurden fünf Jahre lang adjuvant be-
handelt. Vom Aromatasehemmer
profitierten alle Patientinnen unab-
hängig von Nodalstatus und vor-
ausgegangener Chemotherapie. Das
brustkrebsfreie Intervall verbesserte
sich um absolut 4 Prozent nach
fünf Jahren (92,8 vs. 88,8%;
p 0,0001), das fernmetastasenfreie
Intervall um fast 2 Prozent (93,8 vs.
92,0%; p=0,02).
(arn)
Neue Option bei
jüngeren Frauen
mit Brustkrebs
Unter adjuvanter Aroma-
tasehemmung blieben
prämenopausale Frauen
länger ohne Rezidiv.
AROMATASEHEMMUNG
Bei Brustkrebspatientinnen mit
Knochenmetastasen muss Zole-
dronsäure nicht jeden Monat gege-
ben werden, erklärte Professor Ga-
briel Hortobagyi, Anderson Cancer
Center, Houston/USA auf dem
ASCO unter Bezugnahme auf
OPTIMIZE-2. In der Studie hatte
sich nach median zwölfmonatigem
Follow-up die Therapie in dreimo-
natigem Dosierungsintervall als
nicht unterlegen erwiesen. Teilge-
nommen hatten 403 Patientinnen,
die zuvor bereits neun Dosen eines
Bisphosphonats i.v. erhalten hatten.
Im Standardarm lag die SRE-Rate
bei 22 Prozent, im experimentellen
Arm bei 23,2 Prozent. Die Zeit bis
zum ersten SRE war vergleichbar
(HR 1,06; p=0,792). Auch bei
Markern des Knochenstoffwechsels
zeigte sich kein Unterschied zwi-
schen den Gruppen. Allerdings tra-
ten bei monatlicher Gabe bei zwei
Frauen Kieferosteonekrosen auf.
Renale Nebenwirkungen waren bei
dreimonatiger Infusion tendenziell
seltener (7,9 vs. 9,6%).
(am)
Zoledronsäure
alle drei Monate
reicht aus
KNOCHENMETASTASEN
Für die Zweitlinientherapie des
NSCLC im Stadium IV sind mit Do-
cetaxel, Pemetrexed und Erlotinib der-
zeit drei Substanzen zugelassen. Sie
sind jedoch mit Gesamtüberlebenszei-
ten von sieben bis neun Monaten nur
mäßig effektiv. Wie Professor Maurice
Pérol, Léon-Bérard Cancer Centre,
Lyon/Frankreich, auf dem ASCO aus-
führte, hat sich das mit REVEL geän-
dert: Die Phase-III-Studie schloss
rund 1250 NSCLC-Patienten im Sta-
dium IV ein, die während oder nach
platinbasierter Chemotherapie und
ggf. anschließender Erhaltungstherapie
einen Progress erlitten hatten. Sie wur-
den randomisiert einer Docetaxel-Mo-
notherapie (plus Placebo; n=625) oder
der Kombination Docetaxel plus Ra-
mucirumab (n=628) zugeteilt. Die
Teilnehmer besaßen NSCLC aller
Histologien und konnten bereits Beva-
cizumab erhalten haben.
Der primäre Endpunkt wurde er-
reicht: Die zusätzliche Gabe von Ra-
mucirumab reduzierte das Sterberisiko
signifikant um relativ 14 Prozent (HR
0,857; p=0,0235). Das Gesamtüberle-
ben verlängerte sich um median 1,4
Monate – von 9,1 Monaten im Kont-
rollarm auf 10,5 Monate.
Effekt in Subgruppen konsistent
Auch bei den sekundären Endpunkten
erwies sich die Antikörper-Addition
als erfolgreich: Das progressionsfreie
Überleben konnte um median 1,5
Monate verbessert (3,0 vs. 4,5 Mona-
te), das Progressionsrisiko signifikant
um relativ 24 Prozent gesenkt werden
(HR 0,762; p 0,0001). Auch die An-
sprechrate stieg bei kombinierter The-
rapie signifikant an (14% vs. 23%;
p 0,001). Wie Pérol betonte, war der
Therapieeffekt in allen prognostischen
Subgruppen konsistent. Es profitierten
sowohl Patienten mit Plattenzell- als
auch mit Nicht-Plattenzell-Histologie.
Die zusätzliche Ramucirumab-Ga-
be steigerte die Toxizität nur minimal;
Nebenwirkungen waren gut zu mana-
gen und meist auf die Chemotherapie
zurückzuführen.
(arn)
Erstmals seit einer Dekade
gibt es wieder eine neue
Option für vorbehandelte
Patienten mit NSCLC.
Fortschritt in der NSCLC-Zweitlinientherapie