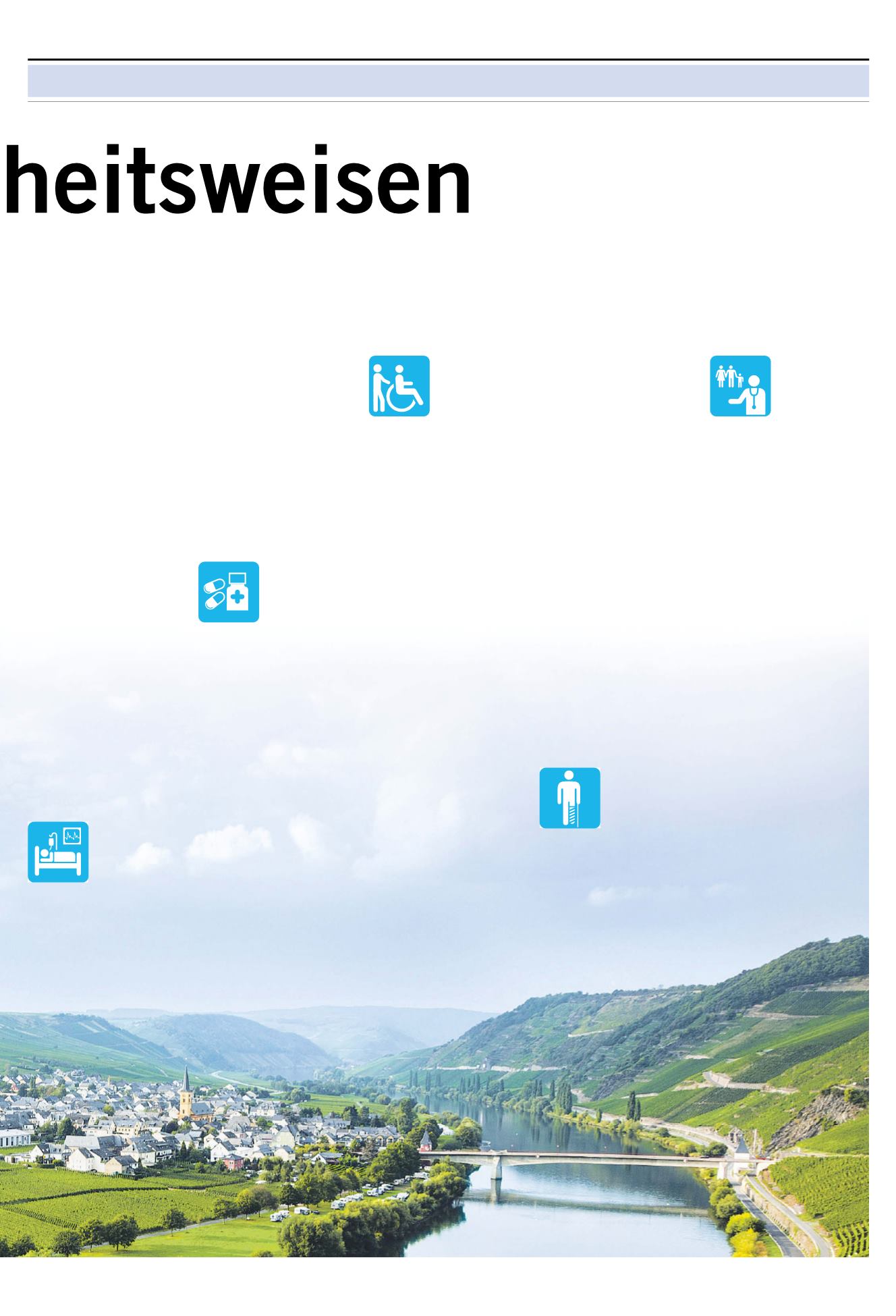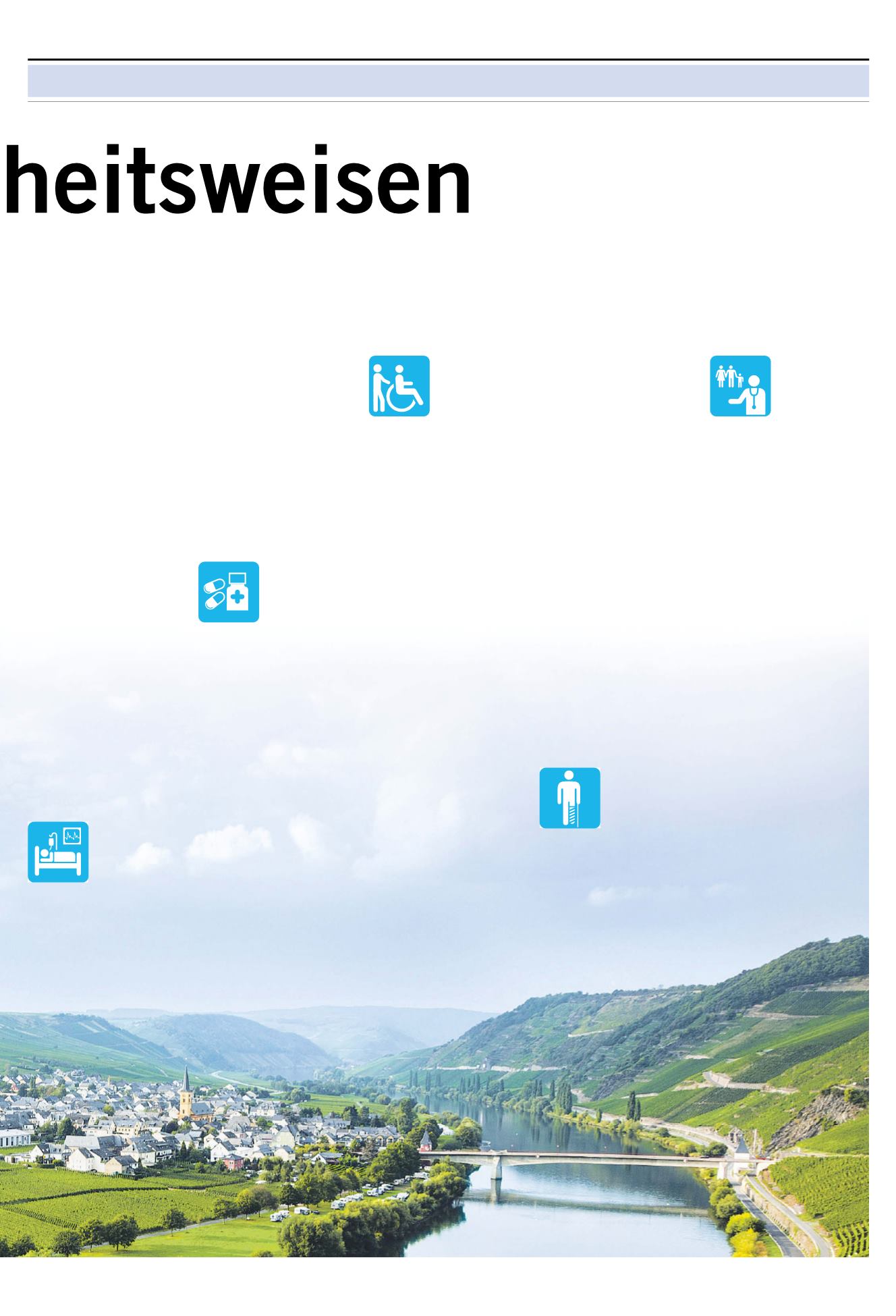
Berufspolitik
BDI aktuell
September 2014
9
nicht nur für die Kommunen, sondern
auch für andere Hilfsorganisationen
gute finanzielle Einnahmen sichert.
Die KVen mahnen, die ärztliche
Qualität könne erhöht werden, wenn
Ärzte wie Pathologen, Radiologen und
Laborärzte oder ärztliche Psychothera-
peuten nicht mehr zum Dienst heran-
gezogen werden dürfen. Der Grund:
Ihre Tätigkeit weist keine allgemein-
ärztliche Patientennähe auf.
Die große Lösung wäre, die drei
Bereiche zusammenzufassen. So könn-
ten Vorhaltekosten gesenkt und vor-
handene ärztliche Ressourcen qualita-
tiv besser genutzt werden. Durch Zen-
trierung der Versorgung über Gemein-
schaftsstrukturen, eine sinnvolle Ein-
bindung vorhandener Krankenhäuser
und eine Neustrukturierung des Not-
falldienstes hoffen die Sachverständi-
gen, die Versorgung im ländlichen
Raum langfristig zu sichern.
Doch wie erhält eine älter werdende
Bevölkerung mit immer mehr Alleinle-
benden Zugang zu einer so organisier-
ten Versorgung? Hier sollen Zweig-
sprechstunden in kleineren Gemein-
den, aber auch eine regionale Ver-
kehrsplanung helfen. Wir erinnern
uns: Auch die Dorfschule musste auf-
gegeben werden. Schulkinder werden
heute mit Bussen zum Unterricht in
große zentral gelegene Einheiten
transportiert. Ein Modell, das auch auf
die ländliche medizinische Versorgung
in Zukunft übertragbar sein könnte.
Werden diese Vorschläge Realität,
müssen manche beteiligten Ärzte und
Patienten umdenken.
Das Gutachten be-
schäftigt sich sehr
einseitig mit der
Stärkung der haus-
ärztlichen
Versor-
gung, insbesondere
der Allgemeinmedi-
zin. Man muss sich fragen, ob dies am
Ratsvorsitzenden Professor Ferdinand
Gerlach liegt, der in Personalunion der
Fachgesellschaft DEGAM als Präsi-
dent vorsteht, die die fachlichen und
wissenschaftlichen Interessen der All-
gemeinmedizin vertritt.
Die Forderungen gehen so weit,
dass der Rat dafür plädiert, eine Haus-
arztzentrierung der Versorgung gesetz-
lich einzuführen. Die freie Arztwahl
soll indirekt eingeschränkt werden, in-
dem man den Zugang zu Fachärzten
erschwert. Für Patienten ohne Über-
weisung schlägt der Rat eine gestaffel-
te Selbstbeteiligung vor. Solche Forde-
rungen nach einem verkappten „Gate-
keeping“ durch den Hausarzt sind für
Deutschland sehr weitgehend, wo die
freie Arztwahl unabhängig von Haus-
und Facharzt ein hohes Gut in den
Augen der Patienten darstellt.
Ein großes Kapitel gilt der Stärkung
der Allgemeinmedizin. Die Debatte
über die hausärztliche Versorgung
wird auf das Fach Allgemeinmedizin
zentriert, obwohl zu diesem Sektor
auch Internisten und Kinderärzte ge-
hören. Manche fordern sogar, dass
konservativ tätige Gynäkologen, Hals-
Nasen-Ohren-Ärzte und Augenärzte
einbezogen werden. Der Rat über-
sieht, dass die Internisten ohne
Schwerpunkt die Lücken im hausärzt-
lichen Bereich schließen könnten.
Bei der Muster-Weiterbildungsord-
nung werden nahezu alle Forderungen
des Hausärzteverbandes übernommen.
Dabei nimmt der Rat nicht zur Kennt-
nis, dass diese Maßnahmen schon seit
Jahren hätten umgesetzt werden kön-
nen. Die Vorschläge zeigen keinen in-
novativen Ansatz.
Der Zugang zu
Fachärzten soll
erschwert werden
STÄRKUNG DER HAUSÄRZTE
Medizinprodukte
sind den Sachver-
ständigen
zufolge
nur schwer zu diffe-
renzieren. Sie rei-
chen von Verbands-
material bis zur
PET-Untersuchung.
Wirtschaftlich
haben Medizinprodukte eine große
Bedeutung. Der Umsatz in den USA
betrug 2012 rund 90 Milliarden Euro,
in Japan 25 Milliarden Euro und in
Deutschland 22,3 Milliarden Euro.
Deutschland liefert zwei Drittel der
Produkte ins Ausland. 41 Prozent aller
Patente befinden sich in den USA, da-
hinter Deutschland mit 14 Prozent.
Die Gesundheitsweisen vergleichen
die Zulassungsbedingungen für Medi-
zinprodukte in Europa mit den USA,
in denen die Vorgaben wesentlich
strenger sind. Die dort zuständige
Food and Drug Administration (FDA)
fordert bei der Markteinführung ein-
deutige klinische Untersuchungsergeb-
nisse und sorgt für eine ausführliche
Anwendungsbeobachtung.
Die Ratsmitglieder verweisen auch
auf das in Deutschland unterschiedli-
che Leistungsrecht im ambulanten
und stationären Bereich. Ambulant
gilt der Erlaubnisvorbehalt, das heißt,
Medizinprodukte können nur verwen-
det werden, wenn sie ausdrücklich er-
laubt sind. In der Klinik gilt der Ver-
botsvorbehalt. Es ist also alles erlaubt,
außer es ist grundsätzlich verboten.
Innovationen rascher in der Klinik
Bei der Zulassung von Medizinpro-
dukten gibt es somit in Deutschland
zwei Rechtskreise, einen ambulanten
und einen stationären. Die Innovatio-
nen werden deshalb nahezu immer im
stationären Bereich durch die soge-
nannten NUB-Regelungen eingeführt,
zum Teil auch ohne klinische Untersu-
chungsergebnisse. Es reicht die Zulas-
sung über die EU-Richtlinien.
In dieser unübersichtlichen Gemen-
gelage empfehlen die Sachverständi-
gen, dass Innovationen zwar im
GKV-System unverändert erhalten
bleiben sollen. Es sollten aber gleiche
Grundsätze für die Einführung im am-
bulanten wie im stationären Sektor
gelten. Sie fordern, die Abrechnungs-
grundsätze ambulant und stationär an-
zugleichen, und rütteln damit an ei-
nem der Grundprinzipien der Ge-
sundheitsversorgung.
Neu ist die Forderung nach soge-
nannten Äquivalenzverfahren, die im
Gemeinsamen Bundesausschuss – wo
auch sonst – angesiedelt werden sol-
len. Dabei sollen immer Nutzen, Kos-
ten, aber auch die Möglichkeit einer
Qualitätssicherung geklärt werden.
Vergleich mit zugelassenem Produkt
Beim technischen Äquivalenzverfahren
findet der Vergleich mit einem zuge-
lassenen Referenzprodukt statt. Bei
der klinischen Äquivalenz wird ein
Vergleich mit zugelassenen therapeuti-
schen Ansätzen gefordert, ohne dass
dabei zwingend ein neues Produkt ein-
geführt wird. Der Rat legt sich zwar ei-
nerseits fest, dass eine Zulassung sinn-
voll ist, wenn das Produkt den zurzeit
gängigen Verfahren nicht unterlegen
ist. Sie verwenden aber auch den Be-
griff des Zusatznutzens, der beim AM-
NOG schon zu erheblichen Verwer-
fungen geführt hat.
Insgesamt ist festzustellen, dass die
deutschen Regelungen für die Zulas-
sung von Arzneimitteln auch bei den
Vorschlägen für eine Regelung bei
Medizinprodukten teils Pate gestan-
den haben.
Das AMNOG als
Pate für schärfere
Regelungen
MEDIZINPRODUKTE
Unter dem Aspekt
der ländlichen Regi-
on wird auch die
akutstationäre Ver-
sorgung betrachtet.
Weil in den Flächen-
ländern
oft
die
Stadtstaaten einen Teil der Kranken-
hausversorgung übernehmen, sind
Krankenhausplanung und Investiti-
onsfinanzierung nur sehr schwer zu
bewerten.
Grundsätzlich beklagt der Sachver-
ständigenrat, dass die Länder den Kli-
niken nicht genügend Investitionsmit-
tel zur Verfügung stellen. Um eine
qualitativ hochwertige Versorgung in
den Kliniken zu erhalten, halten die
Experten es zwar für nötig, dass sich
Krankenhäuser zusammenschließen
müssen, andererseits sehen sie da-
durch aber die Gefahr, dass die flä-
chendeckende Versorgung Löcher be-
kommt. Der Rat fordert, weder die
duale Finanzierung aufzuheben noch
den Sicherstellungsauftrag in der
Krankenhausversorgung
zwischen
Bund und Ländern neu zu ordnen. Al-
so auch hier keine innovativen Ansät-
ze.
Zusammenschluss
von Kliniken
ist notwendig
STATIONÄRE VERSORGUNG
Bei der Rehabilitati-
on beklagt der Sach-
verständigenrat eine
mangelnde Evidenz,
die eine genaue Be-
wertung erschwert.
Er fordert die Kos-
tenträger auf, vergleichbare Grundsät-
ze und Vorgaben zu erstellen, damit in
Zukunft eine wissenschaftliche Bewer-
tung besser möglich ist.
Die ambulante Rehabilitation soll
insgesamt gefördert werden, der Rat
sieht hier aber Grenzen in einer Ge-
sellschaft, die immer mehr aus Allein-
lebenden besteht.
REHABILITATION
Ambulante Reha
soll stärker
gefördert werden
Der Sachverständi-
genrat widmet sich
auch der Versorgung
mit
Arzneimitteln
und Medizinproduk-
ten sowie dem Sek-
tor der Rehabilitati-
on in Deutschland.
Beim Arzneimittelmarkt beschäftigt
sich der Sachverständigenrat zunächst
mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Er
schließt sich der Forderung der nie-
dergelassenen Ärzte nicht an, diese
gänzlich abzuschaffen. Im Gegenteil:
Die Experten möchten die arztgrup-
penspezifischen Richtgrößenvolumina
genauer anpassen und neue Ver-
gleichsgruppen einführen. Der Vor-
schlag, dass man die Regresssummen
bei etwa 20000 Euro deckeln sollte,
kommt den Ärzten entgegen.
Aus Sicht des Rats sollen künftig
qualitative medizinische Parameter ei-
ne größere Rolle bei der Steuerung
spielen, etwa die Verordnung von Leit-
substanzen. Zudem mahnen die Sach-
verständigen, die Meldung von Praxis-
besonderheiten besser zu nutzen.
Die Regelungen des AMNOG wer-
den begrüßt und sollen auf die Nut-
zenbewertung bei der Neueinführung
von Arzneimitteln im stationären Be-
reich übertragen werden, fordern sie.
Die von den Sachverständigen ge-
machten Vorschläge bedeuten somit
keinen Richtungswechsel, sie schlagen
aber differenziertere Mechanismen der
Kontrolle vor. Mehr als zusätzliche
Bürokratie ist damit nicht zu erwarten.
Steuerung durch
medizinische
Parameter
ARZNEIMITTEL