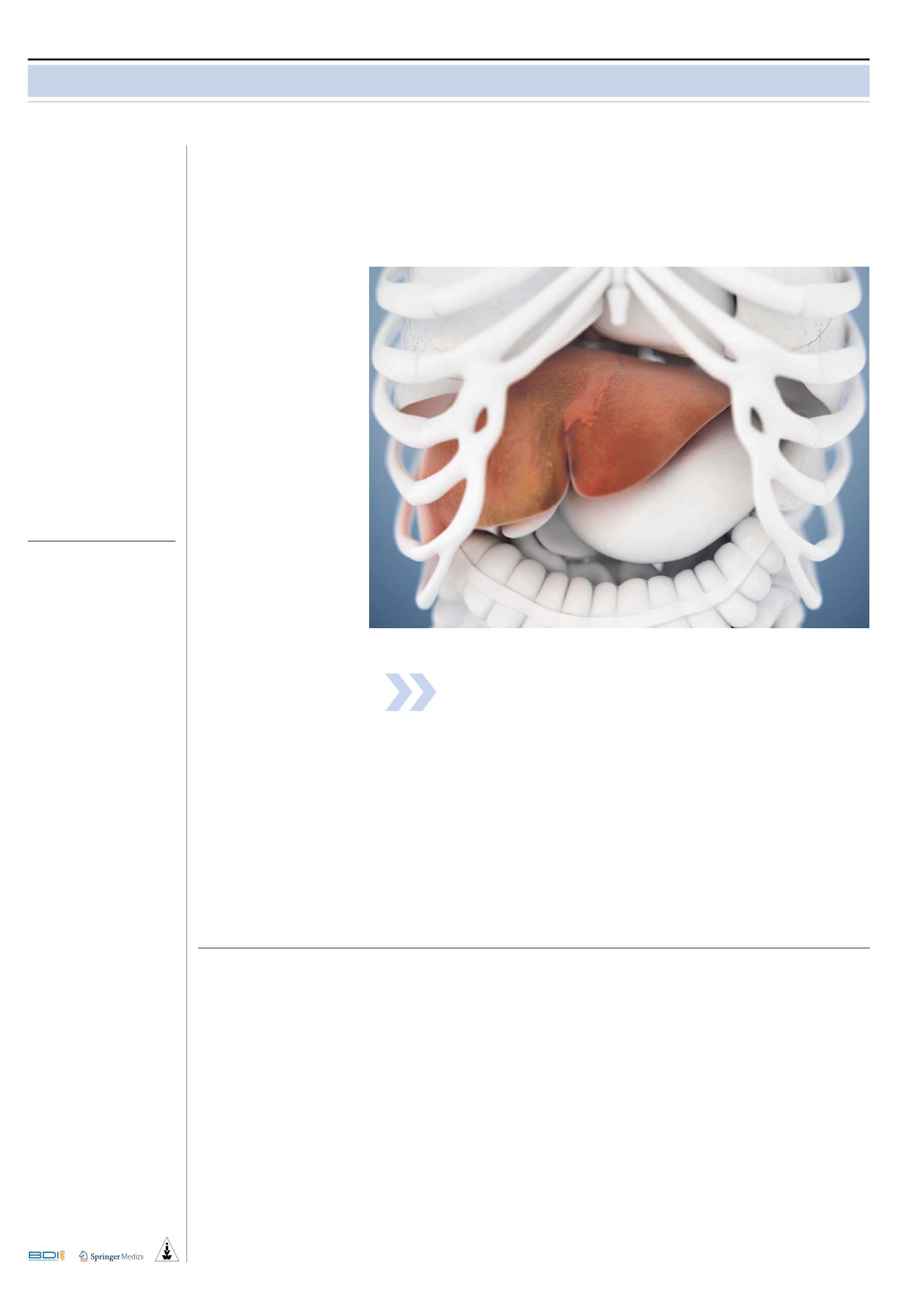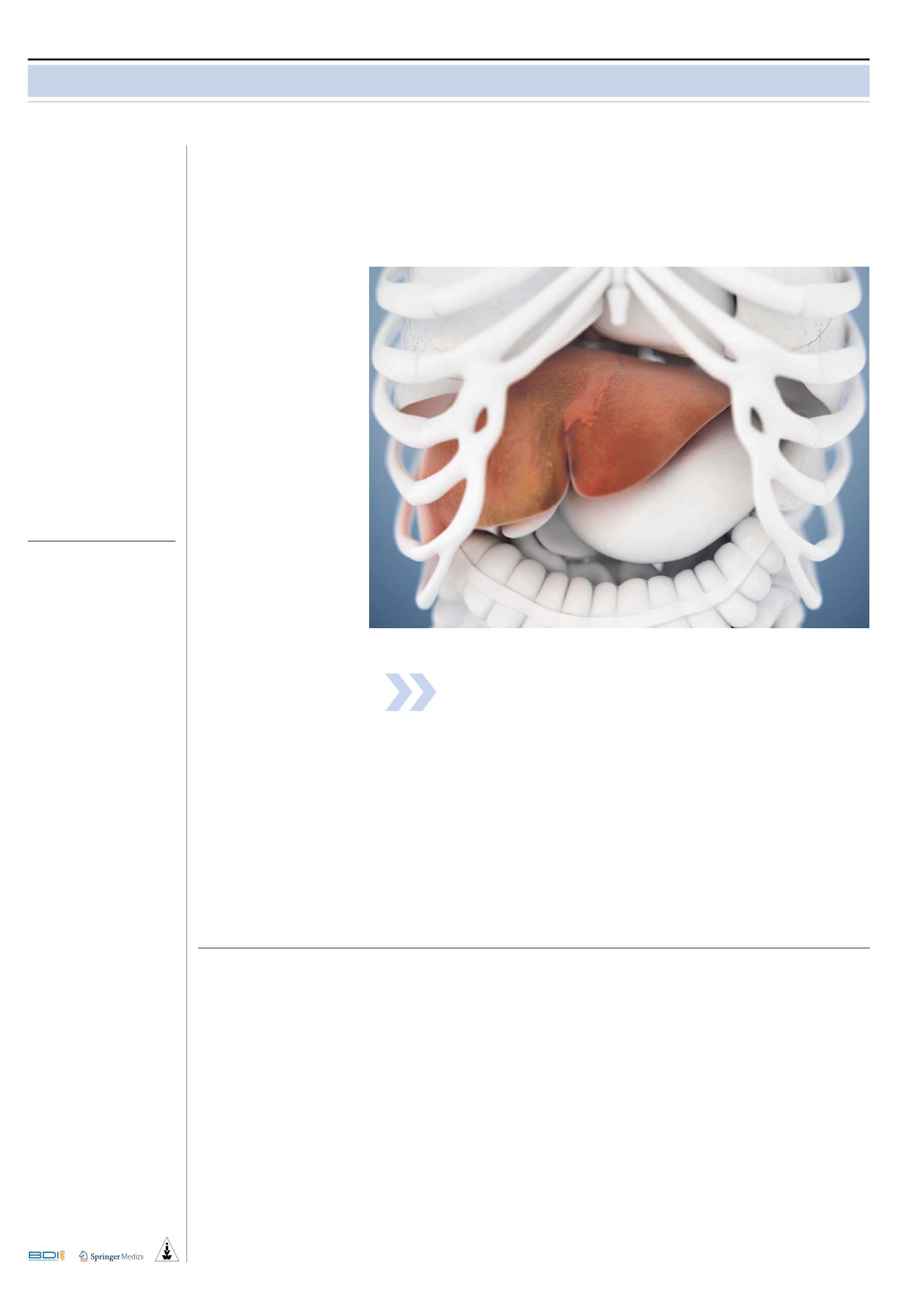
Mit 350 bis 420 Millionen HBsAg-
positiven Personen ist die chronische
HBV-Infektion eine der häufigsten
chronischen
Infektionskrankheiten
weltweit. Die Folgen der chronischen
Erkrankung können bekannterweise
Leberzirrhose oder Leberzellkrebs
(HCC) sein. „Allerdings stellt sich der
natürliche Verlauf sehr variabel dar. So
gibt es HBsAg-positive Personen, die
als inaktive HBsAg-Träger bezeichnet
werden und kein bzw. ein minimales
Risiko für Zirrhose und HCC aufwei-
sen“, so Privatdozent Dr. Markus
Cornberg von der Hepatitis-Akademie
auf springermedizin.de.
Diese HBsAg-Träger haben norma-
le Leberwerte und eine geringe oder
nicht nachweisbare HBV-DNA (Vi-
rusreplikation). Das sei mitunter ein
Grund für die hohe Rate bislang uner-
kannter chronischer HBV-Infektionen
weltweit, aber auch in Deutschland.
Hierzulande gehen Schätzungen
von 400 000 bis 500 000 HBsAg-posi-
tiven Personen aus. Die Annahme be-
ruhe allerdings auf sehr dürftigen epi-
demiologischen Daten. Auf dem Inter-
national Liver Congress (ILC) 2014 in
London wurden Daten von 21 000
Personen einer Leipziger Studie vorge-
stellt, die bei Hausärzten auf HBV und
HCV gescreent wurden, berichtet
Cornberg, Gastroenterologe am Uni-
klinikum der Medizinischen Hoch-
schule Hannover. Die HBsAg-Präva-
lenz läge in dieser Untersuchung bei
0,5 Prozent und damit im Bereich der
Prognosen. Erschreckend wäre aber,
dass nur 16 Prozent der Betroffenen
von ihrer Diagnose wussten. Das be-
deute, dass vermutlich mehr als 80
Prozent der HBsAg-positiven Perso-
nen in Deutschland noch unerkannt
sind. „Hier sollte in Zukunft mehr
Aufmerksamkeit geschaffen werden“,
so Cronberg. Ein HBV-Screening bei
bestimmten Risikofaktoren (auch bei
normalen Leberwerten) könne die Di-
agnoserate erhöhen.
Natürlich könne man die Thera-
pie-Rationale hinterfragen, wenn bei
diesen Personen die Leberwerte nor-
mal sind und in den meisten Fällen
ein inaktiver HBsAg-Trägerstatuts
vorliegt, der nicht behandelt werden
muss. Doch eine Reaktivierung oder
ein Übergang in eine aktive Hepatitis
sei prinzipiell immer möglich. Insbe-
sondere wenn eine Immunsuppression
vorliegt, könnten fulminante Reakti-
vierungen die Folge sein. So gäbe es
inzwischen einen Rote-Hand-Brief,
dass vor einer Therapie mit dem
CD20-Antikörper Rituximab ein
HBV-Screening erfolgen müsse.
Darüber hinaus können Leberwerte
und HBV-DNA im Rahmen einer ak-
tiven Hepatitis B fluktuieren. „Wir
wissen leider noch viel zu wenig über
die Dynamik der chronischen HBV-
Infektion, und Langzeitdaten bei nied-
rig virämischer HBV-Infektion gibt es
kaum, vor allem nicht für Deutsch-
land“, so Cornberg. Daher sei die
Frankfurter ALBATROS-Studie wich-
tig, die diese niedrig virämischen bis-
lang unbehandelten HBV-Patienten
nachverfolgt. Beim ILC 2014 wurden
ersten Daten zum Langzeitverlauf
(bisher maximal vier Jahre) vorgestellt.
Die jährliche HBsAg-Verlustrate liege
hier bei drei Prozent, die Reaktivie-
rung in eine aktive Hepatitis B erfolge
bei etwa zwei Prozent pro Jahr.
(eb)
In Deutschland wissen
viele nicht, dass sie den
Hepatitis B-Virus tragen.
Ist ein Screening sinnvoll?
Viele HBsAg-Positive unerkannt
12
März 2015
BDI aktuell
Medizin
Die chronische Hepatitis Delta
(HBV/HDV-Koinfektion)
ist
die
schwerwiegendste Virushepatitis. Die
Progression zur Leberzirrhose ist
schneller als bei der HBV-Monoinfek-
tion. Das Hepatitis Delta Virus ist
hochinfektiös, braucht allerdings
HBsAg für den Eintritt in die Leber-
zelle; daher tritt die Hepatitis Delta
immer als Koinfektion mit HBV bzw.
bei HBsAg-positiven Personen auf, er-
innert Privatdozent Dr. Markus Corn-
berg von der Hepatitis-Akademie auf
springermedizin.de.
Weltweit sind etwa 15 bis 20 Milli-
onen Menschen anti-HDV positiv. In
einigen Regionen der Erde ist die
chronische Hepatitis Delta hochende-
misch, wie etwa in Pakistan, der Mon-
golei oder dem Amazonasgebiet. In
Deutschland liege die Anzahl der Pati-
enten bei geschätzten 10 000 bis
15 000 Personen.
Die Therapie der chronischen He-
patitis Delta unterscheide sich grund-
legend von der Therapie der chroni-
schen Hepatitis B, so Cornberg von
der Klinik für Gastroenterologie, He-
patologie und Endokrinologie der Me-
dizinischen Hochschule Hannover.
Die bei der HBV-Infektion sehr effek-
tiven
Nukleosid/Nukleotidanaloga
(NUC) haben keinen direkten Einfluss
auf die HDV-Replikation. Die aktuell
einzige therapeutische Option sei die
Behandlung mit Interferon-alpha bzw.
PEG-Interferon-alpha (PEG-IFN).
Die bislang weltweit größte pros-
pektive randomisierte Therapiestudie
wurde im Kompetenznetz Hepatitis
durchgeführt (HIDIT-I Studie) (N
Engl J Med. 2011; 364:322-31). Die
wesentlichen Ergebnisse der Studie
zeigten keinen Vorteil der PEG-
IFN/Adefovir-Kombinationstherapie
im Vergleich zur PEG-IFN/Placebo-
Therapie hinsichtlich der HDV-
RNA-Suppression. Die Kombination
PEG-IFN/Adefovir hätte lediglich ei-
nen stärkeren Effekt auf den Abfall des
quantitativen HBsAg gezeigt.
Aufgrund der Ergebnisse der
HIDIT-I-Studie, dass PEG-IFN/Ade-
fovir zu einem stärkeren HBsAg-Abfall
führte, wurde erneut eine PEG-
IFN/NUC-Kombination gegen PEG-
IFN/Placebo getestet. Die Studie wur-
de auf dem Kongress der European
Association for the study of the liver
(EASL) 2014 vorgestellt. Anstelle von
Adefovir wurde nun die Nachfolge-
substanz Tenofovir eingesetzt. Die Er-
gebnisse (HDV-RNA-negativ am En-
de der Beobachtungszeit) fielen aller-
dings geringer aus als erwartet, berich-
tet Cornberg. Nur 23 bis 30 Prozent
der Patienten waren demzufolge 24
Wochen nach Ende der Therapie
HDV-RNA negativ.
Aufgrund der geringen Ansprech-
rate und der Nebenwirkungen ist die
Therapie der Hepatitis Delta nach
Cornbergs Einschätzung damit weiter-
hin unbefriedigend. Die Therapie mit
NUC schien bislang keinen Effekt auf
den Verlauf der Hepatitis Delta zu ha-
ben. Eine ebenfalls auf dem EASL-
Kongress vorgestellte Arbeit aus Spa-
nien bei HIV/HBV/HDV koinfizierten
Patienten zeige allerdings interessante
Daten, dass nach langjähriger Tenofo-
virtherapie bei einigen Patienten die
HDV-RNA abfällt.
Die Therapie der chronischen He-
patitis Delta bleibe eine der größten
Herausforderungen im Bereich der Vi-
rushepatitis. Neue Therapieoptionen
wie Prenylierungsinhibitoren oder
presS1-Entryinhibitoren bleiben abzu-
warten. „Es bleibt noch viel zu tun,
auch im Bereich der Grundlagenfor-
schung, denn die virologische und im-
munologische Forschung auf dem Ge-
biet der Hepatitis Delta ist bislang un-
zureichend“, so Cornbergs Fazit.
(eb)
Die Hepatitis Delta ist wohl
die schwerwiegendste aller
Virushepatitiden. Einzige
therapeutische Option
ist bislang die Behandlung
mit Interferon-alpha
beziehungsweise PEG-Inter-
feron-alpha.
Hepatitis Delta: Therapie
bleibt eine Herausforderung
Bei der Hepatitis Delta ist die Progression zur Leberzirrhose schneller als bei einer HBV-Monoinfektion.
© SPRINGER VERLAG GMBH
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Die virologische
und immunologi-
sche Forschung auf
dem Gebiet der
Hepatitis Delta ist
bislang unzurei-
chend.
Privatdozent Dr. Markus Cornberg
Klinik für Gastroenterologie,
Hepatologie und Endokrinologie der
Medizinischen Hochschule
Hannover
Myrcludex B blockiere in Zellkultu-
ren und Mausmodellen den Zell-
eintritt von Hepatitis-B- oder D-Vi-
ren. Auch hat es die erste klinische
Phase-I-Studie mit 24 Probanden
ohne substanzassoziierte Neben-
wirkungen bestanden, teilt die Uni-
klinik Heidelberg mit. Die Zwi-
schenergebnisse von Phase-IIb-Stu-
dien belegen, dass die Substanz si-
cher ist und gegen HBV- und
HDV-Infektionen wirkt.
Das Proteinbruchstück aus der
Virushülle schütze Hepatozyten vor
einer Infektion, indem es an die
Leberzelle andocke und damit die
Anheftung der Viren verhindere.
Wie der abgebrochene Bart eines
Schlüssels bleibt das Peptid im
Schlüsselloch stecken und blockiert
es für Viren. Der Rezeptor für das
Virus ist ein Gallensalz-Transpor-
ter, den es als Eintrittskanal nutzt.
Dies könne zur Prävention und bei
persistierender Infektion therapeu-
tisch genutzt werden.
(eb)
Virusblocker
hindert HBV am
Zelleintritt
FORSCHUNG
IMPRESSUM
BDI aktuell wird vom Berufsverband Deutscher
Internisten (BDI) e.V. herausgegeben und erscheint
in der Springer Medizin Verlagsgruppe. Die Zeitung
erscheint monatlich mit Doppelnummer im Au-
gust/September. BDI-Mitglieder erhalten BDI aktuell
im Rahmen ihres BDI-Mitgliedsbeitrags.
Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) e.V.
Schöne Aussicht 5
65193 Wiesbaden
Tel.: 0611/18133-0
Fax: 0611/18133-50
E-Mail:
Präsident: Dr. med. Wolfgang Wesiack
Geschäftsführer: Dipl.-Betrw. (FH) Tilo Radau
Springer Medizin Verlag
Ärzte Zeitung Verlags-GmbH
Am Forsthaus Gravenbruch 5
63263 Neu-Isenburg
Tel.+49 (0)6102 5060,
Fax +49 (0)6102 / 506 203
E-Mail:
Springer Medizin ist Teil der Fachverlagsgruppe
Springer + Science Business Media.
Redaktion:
Chefredakteur: Dr. med. Hans-Friedrich
Spies (HFS). V.i.S.d.P; Tilo Radau (TR)
Mantelteil: Rebekka Höhl; Medizin: Dr. med. Marlinde
Lehmann, Katharina Grzegorek
Kongresse & Services: Michaela Kirkegaard
Herstellung/Layout:
Frank Nikolaczek, Till Schlünz
Kongresse & Services: Schmidt Media, München
Weitere Autoren dieser Ausgabe:
Klaus Schmidt (KS);
Dr. Harald Clade (HC) sowie die namentlich unter den
Artikeln genannten Autorinnen und Autoren
Druck:
ColdsetInnovation Fulda GmbH & Co. KG,
Am Eichenzeller Weg 8, 36124 Eichenzell
Anzeigenleitung:
Michaela Schmitz
Telefon:0 22 03 95 91 31 0
E-Mail:
Kleinanzeigen
schicken Sie bitte an die
BDI-Geschäftsstelle (Adresse s.o.) oder an
Media:
Ute Krille
Telefon: 0 61 02 / 50 61 57,
Telefax: 0 61 02 / 50 61 23
Gültige Anzeigenpreisliste Nr. 7 vom 1.1.2014
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft LA-MED
Leseranalyse medizinischer Zeitschriften e.V.
Wichtiger Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medi-
zin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung
und klinische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnis-
se. insbesondere was Behandlung und medikamen-
töse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Heft eine
Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird, darf der
Leser zwar darauf vertrauen, dass die Autoren und der
Verlag große Sorgfalt daran verwandt haben, dass die-
se Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung der
Zeitung entspricht. Für Angaben über Dosierungsan-
weisungen und Applikationsformen kann vom Verlag
jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jeder Be-
nutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung der
Beipackzettel der verwendeten Präparate und gegebe-
nenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzu-
stellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosie-
rungen oder die Beachtung von Kontraindikationen ge-
genüber der Angabe in dieser Zeitung abweicht. Eine
solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten ver-
wendeten Präparaten oder solchen, die neu auf den
Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Ap-
plikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Auto-
ren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm auf-
fallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen. Ge-
schützte Warennamen werden nicht in jedem Fall be-
sonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines sol-
chen Hinweises kann nicht geschlossen werden, dass
es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright:
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen
einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzun-
gen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.