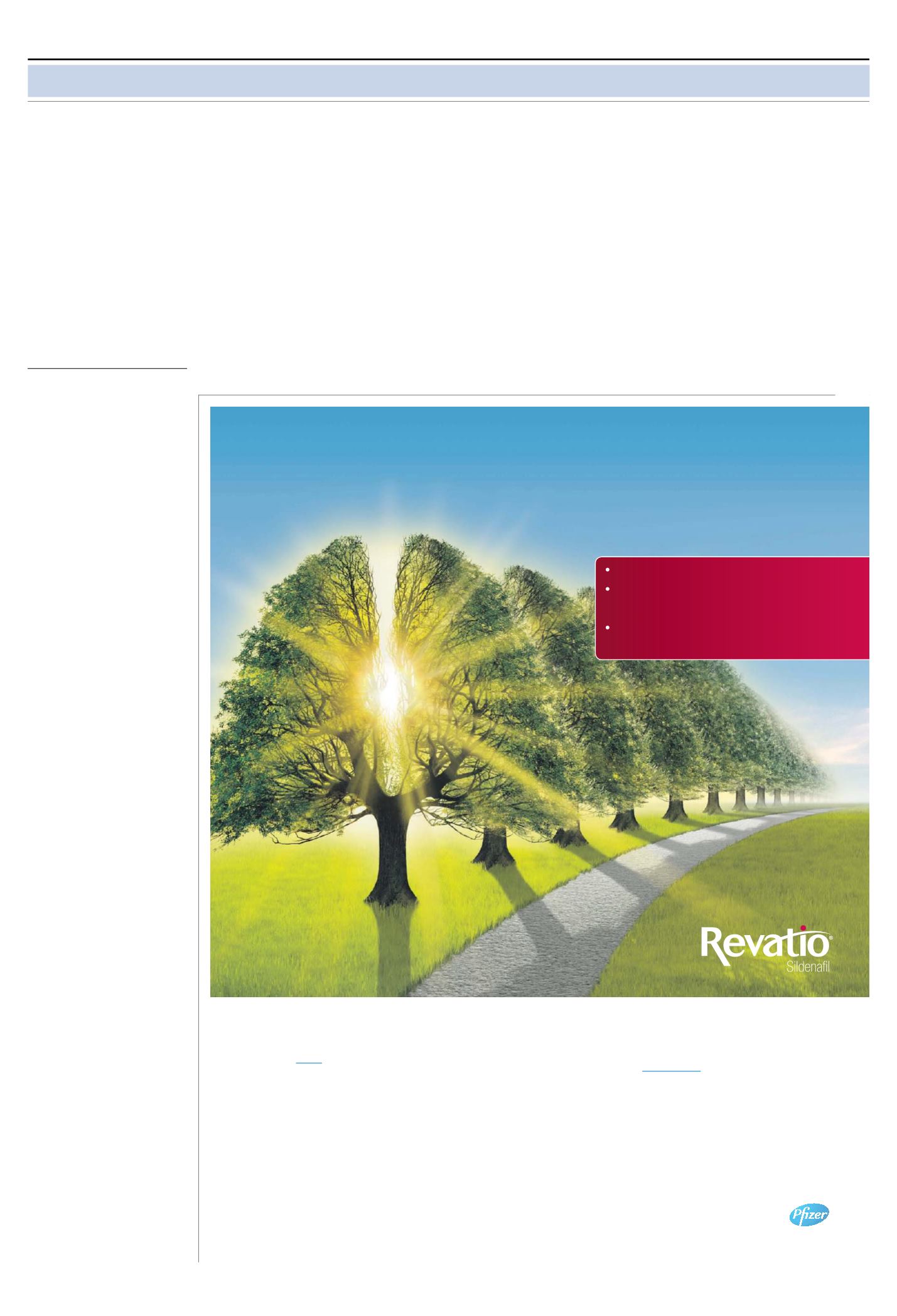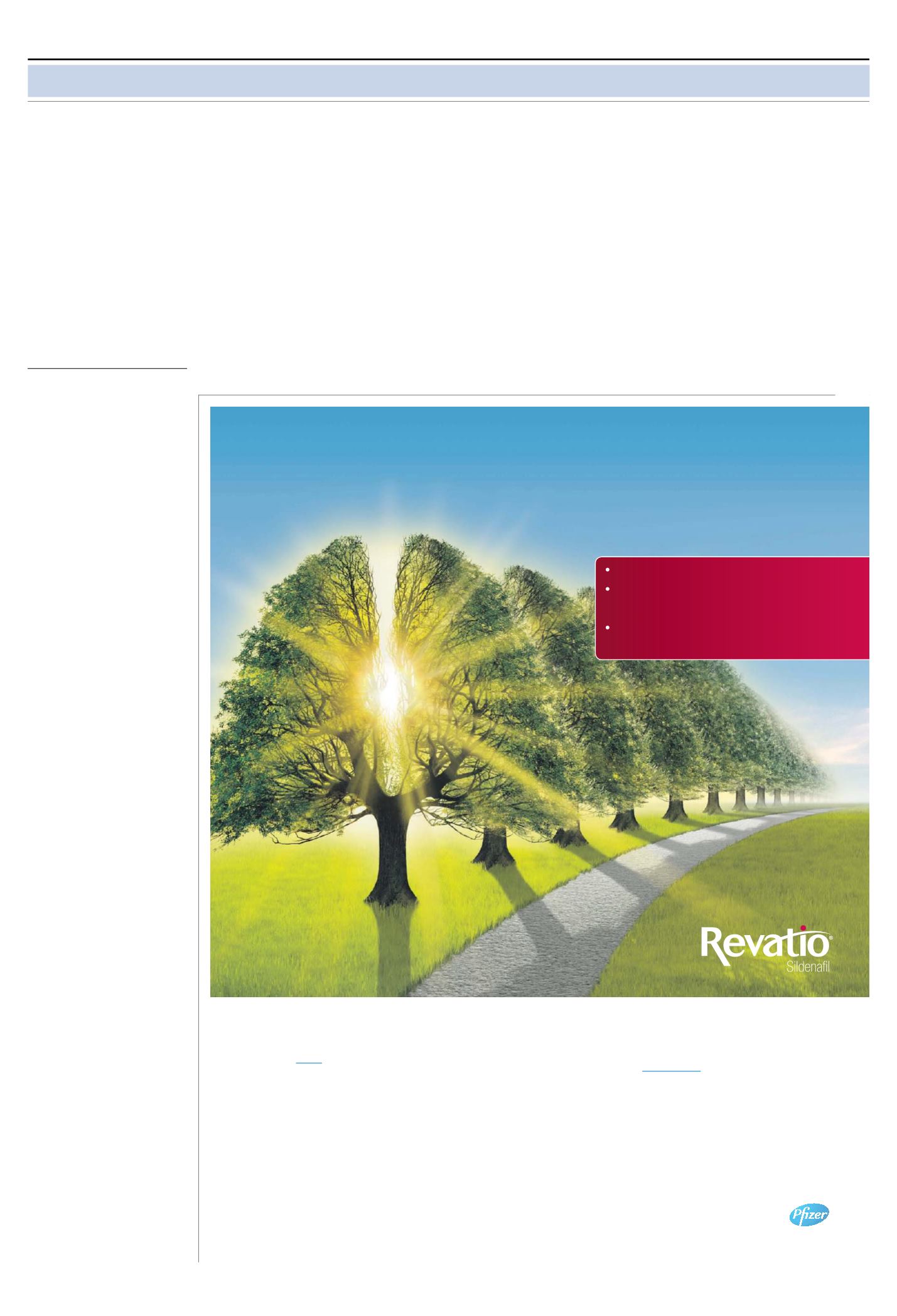
Das Risiko für eine chronische Nieren-
erkrankung (CKD) beziehungsweise
eine Nierenerkrankung im Endstadi-
um sei bei Patienten mit rezidivieren-
dem Nierensteinleiden etwa zweifach
erhöht, sagte die Nephrologin Privat-
dozentin Dr. Nilufar Mohebbi vom
Universitätsspital Zürich in der
Schweiz.
Bei der 6. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Nephrologie in
Berlin berichtete die Zürcher Oberärz-
tin über mehrere Patienten, denen
durch die korrekte Einordnung des
Nierensteinleidens unnötige therapeu-
tische Eingriffe erspart werden konn-
ten.
Messung der Oxalatausscheidung
Eine davon war eine 38 Jahre alte
Patientin, die rezidivierend Kalzium-
oxalatsteine aufwies, sonst aber
klinisch unauffällig war. Die Messung
einer deutlich erhöhten Oxalataus-
scheidung im 24-Stunden-Urin brach-
te die Ärzte auf die richtige Spur: Es
lag eine primäre Hyperoxalurie Typ 1
vor, eine seltene autosomal-rezessive
Erkrankung, die per Gentest definitiv
nachweisbar ist.
Für die Patienten ist eine frühzeiti-
ge Diagnosestellung sehr wichtig, da-
mit im weiteren Verlauf der Erkran-
kung die richtigen Konsequenzen ge-
zogen werden. Durch eine Behand-
lung mit Vitamin B6 lässt sich bei
einigen dieser Patienten die Progressi-
on hin zur Niereninsuffizienz verlang-
samen.
„Bisher wird aber jeder dritte Be-
troffene erst im Stadium der termina-
len Niereninsuffizienz diagnostiziert“,
betonte die Schweizer Nephrologin in
Berlin.
Auch in späteren Stadien der
Erkrankung besteht bei nicht korrekt
diagnostizierten Patienten die Gefahr
falscher Weichenstellungen. So erfolgt
zum Beispiel bei Patienten mit termi-
naler Niereninsuffizienz unter Um-
ständen eine isolierte Nierentransplan-
tation, die das Problem aber nicht löst,
weil der Gendefekt ein Enzym der Le-
ber betrifft. „Hier wäre eine kombi-
nierte Leber-Nieren-Transplantation
zu empfehlen, aber dazu muss die
Diagnose richtig gestellt sein“, so
Mohebbi.
Ein anderer Patient stellte sich in
Zürich im Alter von 42 Jahren mit re-
zidivierender Kalziumoxalat-Nephro-
lithiasis vor. Laborchemisch fiel hier
bei sonst unauffälligem klinischem Be-
fund eine Hyperkalzämie, ein niedrig-
normales Serumphosphat und ein mit
7 pmol/l inadäquat hoher Parathor-
monspiegel auf.
„Die naheliegende Diagnose war
ein primärer Hyperparathyreoidismus.
Wir haben dann aber doch nochmal
etwas genauer hingesehen, bevor wir
den Patienten zum Chirurgen schick-
ten“, berichtete die Zürcher Oberärz-
tin.
Niedrige Kalziumkonzentration
Stutzig gemacht hatte die Ärzte eine
eher niedrige Kalziumkonzentration
im Urin. Es wurde die aussagekräftige-
re Kalzium-/Kreatinin-Clearance-Ra-
tio ermittelt, und die war deutlich er-
niedrigt. Letztlich lag bei diesem Pati-
enten
eine
gutartige
familiäre
hyperkalzämische Hypokalziurie vor.
Das ist eine autosomal-dominante Er-
krankung, die bezüglich der Niere eine
gute Prognose aufweist.
Diesem Patienten sei durch die kor-
rekte Einordnung des Steingeschehens
eine unnötige Parathyroidektomie er-
spart worden, betonte Mohebbi bei
der Tagung in Berlin. Es kann sich al-
so für den Patienten lohnen, wenn der
Arzt bei (rezidivierenden) Nierenstein-
leiden auch mal genauer hinsieht.
An einer chronischen
Niereninsuffizienz sind
Nierensteine nur selten
schuld. Trotzdem sollte
daran gedacht werden.
Mitunter erspart das
unnötige Behandlungen
oder sogar Operationen.
Nierensteine: Tests können Op ersparen
Von Philipp Grätzel von Grätz
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zweifach
erhöht
ist das Risiko für eine
chronische Nierenerkrankung bei
Patienten mit rezidivierendem
Nierensteinleiden.
ANZEIGE
Revatio
®
20 mg Filmtabletten, Revatio
®
0,8 mg/ml Injektionslösung, Revatio
®
10 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen.
Wirkstoff: Sildenafil
Zusammensetzung:
Wirkstoff: Filmtbl.: 1 Filmtbl. enthält 20 mg Sildenafil. Injektionslsg.: 1 ml Injektionslsg. enthält 0,8 mg/ml Sildenafil. Jede Durchstechflasche zu 20 ml enthält 10 mg Sildenafil. Suspension: Nach Zubereitung
enthält jeder ml der Suspension zum Einnehmen 10 mg Sildenafil. Eine Flasche (112 ml) d. zubereiteten Suspension zum Einnehmen enthält 1,12 g Sildenafil. Sonstige Bestandteile: Filmtbl.: mikrokristalline Cellulose, Calciumhydro-
genphosphat, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat; Hypromellose, Titandioxid (E 171), Lactose-Monohydrat, Triacetin. Injektionslsg.: Glucose, Wasser für Injektionszwecke. Suspension: Sorbitol, Citronensäure, wasserfrei,
Sucralose, Natriumcitrat, Xanthangummi, Maltodextrin, Traubensaftkonzentrat, arabisches Gummi, Ananassaftkonzentrat, Citronensäure, natürliche Aromastoffe, Titandioxid (E 171), Natriumbenzoat (E 211), hochdisperses Silicium-
dioxid.
Anwendungsgebiete:
Filmtbl./Suspension: Erw.: Behandl. pulmonaler arterieller Hypertonie (PAH) d. WHO-Fkt.-klassen II u. III zur Verbesser. d. körperl. Leistungsfähigk. D. Wirksamk. konnte nachgewiesen werden b. pri-
märer PAH u. b. pulmonaler Hypertonie in Verbindung m. e. Bindegewebskrankh. Kdr. (1 bis 17 Jahre): Beh. PAH. D. Wirksamk. konnte anhand Verbesser. d. körperl. Belastbark. od. d. pulmonalen Hämodynamik nachgewiesen werden
b. primärer PAH u. b. pulmonaler Hypertonie i. Verbind. m. angeborenen Herzerkrank. Injektionslsg.: Behandl. v. erw. Pat. (
≥
18 Jahre) m. PAH, d. momentan oral appliziertes Revatio verschrieben bekommen haben u. zeitweise nicht
imstande sind, e. orale Ther. durchzuführen, ansonsten aber klin. u. hämodyn. stabil sind.
Gegenanzeigen:
Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandteile. Gleichzeit. Behandl. m. NO- Donatoren u. Nitraten
(hypotens. Effekte) i. jeder Form (z.B. Amylnitrit); Komb. m. d. stärksten CYP3A4-Hemmern (z.B. Ketoconazol, Itraconazol, Ritonavir); Pat. m. e. nicht arteriitischen anterioren ischäm. Optikusneuropathie (NAION) i. d. Anamnese;
schwere Leberinsuff.; kürzl. erlittener Schlaganfall od. Herzinfarkt; Hypotonie (Blutdruck < 90/50 mmHg) b. Behandlungsbeginn.
Nebenwirkungen:
Filmtab./Injektionslsg./Suspension: Sehr häufig: Kopfschm.; Flush; Durchfall,
Dyspepsie; Gliederschm. Häufig: Cellulitis, Grippe, Bronchitis, Sinusitis, Rhinitis, Gastroenteritis; Anämie; Flüssigkeitsretent.; Schlaflosigk., Angst; Migräne, Tremor, Parästhesie, Brennen, Hypästhesie; Retinablut., Sehstör.,
verschwommenes Sehen, Photophobie, Chromopsie, Zyanopsie, Augenreiz., okuläre Hyperämie; Vertigo; Nasenbluten, Husten, Nasenschleimhautschwell.; Gastritis, gastroösophag. Reflux, Hämorrhoiden, abdom. Spannungsgefühl,
Mundtrockenh.; Alopezie, Erythem, nächtl. Schweißausbrüche; Myalgie, Rückenschm.; Fieber. Gelegentlich: vermind. Sehschärfe, Doppeltsehen, Fremdkörpergefühl im Auge; Hämaturie; Penisblut., Hämatospermie, Gynäkomastie;.
Häufigkeit nicht bekannt: NAION, Verschluss v. Netzhautgefäßen, Gesichtsfelddefekte; plötzl. Hörverlust; Hypotonie; Ausschlag; Priapismus, vermehrte Erektionen. Injektionslsg.: zusätzl. Bläh. u. Hitzewallungen; 1 Pat. mit schwerer
ischäm. Kardiomyopathie (kein kausaler Zusammenhang angenommen). Filmtbl./Suspension: Kdr. u. Jugendl. (1 bis 17 Jahre): D. beobachtete Nebenwirkungsprofil entsprach i. Allg. d. b. Erw. zusätzlich traten folgende Nebenwirk.
auf: Inf. d. oberen Atemwege, Übelk., Pharyngitis, Rhinorrhö, Pneumonie.
Warnhinweise:
Filmtbl.: enthäl Lactose: Nicht einnehmen b. hereditärer Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel, Glucose-Galactose-Malabsorption.
Suspension: enthält Sorbitol: Nicht einnehmen b. hereditärer Fructose-Intoleranz. Weitere Informationen s. Fach- u. Gebrauchsinformation.
Abgabestatus:
Verschreibungspflichtig.
Pharmazeutischer Unternehmer:
PFIZER Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Vereinigtes Königreich.
Repräsentant in Deutschland:
PFIZER PHARMA GmbH, 10785 Berlin.
Stand:
Mai 2014.
1
Fachinformation Revatio
®
20 mg Filmtabletten, Revatio
®
0,8 mg/ml Injektionslösung, Revatio
®
10 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
2
IMS Worldwide Sales Volume, Q2 2005 to Q1 2014
*Revatio
®
20 mg Filmtabletten, Revatio
®
10 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen.
Revatio
®
: PAH-Therapie
für
heute UND morgen
1
Mehr als 300.000 Patientenjahre an Erfahrung
2
Von Anfang an.
b-4v20ro-0-0
FC II und III
1
Zulassung bei Kindern
(1–17 Jahre)*
Tabletten, Suspension und
Injektionslösung
1
Medizin
BDI aktuell
März 2015
11
Wissenschaftler des Universitätsklini-
kums Heidelberg und des Europäi-
schen Laboratoriums für Molekular-
biologie (EMBL) haben an Mäusen
einen Signalweg entdeckt, der bei der
Entstehung der Anämie eine wichtige
Rolle spielt (Blood 2015; online 6. Fe-
bruar). Wird dieser Mechanismus –
bei dem zwei Bakterien-Detektoren
des Immunsystems, die Eiweiße TLR2
und TLR6, eine Schlüsselrolle spielen
– in bestimmten Zellen des Immun-
systems aktiviert, bunkern sie ab sofort
alles Eisen, das sie aufnehmen. Was
zunächst dazu dient, die Krankheitser-
reger auszuhungern, schadet schließ-
lich auch dem eigenen Körper. Das
Eisen steht nämlich auch nicht mehr
für die Bildung des Hämoglobins zur
Verfügung.
(eb)
Wie der Körper
Krankheitserreger
„aushungert“
IMMUNOLOGIE