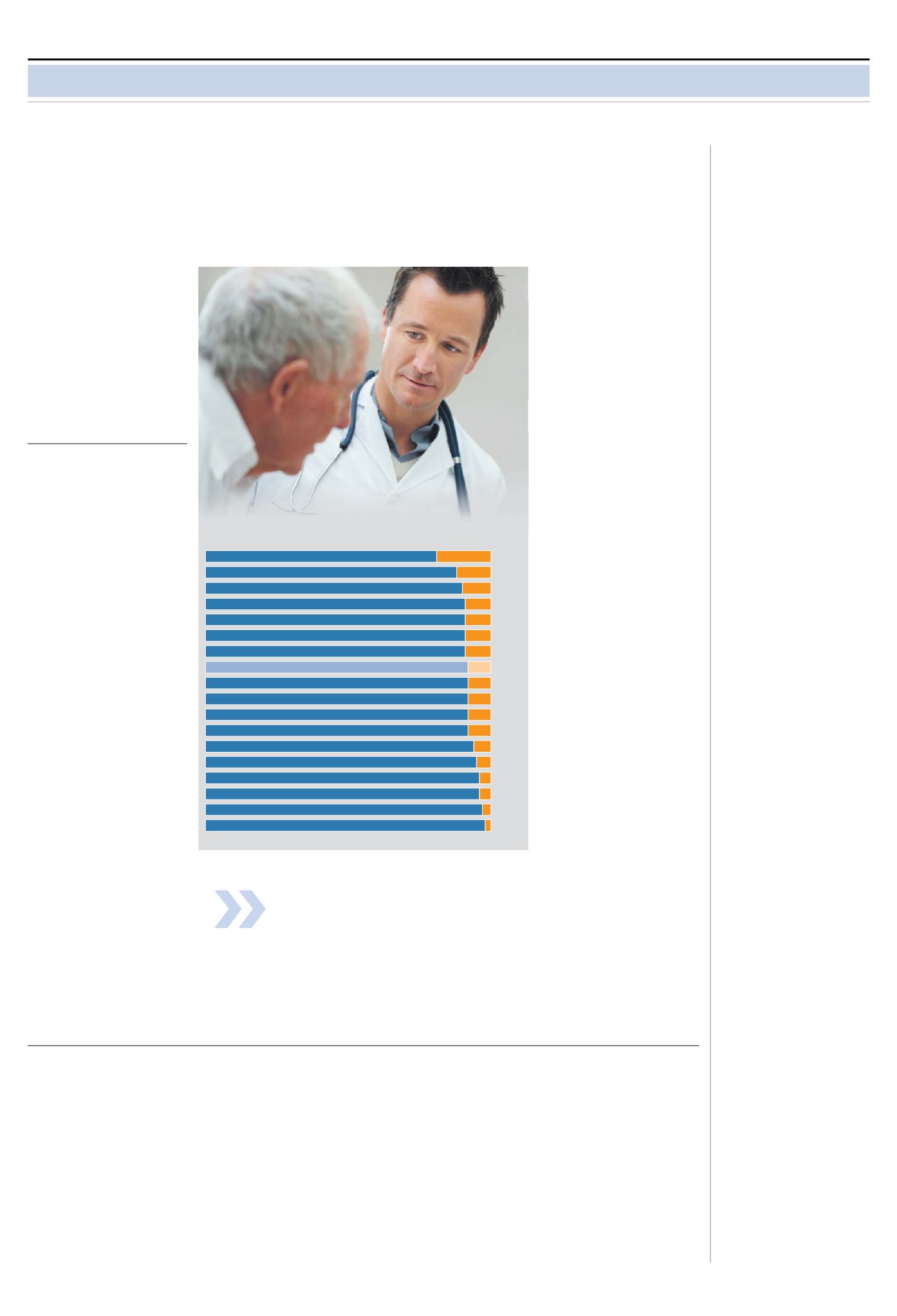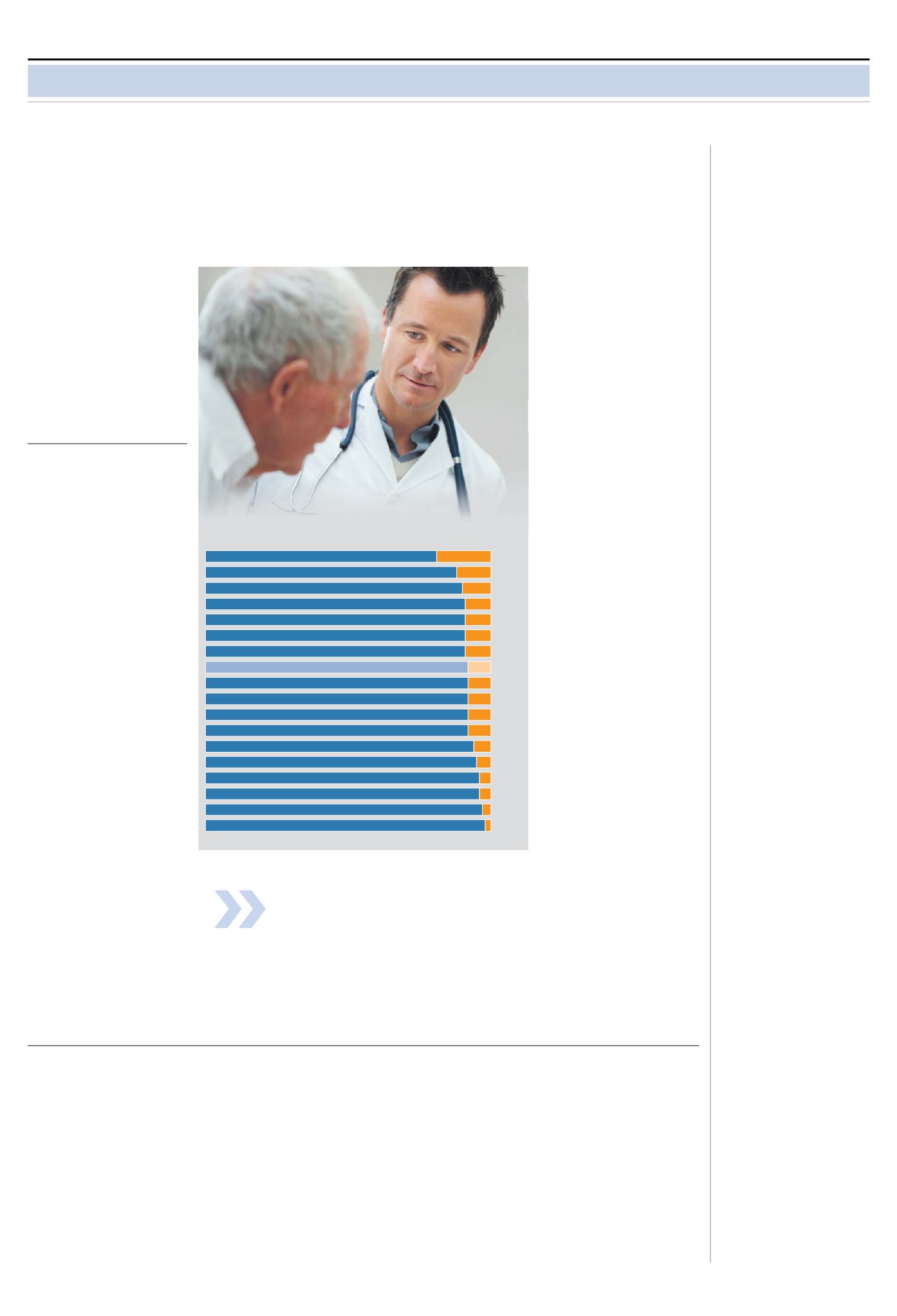
Der Bundesrat hat sich das oft strittige
Thema der zweckmäßigen Vergleichs-
therapie vorgenommen. Ganz konkret
hat die Länderkammer in ihrer Sitzung
am 6. Februar vorgeschlagen, die Ver-
gleichstherapie solle „im Einverneh-
men“ zwischen dem Bundesausschuss
und dem Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM) und
dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) festge-
legt werden. Damit folgte das Plenum
einem entsprechenden Vorschlag des
Gesundheitsausschusses.
Paragraf 35 Absatz 7 SGB V sieht
bislang lediglich vor, dass Hersteller
vor Beginn von Phase-III-Studien
vom Gemeinsamen Bundesausschuss
(GBA) unter Beteiligung der Zulas-
sungsbehörden beraten werden. Ge-
ändert werden soll nach dem Willen
des Bundesrats auch ein Passus in der
Nutzenverordnung. Paragraf 6 Absatz
1 sollte danach festlegen, dass die Ver-
gleichstherapie „regelhaft“ nach Maß-
stäben zu bestimmen ist, die sich aus
den internationalen Standards der evi-
denzbasierten Medizin ergeben.
Außerdem bittet der Bundesrat, im
Rahmen des Pharma-Dialogs zu prü-
fen, ob Arzneimittel in vernachlässig-
ten Anwendungsgebieten besser ge-
stellt werden können. Konkret werden
Antibiotika erwähnt.
Geprüft werden soll nach dem Wil-
len der Länderkammer auch, ob die
Nutzenbewertung neuer Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden
(NUB) mit Medizinprodukten hoher
Risikoklasse „den Branchenbesonder-
heiten der Medizintechnik gerecht
wird“. Erreicht werden soll, dass die
Nutzenbewertung nach Paragraf 137h
SGB V sich auf „klar definierte, neue
Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden mit hohem Risikopotenzial“
beschränkt. Dabei müsse sichergestellt
werden, dass Kliniken „schnell und
flächendeckend“ Zugang zu diesen
neuen Methoden bekommen.
(fst)
Der Bundesrat will das Ver-
fahren der frühen Nutzen-
bewertung von neuen
Arzneimitteln reformieren.
Nutzenbewertung: BfArM soll stärker mitwirken
Eine hochwertige Patientenversor-
gung benötigt medizinischen Fort-
schritt und wissenschaftlich versier-
te Ärzte. Eine Tatsache, die Ge-
sundheitspolitiker, Wissenschafts-
ministerien und Klinikgeschäftsfüh-
rer wohl kommentarlos unterschrei-
ben würden. Dennoch scheinen die
Rahmenbedingungen für eine eben-
falls hochwertige Forschung zumin-
dest für den ärztlichen Nachwuchs
nicht zu stimmen. Und daran sind,
wie ein Positionspapier „gegen den
Attraktivitätsverlust der akademi-
schen Forschung“ des Bündnisses
Junge Ärzte (BJÄ) zeigt, auch die
engen finanziellen Budgets Schuld.
Schluss mit Zweckentfremdung
Immer mehr junge Ärzte würden
sich gegen eine akademische Lauf-
bahn oder für die Forschung im
Ausland entscheiden. – Weil neben
den hohen bürokratischen Hürden
und fehlender Work-Life-Balance
die Vergütung den nicht-klinischen
Angestelltenverhältnissen hinterher-
hinke. Das BJÄ fordert von der Ge-
sundheitspolitik deshalb, der chro-
nischen Unterfinanzierung der aka-
demischen Krankenhäuser entge-
genzuwirken. Kliniken, die Sonder-
aufgaben im Bereich von For-
schung sowie Aus- und Weiterbil-
dung einnehmen, müsse durch eine
adäquate Abbildung und Bewer-
tung ihrer Leistungen insbesondere
im DRG-Katalog ein ausgegliche-
ner Haushalt ermöglicht werden.
Dies sei auch nötig, damit kein Be-
darf mehr bestehe, „für die For-
schung gedachte Mittel zweckent-
fremdet einzusetzen“, heißt es.
An die Wissenschaftsministerien
gerichtet, wünschen sich die Jungen
Ärzte eine äquivalente Bezahlung
von klinisch und wissenschaftlich
tätigen Ärzten und mehr For-
schungsstellen. Aber auch die Ge-
schäftsführer der Kliniken sehen die
Jungen Ärzte durchaus in der
Pflicht. Insbesondere die zuneh-
mende ökonomische Ausrichtung
der Kliniken wird moniert. Der
ökonomische Druck dürfe nicht zu
einer Marginalisierung von Wissen-
schaft und Forschung an den Klini-
ken führen. Und: Es dürfe keine
Quersubvention der Patientenver-
sorgung durch Drittmittel erfolgen.
Baustein in der Weiterbildung
Der ärztliche Nachwuchs will aber
auch weg von der „Forschung in
der Freizeit“. Es müsse eine flä-
chendeckende Anerkennung von
Forschungszeiten als fakultativer
Inhalt der Facharztweiterbildung
geben. Konkret schwebt dem BJÄ
vor, dass bis zu 12 Monate wissen-
schaftliche Tätigkeit als Weiterbil-
dungszeit anerkannt werden.
Außerdem wollen die Jungen
Ärzte an der Bürokratie-Schraube
drehen: Ziel sollte es sein, dass kein
Antragsformular in der Forschung
mehr als drei Seiten umfasse und
nicht mehr als 10 Prozent der Ar-
beitszeit für bürokratische Aufgaben
verwendet werden müssen.
(reh)
Junge Ärzte
fordern bessere
Bedingungen ein
In einem Positionspapier
kritisiert das Bündnis
Junge Ärzte nicht nur die
knappe finanzielle Aus-
stattung der Unikliniken.
Sondern auch die nach
wie vor schlechten
Arbeitsbedingungen der
Nachwuchsforscher.
KLINISCHE FORSCHUNG
Berufspolitik
BDI aktuell
März 2015
9
Einen Webfehler in der Gesetzgebung
der Regierungskoalition will die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV)
ausgemacht haben. Das Versorgungs-
stärkungsgesetz, so wie es bislang for-
muliert sei, versetze die Vertragspartner
nicht in die Lage, regionalen Versor-
gungsnotwendigkeiten gerecht zu wer-
den, sagte KBV-Vorstandsvorsitzender
Dr. Andreas Gassen Anfang Februar in
Berlin.
Der Paragraf 87a sieht vor, dass
Regionen, deren morbiditätsorientier-
te Gesamtvergütung (MGV) je Versi-
cherten unter dem Bundesschnitt
liegt, für das Jahr 2016 einen Vergü-
tungsaufschlag bis zur Höhe des
Durchschnittswerts verhandeln kön-
nen sollen. Damit hat die Koalition
ein Urteil des Bundessozialgerichts
vom August 2014 aufgegriffen. Das
hatte festgestellt, dass die bisherigen
Regelungen aus dem GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz von 2007 und
dem Versorgungsstrukturgesetz von
2012 keine rechtlichen Möglichkeiten
eröffneten, eine grundsätzliche Anpas-
sung der Gesamtvergütung vorzuneh-
men.
Versorgungsbedarf besser abbilden
Die findet die KBV-Spitze auch im
Versorgungsstärkungsgesetz
noch
nicht. „Dieser Lösungsansatz ist unzu-
reichend“, sagte Gassen. Grund: Das
Zentralinstitut für die kassenärztliche
Versorgung (Zi) ist in einer Untersu-
chung zu dem Ergebnis gekommen,
dass die morbiditätsorientierte Ge-
samtvergütung in allen Regionen die
Menge der tatsächlich erbrachten
ärztlichen Leistungen unterschreitet
(siehe Grafik). „Die regionalen Unter-
schiede kommen nicht wegen der
Preiskomponente zustande, sondern
durch die Mengenkomponente“ sagte
Dominik von Stillfried, der Leiter des
Zentralinstituts.
Diese Form der Budgetierung wir-
ke sich direkt auf die Versorgung aus,
warnte der KBV-Chef. „Der richtige
Weg, die besten Köpfe für die ärztli-
che Versorgung zu gewinnen, führt
über feste Preise für die Leistungen
von Vertragsärzten“, sagte Gassen.
Die ließen sich am besten erreichen,
wenn die prospektiven Mengenverein-
barungen abgeschafft würden. Besser
sei es, die Vergütung regional anhand
des tatsächlichen Versorgungsbedarfes
zu organisieren.
Derzeit wird – laut der Rechnung
des Zi – ein Teil des eigentlich von den
Kassen zu tragenden Morbiditätsrisikos
allerdings nach wie vor bei den Ver-
tragsärzten abgeladen. Im Schnitt wür-
den knapp zehn Prozent der vertrags-
ärztlichen Leistungen von den Kassen
nicht gegenfinanziert. Besonders krass
fällt das Missverhältnis zwischen der
für die kassenärztliche Versorgung er-
brachten Leistung und der MGV in
den Stadtstaaten Hamburg (19 Prozent
der erbrachten Leistungen werden
nicht vergütet) und Berlin (12 Prozent
werden nicht vergütet) aus. Sich an den
Schnitt heranverhandeln dürften nach
der bislang vorgesehenen Regelung
aber nur Westfalen-Lippe und Nord-
rhein, Hessen, Schleswig-Holstein und
Sachsen-Anhalt. Nur dort liegt aus-
weislich der Zi-Untersuchung die
MGV unter dem Bundesdurchschnitt
von 336,57 Euro je Versicherten.
Kassen haben kein Verständnis
Wenig Gegenliebe erzeugt der Vor-
schlag der KBV bei den Kassen. „Sol-
len alle Leistungen in die Kalkulation
einbezogen werden, wie es die KBV
nun vorschlägt, müsste entsprechend
der Orientierungswert abgesenkt wer-
den“, erklärt der GKV-Spitzenver-
band. Die Versorgung der Patienten
sei sichergestellt, so der Spitzenver-
band weiter. Vor dem Hintergrund
der regionalen Versorgungsstruktur
würden die tatsächlich von den Versi-
cherten in Anspruch genommenen
Leistungen von den Kassen über die
Gesamtvergütung finanziert. Es sei
falsch, dass unter den aktuellen Bud-
gets knapp zehn Prozent der erbrach-
ten vertragsärztlichen Leistungen
nicht gegenfinanziert würden. Die
Fehlinterpretation resultiere aus der
Verwechslung von vereinbarter Ge-
samtvergütung mit der preislichen Be-
wertung der vereinbarten oder abge-
rechneten Leistung, heißt es in der
Stellungnahme. Noch 2008 habe die
KBV das Ziel verfolgt, einen hohen
Preis (Orientierungswert) für die ärzt-
liche Leistung festzulegen.
Die KBV schlägt vor, den Versor-
gungsbedarf nicht an einem Bundes-
durchschnitt, sondern nach harten
Kriterien zu bewerten. Einfließen soll-
te demnach die regionale Versicher-
tenstruktur, die Arbeitsteilung zwi-
schen ambulantem und stationärem
Sektor und regionale Versorgungsziele
mit präventiven Ansätzen.
KBV: Gesetzgeber belastet Ärzte
mit Morbiditätsrisiken
Die Kassenärztliche
Bundesvereinigung nutzt
die Beratungsphase des
Versorgungsstärkungsgeset-
zes, um an der Honorar-
schraube zu drehen. Dabei
geht es vor allem darum,
dass die Vertragsärzte nicht
länger einen Teil des Morbi-
ditätsrisikos tragen wollen.
Von Anno Fricke
Quelle: KBV © Yuri Arcurs / fotolia.com Grafik: BDI aktuell
Anteil der kassenärztlichen Leistungen, die aus der morbiditätsorientierten
Gesamtvergütung
nicht bezahlt
werden
Ärzte leisten mehr, als ihnen vergütet wird
Hamburg
Berlin
Nordrhein
Hessen
Niedersachsen
Schleswig-Holstein
Bundesdurchschnitt
Baden-Württemberg
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Bremen
Thüringen
Bayern
Rheinland-Pfalz
Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
Westfalen-Lippe
6%
19%
12%
10%
9%
9%
9%
8%
8%
8%
8%
8%
5%
4%
4%
3%
2%
9%
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Unter den aktuellen Budgets werden knapp
zehn Prozent der vertragsärztlichen Leistungen
von den Kassen nicht gegenfinanziert.
Dr. Andreas Gassen
Vorstandsvorsitzender der KBV