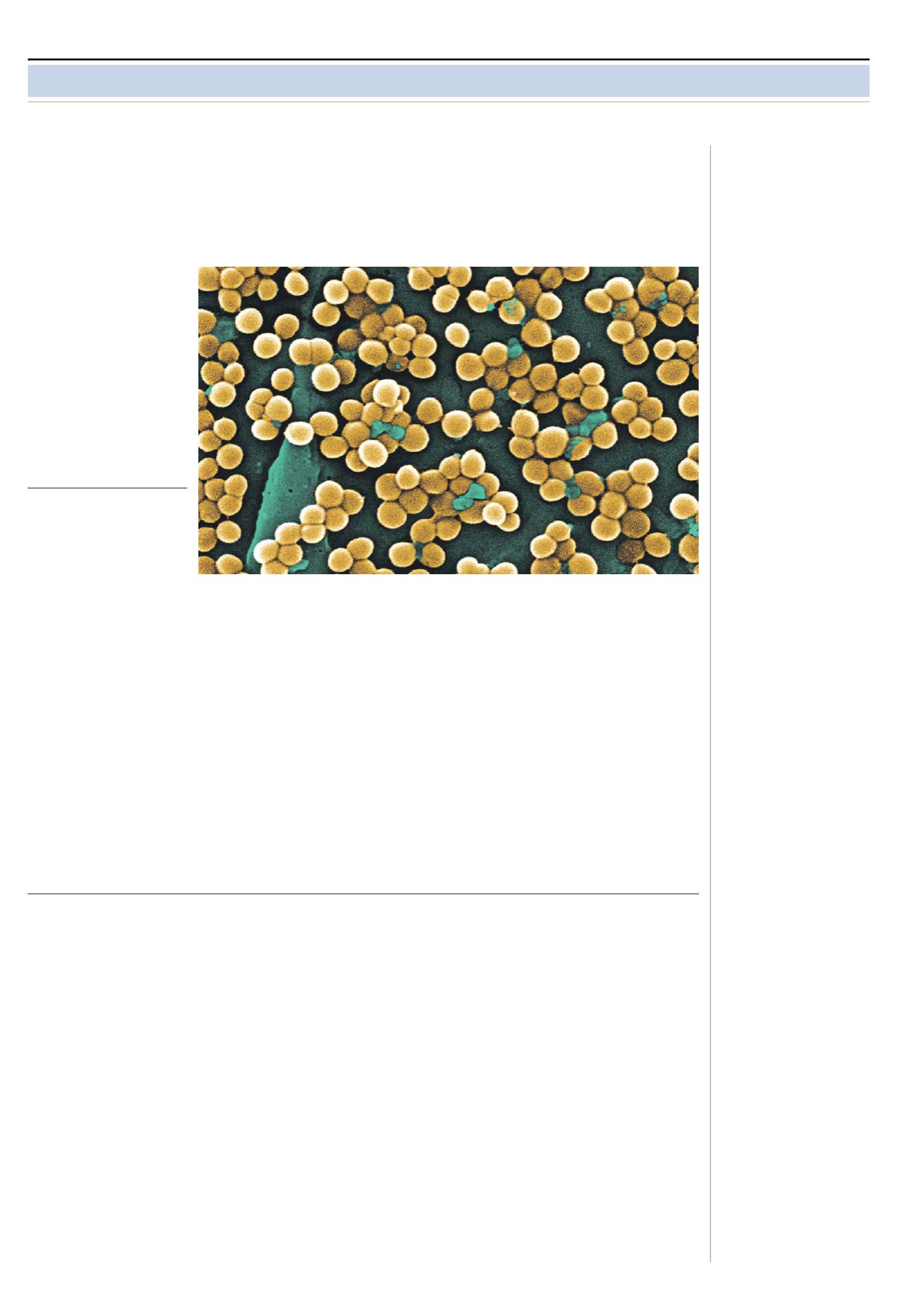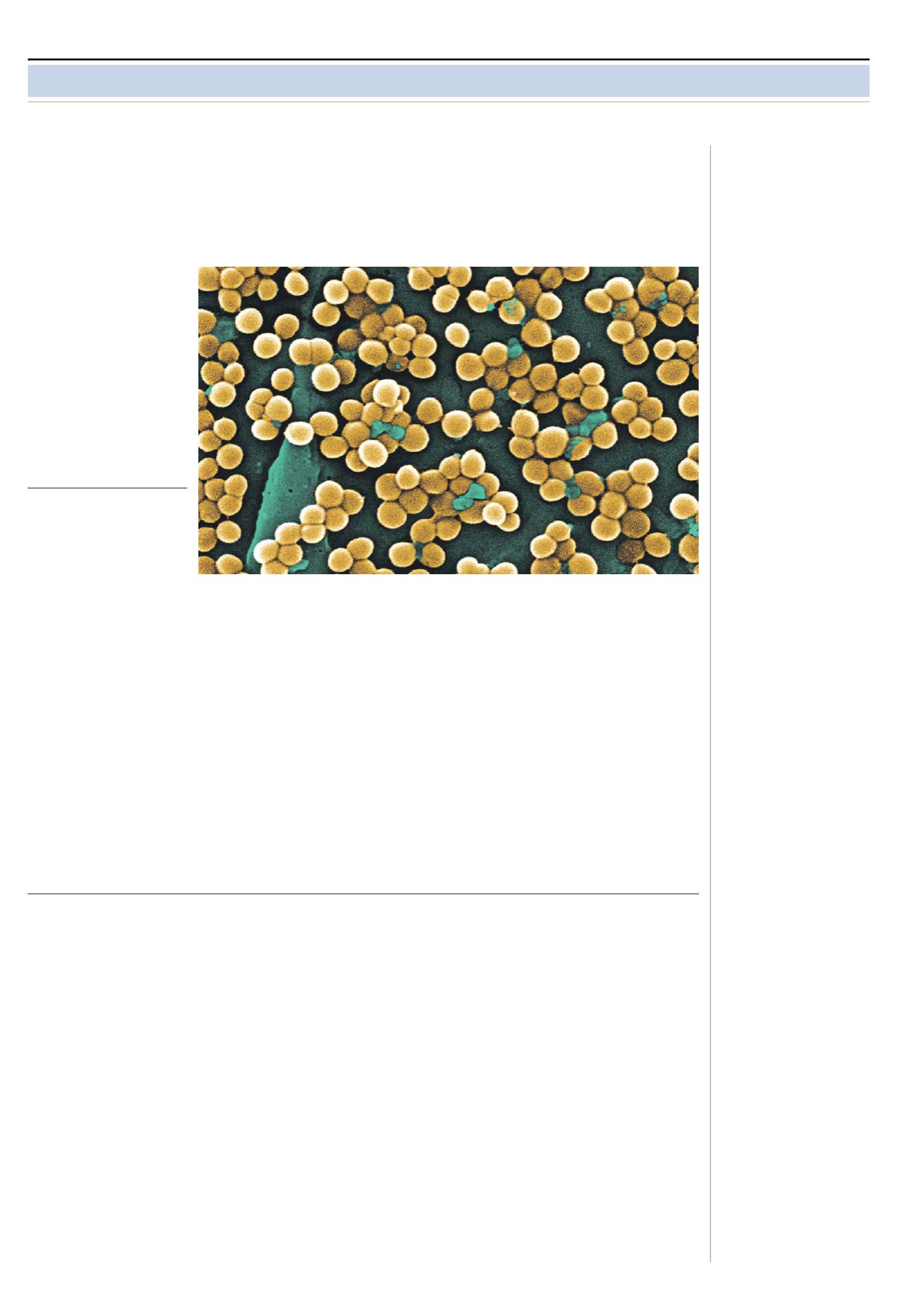
Infektionen mit invasiven pathogenen
Pilzen stellen Kliniker weltweit vor
enorme Herausforderungen, fordern
sie doch zahlreiche Todesopfer und
verursachen medizinische Gesamtkos-
ten in dreistelliger Milliardenhöhe.
Das Heimtückische an Mykosen ist je-
doch, dass oft nicht der Pilzerreger
selbst zum Tod führt, sondern die
überschießende entzündliche Immun-
antwort der Patienten. Die molekulare
Entschlüsselung der Mechanismen,
die zu diesen Entzündungsreaktionen
führen, sind daher essenziell, um bes-
sere und effizientere antifungale The-
rapien entwickeln zu können.
Die Arbeitsgruppe von Professor
Karl Kuchler in den Max F. Perutz
Laboratories (MFPL) der Universität
Wien und der Medizinischen Univer-
sität Wien (MedUni Wien) hat nun
ein neues Signalmolekül entdeckt,
welches massiv die Entwicklung der
lebensbedrohlichen
entzündlichen
Sepsis reguliert (PLoS Pathog 2014;
online 4. Dezember), heißt es in einer
Mitteilung der MedUni Wien. Diese
Arbeit lege auch die Grundlage für ei-
ne neue Behandlungsmethode bei be-
troffenen Patienten: Die pharmakolo-
gische Blockade dieses Signalmoleküls
bewirke bei invasiven Pilzinfektionen
in einem Tiermodell eine massive Re-
duktion der Entzündung und Sepsis
und ermögliche es dem Immunsystem,
die Infektion zu neutralisieren.
„Wir konnten erstmals zeigen, dass
dieses intrazelluläre Molekül an der
Regulierung der Entzündungsreaktion
im Wirt beteiligt ist“, wird Kuchler in
der Mitteilung zitiert.
„Man vermutete schon lange, dass
dieses Signalmolekül im Immunsys-
tem eine Rolle spielen muss, da es in
nahezu jeder Zelle des Immunsystems
vorkommt“. Wir waren selbst erstaunt,
dass dieses Molekül als ein Relais
wirkt und die Entzündungsreaktionen
bei invasiven Pilzinfektionen über die-
ses Molekül gestartet wird.“
In der Studie konnten die Autoren
zeigen, dass das Signalmolekül, ein
Mitglied der Familie der Tec-Kinasen,
die Aktivierung eines erst kürzlich ent-
deckten Multiprotein-Komplexes (In-
flammasom) reguliert.
Das Inflammasom ist einer der
wichtigsten molekularen Schalter der
entzündlichen Immunantwort. Außer-
dem konnten die Wissenschaftler den
kompletten Signalweg entschlüsseln,
in dem der Signalüberträger wirkt.
Durch die Verabreichung eines Medi-
kaments, das die Kinase chemisch blo-
ckiert, konnte die Sepsis in einem
Mausmodell dramatisch reduziert wer-
den. Somit gelang es erstmals, die ho-
he Sterblichkeitsrate von invasiven
Mykosen zu reduzieren.
„Der chemische Inhibitor des Sig-
nalüberträgers ist nicht ganz unbe-
kannt, da er bereits für die Therapie
maligner Erkrankungen in klinischen
Phasen getestet wird und unmittelbar
vor der Zulassung steht“, erklärt Flori-
an Zwolanek, Erstautor der Studie in
der Mitteilung der Universität. „Die
bisherigen Studienergebnisse waren
bereits sehr positiv. Dass die Wirkung
dieser Substanz jedoch auch bei Infek-
tionskrankheiten eine so erfreuliche
sein würde, hätten selbst wir nicht er-
wartet.“
Diese Ergebnisse könnten die Su-
che nach neuen Behandlungsmöglich-
ketien bei invasiven Infektionskrank-
heiten erleichtern. Die Entdeckung
könnte auch einen Paradigmenwechsel
in der Behandlung von mikrobiellen
Infektionskrankheiten einleiten. Klini-
sche antifungale Therapien könnten
statt wie bisher üblich den Pilzerreger
selbst, vor allem die überschießende
entzündliche Immunantwort der Pati-
enten regulieren. Somit kann die Sep-
sis stark verzögert oder gar verhindert
werden.
(eb)
Wissenschaftler haben ein
Signalmolekül aufgespürt,
das die Entstehung ent-
zündlicher Immunreaktio-
nen bei Mykosen reguliert.
Die Entdeckung dieses
„Starters“ könnte Potenzial
für die Entwicklung neuer
antifungaler Medikamente
haben.
Mykosen: Signalmolekül startet die Sepsis
Die meisten Zellen des Blutes stam-
men bekannterweise von Stammzel-
len im Knochenmark ab. Makro-
phagen bilden hier anscheinend ei-
ne Ausnahme. Wissenschaftler des
Deutschen Krebsforschungszent-
rums (DKFZ) in Heidelberg haben
gemeinsam mit Kollegen vom eng-
lischen Kings College herausgefun-
den, dass die Ursprünge der meis-
ten Makrophagen im Dottersack
liegen von dem aus Vorläuferzellen
der Makrophagen die verschiede-
nen Gewebe besiedeln. Dort erneu-
ern sie sich selbst. Erst bei Entzün-
dungen und anderen krankhaften
Prozessen werden Makrophagen
aus dem Knochenmark ergänzt
(Nature 2014, online 3. Dezem-
ber).
Vorläufer aus dem Dottersack
Die Forscher markierten Vorläufer-
zellen mit einem fluoreszierenden
Protein, um verfolgen zu können,
wann während der Entwicklung die
Makrophagen entstehen und in
welchem Gewebe dies geschieht.
Das Anfärben gelang über einen
Genschalter. „Wir haben gesehen,
dass die Gewebemakrophagen ganz
früh während der Embryonalphase
entstehen, und zwar aus Vorläufern
im Dottersack“, wird Kay Klapp-
roth, einer der beiden Erstautoren
der Studie in einer Mitteilung des
DKFZ zitiert. „Das bedeutet, dass
die Makrophagen, im Gegensatz zu
unserer bisherigen Vorstellung, ih-
ren Nachschub nicht aus dem Kno-
chenmark erhalten, sondern sich
vor Ort, also im Gewebe selbst, un-
abhängig erneuern.“
„Dies gilt zunächst für Makro-
phagen in normalem gesundem Ge-
webe“, so Professor Hans-Reimer
Rodewald vom DKFZ, „bei größe-
rem Bedarf bei Entzündungen oder
Verlust von Makrophagen können
offenbar die Monozyten aus dem
Knochenmark für Nachschub an
Gewebemakrophagen sorgen.“ Ob
diese Ersatzmakrophagen die glei-
chen Aufgaben übernehmen wie die
„herkömmlichen“ Makrophagen,
ist noch unklar.
Makrophagen in Klassen einteilen
Daher interessieren sich die Wis-
senschaftler nun für die Frage, wie
sich die ursprünglichen Makropha-
gen aus dem Dottersack von den
„Notfall-Makrophagen“ aus dem
Knochenmark unterscheiden. „Bei
bestimmten Krebsarten können
Makrophagen wahrscheinlich zum
Ausbreiten der Tumorzellen beitra-
gen. In anderen Fällen werden ih-
nen eher tumorhemmende Funktio-
nen zugeschrieben“, sagt Klapp-
roth. Es ist gegenwärtig unklar, ob
diese gegensätzlichen Funktionen
möglicherweise mit der unter-
schiedlichen Herkunft der Makro-
phagen in Verbindung stehen. Bis-
her kann man die beiden Zellarten
noch nicht voneinander unterschei-
den.
„Es wäre spannend, wenn man
mithilfe unserer neuen Erkenntnisse
die Makrophagen aufgrund ihrer
Herkunft in verschiedene Klassen
einteilen könnte“, blickt Rodewald
in die Zukunft.
(eb)
Neuer
Entstehungsweg
gefunden
Die meisten Makrophagen
stammen wohl aus
Vorläufern im Dottersack,
und nicht – wie bisher
vermutet – aus dem
Knochenmark.
MAKROPHAGEN
Medizin
BDI aktuell
März 2015
15
Mit 18 Jahren war bei der Patientin,
die seit Monaten über Bauchschmer-
zen und Durchfälle klagte, ein Morbus
Crohn mit Befall des terminalen Ile-
ums diagnostiziert worden. Nach Ein-
leitung einer Steroidtherapie kam es
zunächst zu einer Besserung. Im wei-
teren Verlauf nahmen die Beschwer-
den jedoch wieder zu, sodass zusätz-
lich eine immunsuppressive Therapie
mit Azathioprin eingeleitet werden
musste. Dies führte zu einer anhalten-
den Remission.
Jetzt stellte sich die Patientin wegen
rezidivierender Fieberschübe bei ih-
rem Hausarzt vor. Die klinische Un-
tersuchung ergab von Seiten des Ab-
domens keinen krankhaften Befund.
Laborchemisch war die BSG mit
45/98 deutlich beschleunigt, es be-
stand eine leichte Leukozytose
(13 400/mm
3
), und auch das CRP war
mit 8,4 mg/dl erhöht. Der Urinstatus
war unauffällig.
Vorübergehende Entfieberung
Obwohl keine eindeutige Diagnose ge-
stellt werden konnte, wurde eine pro-
batorische antibiotische Therapie mit
Amoxicillin eingeleitet. Nach einer vo-
rübergehenden Entfieberung für einige
Tage traten aber erneut Fieberschübe
mit Temperaturen bis 39 °C auf. Bei
Verdacht auf eine Komplikation des
Morbus Crohn wurden jetzt eine Ileo-
koloskopie und eine Computertomo-
grafie des Abdomens durchgeführt.
Dabei ergaben sich allerdings keinerlei
Anhaltspunkte für ein Crohn-Rezidiv
oder für eine Komplikation der Darm-
erkrankung im Sinne einer Abszessbil-
dung.
Überraschung im Echo
Nun wurde die Diagnostik erweitert
und eine Farbdopplerechokardiografie
durchgeführt. Hierbei offenbarte sich
ein unerwarteter Befund: An der Aor-
tenklappe fand sich eine ca. 14 mm
große Vegetation. Somit handelte es
sich um eine Aortenklappenendokar-
ditis. In den Blutkulturen konnte dann
auch Staphylococcus aureus nachge-
wiesen werden.
Nach Einleitung einer kombinierten
antibiotischen Therapie mit Ampicil-
lin/Sulbactam, Vancomycin und Gen-
tamycin kam es nicht zu einer Besse-
rung des Krankheitsbildes, weshalb die
Indikation für einen prothetischen
Aortenklappenersatz gestellt werden
musste.
Die Endokarditis ist ein Krank-
heitsbild, an das bei unklaren Fieber-
schüben zunächst nicht immer ge-
dacht wird. Typisch ist, dass nach Ein-
leitung einer unspezifischen Antibioti-
ka-Therapie — wenn überhaupt —
nur kurzfristig eine Entfieberung auf-
tritt. An dieses Krankheitsbild sollte
man aber nicht nur bei Patienten mit
einem bekannten Vitium oder bei sol-
chen nach prothetischem Klappener-
satz denken, sondern auch bei allen
immunkompromittierten Patienten.
Die Diagnose kann nur mittels Echo-
kardiografie gesichert werden.
In diesem Fall dürfte die immun-
suppressive Therapie mit Azathioprin
der entscheidende Risikofaktor sein.
Gefürchtet sind neben einem septi-
schen Verlauf die rasche Destruktion
der Klappe und septische Embolien.
Wegen eines steroidrefrak-
tären Morbus Crohn wurde
eine 30-jährige Patientin
längere Zeit mit Azathioprin
behandelt. Als septische
Fieberschübe auftraten,
dachte man zunächst an
eine Komplikation der
Darmerkrankung. Die
echokardiografische Unter-
suchung ergab jedoch
einen unerwarteten Befund
an der Aortenklappe.
Kasuistik: Fieberschübe bei
junger Crohn-Patientin
Von Dr. Peter Stiefelhagen
Staphylokokken haben bei immunsupprimierten Patienten ein leichtes Spiel.
© JANICE HANEY CAR / CDC
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Fazit
Bei unklaren
rezidivierenden Fie-
berschüben sollte man nicht nur
bei Patienten mit einem bekannten
Klappenvitium und solchen nach
Klappenersatz an eine Endokarditis
denken. Auch immunkompro-
mittierte Patienten sind gefährdet.