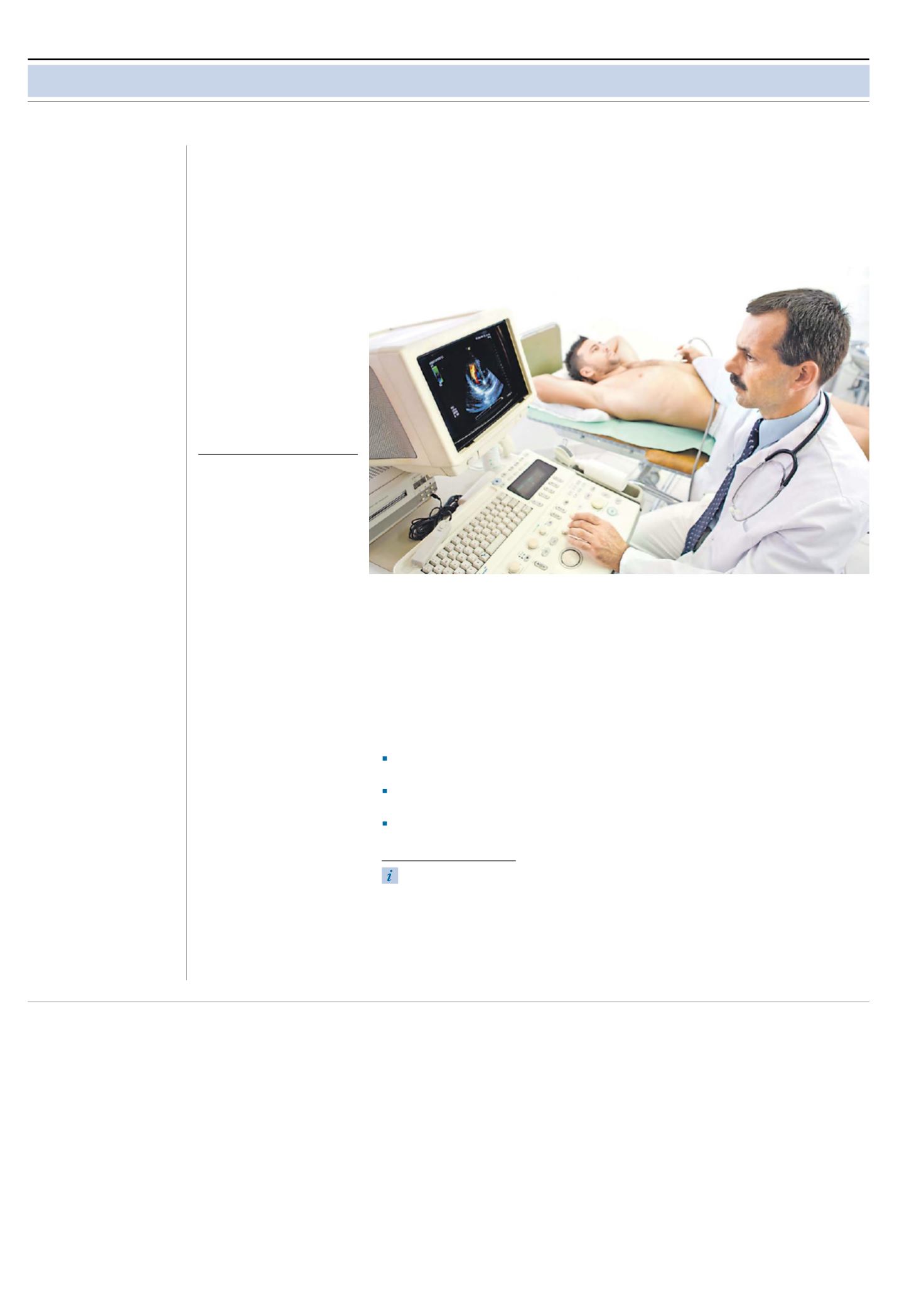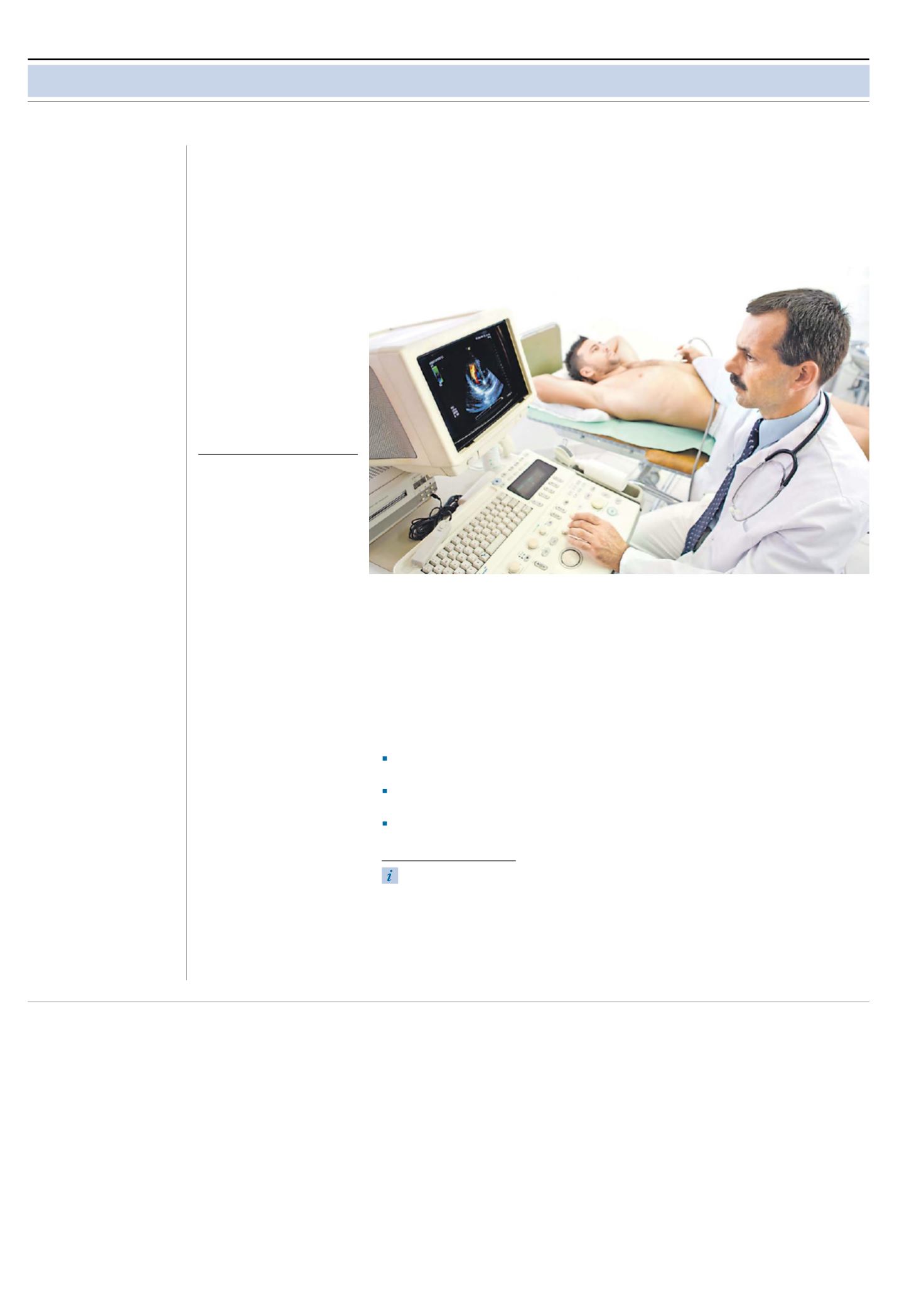
Nicht nur die Bestrahlung des Ge-
hirns, sondern auch des Thorax
scheint bei kleinzelligem Bronchi-
al-Ca die Überlebensrate zu verbes-
sern. Dies sind die Ergebnisse drei-
er klinischer Studien (The Lancet
2014; online 14. September).
Die Behandlung des kleinzelli-
gen Bronchialkarzinoms bestand
lange Zeit allein in einer Chemo-
therapie, bei den meisten Patienten
kam es aber nach kurzer Zeit zu
Metastasen im Gehirn. Vor sieben
Jahren konnte eine Studie zeigen,
dass eine vorbeugende Schädelbe-
strahlung die Häufigkeit der Hirn-
metastasen drastisch senkt und die
Einjahresüberlebensrate verdoppelt.
Diese prophylaktische Schädelbe-
strahlung ist heute Standard beim
kleinzelligen Bronchialkarzinom.
In klinischen Studien zwischen
2009 und 2012 wurde auch der
Brustkorb prophylaktisch bestrahlt.
An den Studien nahmen 498 Pati-
enten teil. Die Hälfte erhielt im An-
schluss an die Chemotherapie zu-
sätzlich zur Schädelbestrahlung ins-
gesamt zehn Bestrahlungen des
Thorax, die andere Hälfte nur eine
Radiotherapie des Schädels.
Die zusätzlichen Thoraxbestrah-
lungen wurden in der Regel gut
vertragen. Die günstige Wirkung
wurde jedoch nur bei Patienten be-
obachtet, die länger als ein Jahr
überlebten. Während durch die
Schädelbestrahlung die Überle-
benswahrscheinlichkeit nach einem
Jahr verdoppelt werden konnte,
wurde ein Effekt der Thoraxbe-
strahlung erst im zweiten Jahr er-
kennbar. Sie bestand dann jedoch
in einer deutlichen Steigerung der
Überlebensrate nach zwei Jahren
von drei auf 13 Prozent. Dies be-
deutet, dass einer von zehn Patien-
ten durch die Bestrahlung des Tho-
rax eine Chance auf ein Langzeit-
überleben erhält. Dies sei ein in der
Therapie des kleinzelligen Lungen-
karzinoms nur selten erzielter Vor-
teil, der die Bestrahlung des Thorax
als Einzelfallentscheidung für Pati-
enten sinnvoll erscheinen lässt, bei
denen eine gute Verträglichkeit an-
hand ihres Allgemeinzustands und
des zu therapierenden Tumorvolu-
mens anzunehmen ist.
(cl/awmf)
Bronchial-Ca:
Auch Brustkorb
bestrahlen!
Mit der Bestrahlung des
Thorax stieg bei Patien-
ten mit kleinzelligem
Bronchial-Ca die Überle-
bensrate auf 13 Prozent.
ONKOLOGIE
Zum Vorgehen bei Lungenembolie lie-
gen seit September 2014 neue Leit-
linien der Europäischen Kardiologen-
gesellschaft ESC vor. Demnach hängt
die Entscheidung für oder gegen eine
Lyse-Therapie vor allem vom hämo-
dynamischen Schweregrad ab. Neu ist
die Definition des „intermediären Ri-
sikos“: ein nach durchgemachter Lun-
genembolie hämodynamisch stabiler
Patient, der jedoch im Herzecho eine
Rechtsherzbelastung
zeigt
sowie
labordiagnostisch ein erhöhtes Tropo-
nin. Nach Professor Martin Kohlhäufl
vom
Robert-Bosch-Krankenhaus
Stuttgart sind solche Konstellationen
in der Praxis häufig; sie werden nur
sehr oft nicht adäquat diagnostiziert.
Dabei sind Echokardiografiebefunde
und der Biomarker Troponin prognos-
tisch äußerst relevant.
Kann-Regelung zur Lyse
Patienten mit intermediärem Risiko
sind engmaschig zu überwachen, for-
derte Kohlhäufl. Anders als der hämo-
dynamisch instabile Patient erfordern
sie aber nicht zwingend eine Lyse. „Es
handelt sich hier um eine Kann-Ent-
scheidung“, sagte der Experte beim
Internisten-Update in München.
Kohlhäufl riet, zunächst konservativ
zu behandeln. Die Indikation zur Lyse
sei erst zu stellen, wenn der Patient im
Verlauf instabil werde oder Zeichen
der Rechtsherzbelastung zunähmen.
Die Kann-Regelung zur Lyse bei
intermediärem Risiko beruht vor allem
auf einer Studie mit 1005 hämodyna-
misch stabilen Patienten mit Rechts-
herzbelastung und positivem Tropo-
nin-Test: Darin erzielte die Tenecte-
plase-Gruppe gegenüber Placebo zwar
eine Verbesserung beim kombinierten
Endpunkt Tod, hämodynamische De-
kompensation, Reanimation und
Schock (NEJM 2014; 370: 1402-11).
Nach Kohlhäufl ging dies aber in ers-
ter Linie auf das Konto der verbesser-
ten hämodynamischen Stabilität. Der
Preis war das erhöhte Blutungsrisiko:
So war die Rate der hämorrhagischen
Insulte in der Verumgruppe deutlich
höher, vor allem bei Patienten über
75. Die Lyse hatte die Patienten zwar
stabilisiert, die Mortalität war jedoch
gleich geblieben.
In der ESC-Leitlinie wird noch eine
weitere Risikogruppe definiert: Patien-
ten, die eine chronische thromboem-
bolische
pulmonale
Hypertonie
(CTEPH) entwickeln. Wie Kohlhäufl
berichtete, betrifft dies mindestens
neun Prozent aller Patienten mit Lun-
genembolie. „Die Dunkelziffer“, so
der Experte, „ist wahrscheinlich
hoch.“ Nach Kohlhäufl liegt der Ver-
dacht auf eine solche Komplikation
nahe, wenn ein Patient zum Beispiel
„nach dreimonatiger Antikoagulation
über Dyspnoe klagt“. In diesem Falle
sei eine weiterführende Diagnostik an-
gezeigt. Die ESC sieht hierfür eine
Echokardiografie vor, gefolgt von ei-
nem
Ventilations-Perfusions-Szinti-
gramm. Die Angio-CT dagegen halten
die Experten zum Ausschluss einer
CTEPH für weniger geeignet. „Man
muss schon sehr erfahren sein, um
hier zuverlässig Veränderungen zu er-
kennen“, so Kohlhäufl. Umgekehrt
schließe auch ein normaler Angio-
CT-Befund dieses Krankheitsbild
nicht aus.
Eingriff in kurativer Intention
Der nächste Diagnostik-Schritt ist
nach Leitlinie eine Rechtsherzkathe-
teruntersuchung. Diese zeigt nach
Kohlhäufl oft typische Gefäßabbrüche
in der Lungenperipherie. Bei positi-
vem Befund ist die Standardtherapie
die pulmonale Endarteriektomie unter
Einsatz der Herz-Lungen-Maschine.
Der aufwendige Eingriff erfolgt, so
Kohlhäufl, „in absoluter kurativer In-
tention“. Dabei wird das thromboti-
sche Material vom Herzchirurgen her-
ausgeschält. Etwa 60 Prozent der Pati-
enten sind für diesen schweren Ein-
griff jedoch nicht geeignet. Für sie gibt
es jetzt eine medikamentöse Option:
Riociguat ist der erste Vertreter der so-
genannten sGC-Stimulatoren. Die lös-
liche Guanylatzyklase katalysiert die
Synthese von zyklischem Guanosin-
monophosphat. Dieses, so Kohlhäufl,
„wirkt per se vasodilatatorisch, anti-
proliferativ und antiinflammatorisch.“
Das Medikament sei jedoch keinesfalls
als Ersatz für den operativen Eingriff
zu sehen, warnte der Pneumologe. „Es
sollte wirklich reserviert sein für Pati-
enten, die auch nach Evaluierung an
entsprechenden Zentren für definitiv
inoperabel erklärt wurden.“
Lungenembolie: Primär keine
Lyse bei intermediärem Risiko
Zum Management nach
Lungenembolie hat die ESC
neue Empfehlungen vorge-
legt: Diese gelten für die
erst kürzlich definierte
Gruppe von Patienten mit
intermediärem Risiko und
für Patienten mit chroni-
scher thromboembolischer
pulmonaler Hypertonie.
Von Elke Oberhofer
Mit Herzecho und Troponin-Diagnostik lässt sich das Risiko einer Lungenembolie einschätzen.
© ZSOLT NYULASZI / PANTHERMEDIA.NET
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10. DGIM-Internisten-
Update-Seminar
Das nächste
DGIM-Internisten-
Update-Seminar findet statt am:
06. und 07
. November in Berlin
und München
20. und 21.
November in
Wiesbaden und Wuppertal
27. und 28.
November in
Hamburg
Die Anmeldung ist möglich unter:
anmeldung
Eine Lungenentzündung birgt ein
ähnlich hohes kardiovaskuläres Risiko
wie Diabetes, Rauchen und Bluthoch-
druck – und das sogar noch Jahre nach
der Infektion.
Zu dieser Schlussfolgerung kommt
eine Arbeitsgruppe um Dr. Vincente
F. Corrales-Medina von der Universi-
tät in Pittsburgh. Die Forscher haben
in einer Studie untersucht, wie sich
das kardiovaskuläre Risiko von Patien-
ten, die wegen einer Pneumonie in ei-
ne Klinik eingewiesen worden waren,
im Laufe der Zeit verändert (JAMA
2015; 313: 264-274). Adjustiert hatten
die Wissenschaftler dabei auf demo-
grafische Aspekte, kardiovaskuläre Ri-
sikofaktoren, subklinische kardiovas-
kuläre Ereignisse, Begleiterkrankungen
und den allgemeinen Gesundheits-
zustand.
Zwei populationsbasierte Studien –
die „Cardiovascular Health Study“
(CHS) und die „Atherosclerosis Risk
in Communities Study“ (ARIC) –
zogen die Wissenschaftler für ihre
Analyse heran. In der CHS-Populati-
on fand sich bei 591 der 5888 über
65-jährigen Studienteilnehmer eine
Pneumonie, in ARIC waren es 680
Fälle bei 15 792 Personen im Alter
zwischen 45 und 64 Jahren. Das kar-
diovaskuläre Risiko wurde daraufhin
über zehn Jahre zu verschiedenen Zeit-
punkten erfasst.
Dabei zeigte sich, dass das Risiko,
einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder
eine tödliche koronare Herzerkran-
kung zu erleiden, innerhalb der ersten
30 Tage nach Klinikeinweisung zwar
am höchsten ist, nämlich bei älteren
Personen etwa viermal höher als bei
gematchten Kontrollen (adjustierte
Hazard Ratio, HR=4,07 in CHS) und
bei jüngeren etwas mehr als doppelt so
hoch (HR=2,39 in ARIC). Doch blieb
die Gefährdung auch in den folgenden
Jahren bestehen: So war das Risiko für
die CHS-Population nach 90 Tagen
noch immer um fast das Dreifache er-
höht (adjustierte HR: 2,94) und im-
merhin noch um das 1,86-Fache nach
neun bis zehn Jahren.
In der ARIC-Population war die
Hazard Ratio nach zwei Jahren zwar
ebenfalls weiter erhöht, statistisch war
dieses Ergebnis ab diesem Zeitpunkt
jedoch nicht mehr signifikant.
Dass Infektionen vor allem des Res-
pirationstraktes die Wahrscheinlichkeit
für ein kardiovaskuläres Ereignis kurz-
zeitig erhöhen, ist bereits gut belegt.
Über das langfristige Risiko für die Be-
troffenen existierten bisher allerdings
widersprüchliche Ergebnisse.
Die neuen Ergebnisse verdeutlich-
ten, dass eine Hospitalisierung auf-
grund einer Pneumonie mit einem
deutlich erhöhten kardiovaskulären Ri-
siko assoziiert sei – sowohl kurz- als
auch langfristig, schreiben die Auto-
ren. Das Ausmaß des Risikos sei ver-
gleichbar oder sogar höher als das an-
derer traditioneller Risikofaktoren wie
Diabetes, Rauchen und Bluthoch-
druck. Die Pneumonie lässt sich also
möglicherweise in die Reihe der kar-
diovaskulären Risikofaktoren einord-
nen; zumindest deuteten diese Befun-
de darauf hin, so die Forscher.
(vs)
Kurzfristig steigt vor allem
bei Atemwegsinfektionen
die Gefahr für Herzkreis-
lauf-Erkrankungen an. Doch
wie steht es um das lang-
fristige Risiko?
Pneumonie: Langfristig Risiko für Herzkreislauf-Leiden?
14
März 2015
BDI aktuell
Medizin