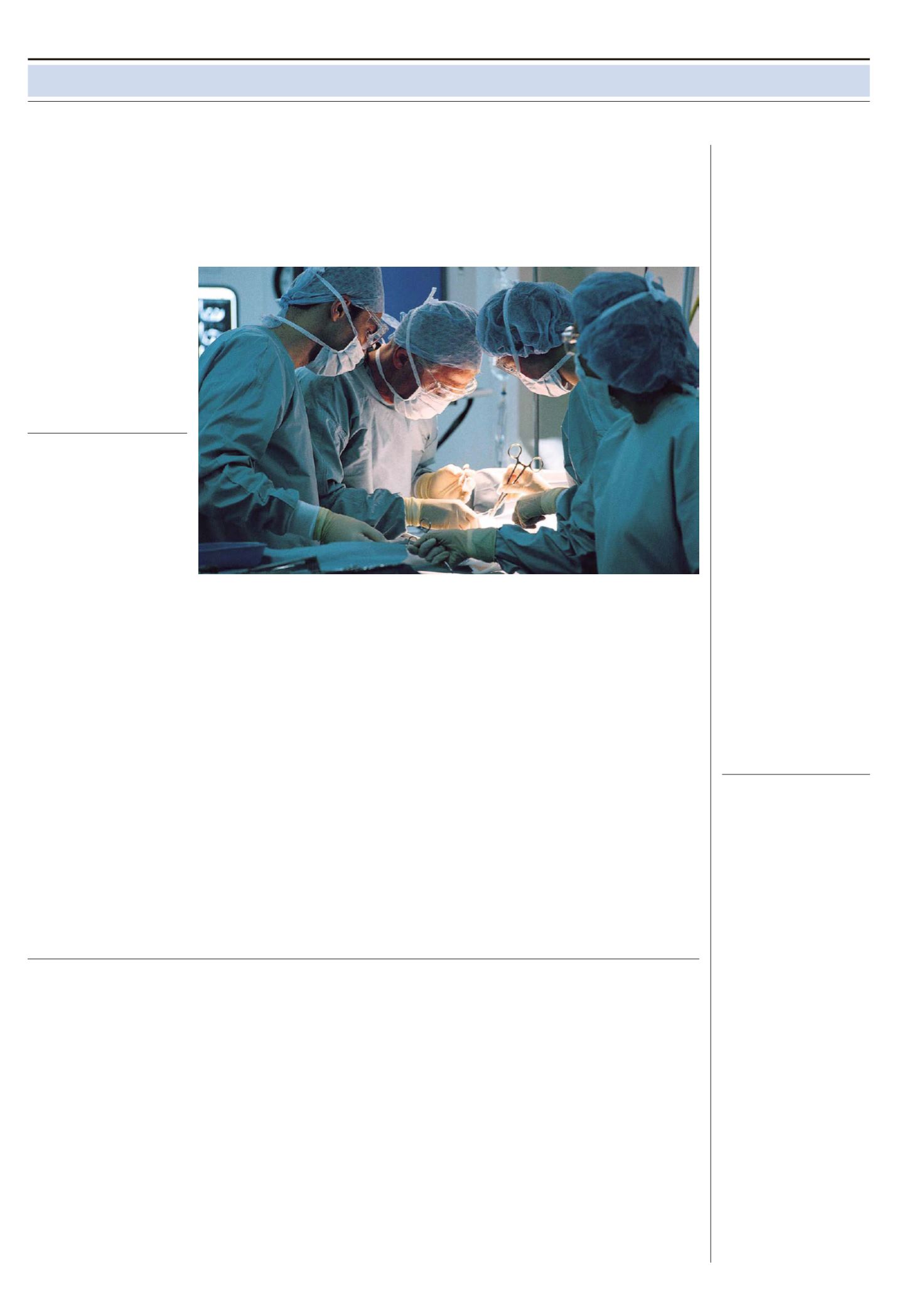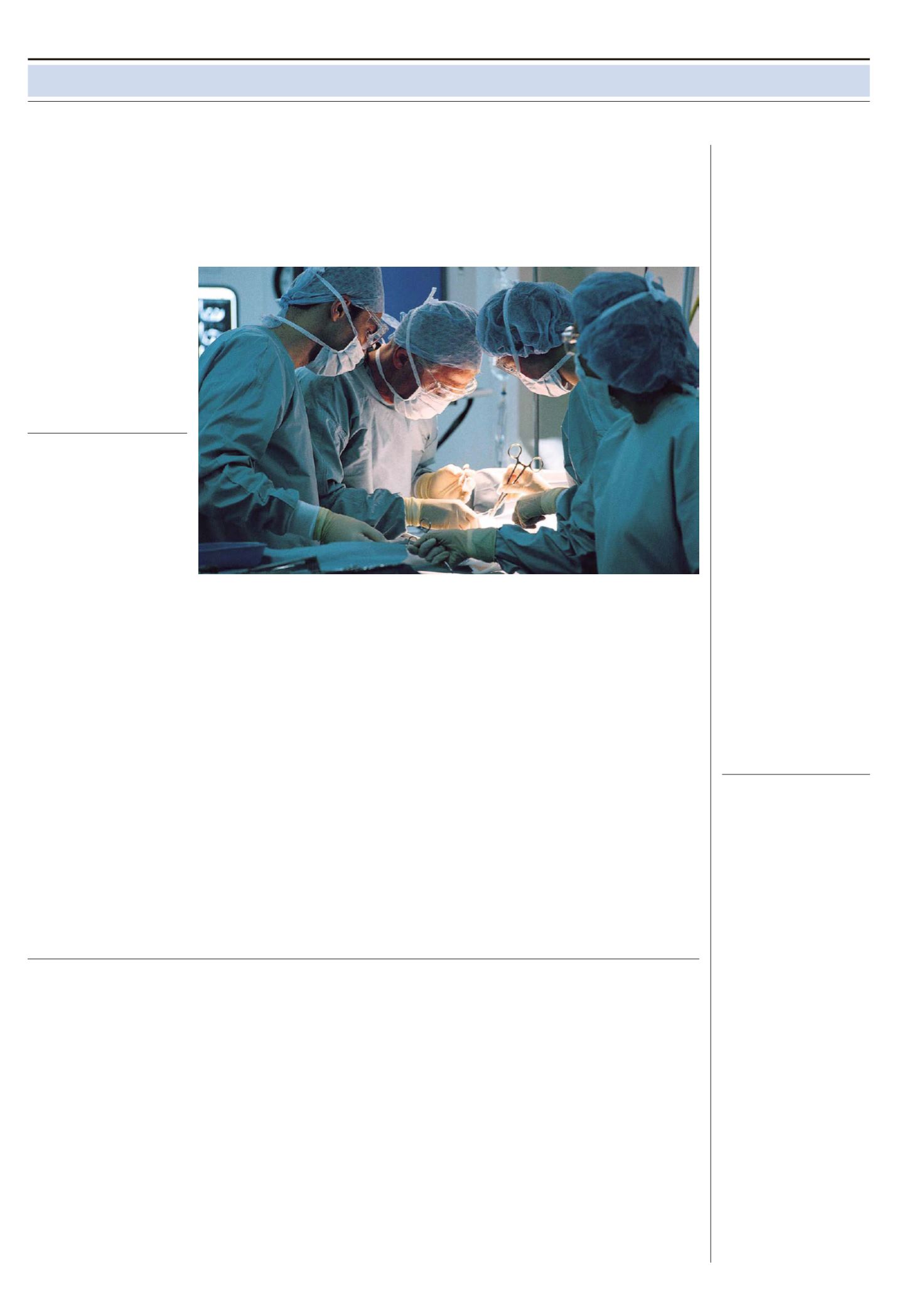
Medizin
BDI aktuell
November 2015
11
Deutschland ist weltweit führend in
der Anwendung der kathetergestützten
Implantation von Aortenklappen bei
Patienten mit Aortenstenose. Derzeit
gilt, dass diese Methode bei inoperab
len Patienten sowie als Alternative zur
Operation bei Patienten mit hohem
Operationsrisiko indiziert ist. Aller
dings zeichnet sich bereits ab, dass
sich für die TAVI zunehmend auch bei
nicht so hohem Risiko entschieden
wird – auch auf Wunsch der Patienten.
Zwecks gesetzlich vorgeschriebener
externer Qualitätssicherung werden
vom AQUAInstitut (Institut für ange
wandte Qualitätsförderung und For
schung im Gesundheitswesen) Jahr für
Jahr Daten zu sämtlichen isolierten
AortenklappenEingriffen in Deutsch
land erhoben. Diese Daten vermitteln
somit ein gutes Bild von der realen
Versorgungssituation im Hinblick auf
interventionelle und chirurgische Ein
griffe bei Aortenstenose.
Auf Basis dieser AQUADaten ha
ben Professor Holger Eggebrecht vom
Cardioangiologischen Centrum Betha
nien in Frankfurt am Main und Dr.
Rajendra Mehta von der Duke Uni
versity in Durham im USStaat North
Carolina jetzt einmal die Entwicklung
nachgezeichnet, die sich zwischen
2008 und 2014 in Deutschland in der
Behandlung von älteren Patienten mit
Aortenstenose vollzogen hat (Euroin
tervention 2015, online 20. Septem
ber).
TAVIZahl stieg auf das 20fache
Danach sind seit 2008 hierzulande
71927 isolierte AortenklappenOpera
tionen (chirurgischer Aortenklappen
ersatz) und 48353 TAVIEingriffe
durchgeführt worden. Die Zahl der
chirurgischen Eingriffe zur Beseiti
gung von Aortenstenosen ist seit dieser
Zeit leicht rückläufig: Erhielten 2008
noch 11205 Patienten ihre neue Aor
tenklappe auf dem Weg einer offenen
Herzoperation, waren es 2014 nur
noch 9953.
Umgekehrt verlief die Entwicklung
bei den TAVIProzeduren – und zwar
in äußerst rasantem Tempo. Hier war
in der gleichen Zeit ein Anstieg der
erfassten Interventionen auf das
20fache zu verzeichnen: War die Zahl
im Jahr 2008 mit 637 Eingriffen noch
sehr bescheiden, erreichte sie 2014 mit
nunmehr 13263 ihren bislang höchs
ten Stand. Im Jahr 2013 überstieg
erstmals die Zahl der TAVIProzedu
ren die der AortenklappenOperatio
nen. Dies ist vor allem auf die Zunah
me von transfemoralen TAVIEingrif
fen zurückzuführen, die Zahl der
transapikalen Prozeduren veränderte
sich dagegen kaum.
Altersstruktur kaum verändert
Noch lassen zumindest die AQUA
Daten zur Altersstruktur eine Auswei
tung der TAVI auf jüngere Patienten
mit niedrigerem Risiko nicht erken
nen: Mit 81,6 Jahren (2008) und 80,9
Jahren (2014) blieb das Durch
schnittsalter der TAVIPatienten nahe
zu unverändert. Dagegen spiegeln die
zwischen 2011 und 2014 erfassten
Veränderungen beim EUROScore –
er dient der Voraussage der postopera
tiven Mortalität nach herzchirurgi
schen Eingriffen – bereits einen gewis
sen Trend in diese Richtung wider.
Rückgang von Komplikationen
Erfreulich ist der Rückgang der im Zu
sammenhang mit TAVIProzeduren
aufgetretenen Komplikationen. Die
Rate der intraprozeduralen Komplika
tionen fiel von 9,4 Prozent (2012) auf
3,9 Prozent (2014). Trotz der Tatsa
che, dass TAVIPatienten deutlich äl
ter als chirurgisch behandelte Patien
ten waren und zudem mehr Begleiter
krankungen aufwiesen, waren im Jahr
2014 die Raten für Schlaganfälle in
der stationären Phase kaum unter
schiedlich (1,4 versus 1,1 Prozent).
Bemerkenswert ist vor allem die
deutliche Abnahme der InHospital
Mortalität, die von 10,4 Prozent im
Jahr 2008 auf 4,2 Prozent im Jahr
2014 zurückging.
Aortenstenose: TAVI hat
HerzklappenOp überholt
Bei älteren Patienten mit
schwerer Aortenstenose hat
die TranskatheterAorten
klappenImplantation (TAVI)
in Deutschland die Herz
klappenOp überflügelt.
Das geht aus einer Analyse
von Daten des AQUA
Instituts hervor.
Von Peter Overbeck
Im Jahr 2008 erhielten noch 11205 Patienten ihre neue Aortenklappe auf dem Weg einer offenen Herzoperation. 2014 waren es nur
noch 9953.
© BVMEDBILDERPOOL
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4,2%
betrug die InHospitalMortalität
bei TAVIPatienten im Jahr 2014.
Im Jahr 2008 lag sie noch bei
10,4 Prozent.
Bei COPD steht die Phänotypisierung
der Patienten zum gezielteren Einsatz
von Medikamenten noch am Anfang.
Aber auch hier gibt es Ansätze zur
Therapieoptimierung, orientiert an
Biomarkern für Entzündungsprozesse
wie Eosinophile, Neutrophile und
CRP.
Am häufigsten lässt sich bei
COPDPatienten eine Neutrophilie
nachweisen. Der Anteil liegt bei einem
Drittel bis zu mehr als 50 Prozent und
korreliert mit einer schlechten Lun
genfunktion, sagte Professor Peter
Gibson von der University of New
castle, Australien auf der Jahrestagung
der European Respiratory Society
(ERS). Von einer Eosinophilie sind 20
bis 30 Prozent der Patienten betroffen.
Sie korreliert, ebenso wie eine systemi
sche Entzündung (Serum hsCRP >
3 mg/ml) mit einer Prävalenz von rund
60 Prozent bei COPD, mit einem er
höhten Risiko für Exazerbationen und
Tod. Bei weiteren rund 15 Prozent der
Patienten liegt sowohl eine Eosinophi
lie als auch eine Neutrophilie vor. Die
Grenzwerte sind bisher noch nicht
eindeutig definiert.
Alle drei Biomarker für Entzündun
gen können therapeutisch beeinflusst
werden, mit dem Potenzial, die Prog
nose der Patienten gezielt zu verbes
sern. Die Eosinophilie kann durch in
halative Kortikosteroide oder, bei Ex
azerbationen, durch orale Kortikoste
roide deutlich verringert werden. Das
Ansprechen der Patienten auf Korti
kosteroide korreliert direkt mit dem
Ausmaß der Eosinophilie, sagte Gib
son. Dies habe sich in Studien sowohl
bei der Lungenfunktion, der Belast
barkeit als auch der Exazerbationspro
phylaxe gezeigt.
Die Zahl der Neutrophilen nimmt
mit zunehmendem Alter zu und ist bei
Rauchern höher als bei Nichtrau
chern. Dagegen seien die Eosinophilen
unabhängig vom Raucherstatus, be
richtete Gibson. Durch eine erfolgrei
che Raucherentwöhnung kann daher
auch über die Senkung der Neutrophi
len das Progressionsrisiko bei COPD
Patienten verringert werden. Auch
MakrolidAntibiotika haben bei
COPDPatienten mit Exazerbation
das Potenzial zur Prognoseverbesse
rung, insbesondere bei Neutrophilie.
In der bisher größten Studie zum
Nutzen von Azithromycin (250 mg
täglich) bei insgesamt mehr als 1000
COPDPatienten war in der Antibioti
kaGruppe das Exazerbationsrisiko im
Verlauf eines Jahres um knapp 30 Pro
zent verringert, berichtete Dr. MeiLan
Han von der University of Michigan
Health System, Ann Arbor. Am besten
wirksam war die Therapie bei Patien
ten im GOLDStadium II und bei äl
teren Patienten
$
65 Jahre. Keinen
Nutzen hatte Azithromycin bei Rau
chern, betonte Han.
Erhöhte CRPWerte können durch
Statine verringert werden. In Studien
konnte durch Einsatz von Statinen die
Exazerbationsrate von COPDPatien
ten um rund ein Drittel verringert
werden, berichtete Gibson.
(rf)
Biomarker für Entzündun
gen können therapeutisch
beeinflusst werden, mit
dem Potenzial, die Progno
se von COPDPatienten zu
verbessern.
Gezielte COPDTherapie nach Biomarkern?
Wissenschaftler des Helmholtz
Zentrums für Infektionsforschung
(HZI) haben ein Molekül identifi
ziert, das darüber Auskunft gibt, ob
eine Sarkoidose chronisch oder
akut (LöfgrenSyndrom) verläuft
(Clin Exp Immunol 2015; online
28. September). Darüber hinaus
besitze das Molekül auch therapeu
tisches Potenzial, teilt das HZI mit.
Was eine Sarkoidose verursacht,
ist bisher unbekannt. „Wir wissen
aber seit mehreren Jahren, dass Pa
tienten eine reduzierte Anzahl regu
latorischer TZellen und eine ver
gleichsweise hohe Anzahl aktivierter
THelferzellen in der Lunge aufwei
sen“, wird Professor Dunja Bruder,
Leiterin der Arbeitsgruppe „Im
munregulation“ am HZI in einer
Mitteilung des HZI zitiert.
Das Team analysierte die Aus
prägung des eng mit der TZell
funktion in Verbindung stehenden
Moleküls ICOS bei SarkoidosePa
tienten. ICOS verstärkt die Wir
kung von regulatorischen TZellen.
Die Forscher konnten zeigen, dass
die Anzahl von ICOSMolekülen
auf den regulatorischen TZellen
besonders bei Patienten mit Löf
grenSyndrom in der erkrankten
Lunge stark erhöht war. Im Blut
der Patienten hingegen war das Le
vel identisch mit dem von gesunden
Menschen, heißt es in der Mittei
lung. Eine hohe Konzentration von
ICOS auf regulatorischen TZellen
deute also auf einen akuten Sarkoi
doseVerlauf hin
(eb)
Sarkoidose:
Wie verläuft die
Erkrankung?
Wissenschaftler machen
eine interessante
Entdeckung für die
Prognose von Sarkoidose.
FORSCHUNG
In puncto Anwendung und Ergeb
nis der Katheterablation bei Vorhof
flimmern (VHF) gibt es deutliche
Unterschiede zwischen Männern
und Frauen. Das zeigen Daten aus
dem Deutschen Ablationsregister,
teilt die Deutsche Gesellschaft für
Kardiologie (DGK) mit. „Insge
samt stellen Frauen lediglich ein
Drittel der mit Katheterablation be
handelten Patienten dar, was vorbe
schriebene Unterschiede in der kli
nischen Versorgung bestätigt,“ wird
Studienautorin Dr. Maura Magda
lena Zylla, Uniklinikum Heidelberg,
zitiert.
Nach einem Jahr betrug die Er
folgsrate nach Ablation bei Män
nern 54,6 Prozent, bei Frauen 49,8
Prozent. Bezüglich Mortalität und
schweren Komplikationen habe sich
kein Unterschied gefunden, so die
DGK. Zur medikamentösen Thera
pie wurden bei Frauen vermehrt
Betablocker (73,8 gegenüber 66,2
Prozent) oder Digitalis (6,8 gegen
über 3,6 Prozent) eingesetzt. Eben
so ergab sich ein Unterschied in der
Notwendigkeit einer Schrittmacher
therapie mit 3,7 gegenüber 1,2 Pro
zent. Zylla: „Der geringere Erfolg
der Ablation konnte durch diese
Therapien allerdings im Hinblick
auf das klinische Gesamtergebnis
nicht kompensiert werden.“
(eb)
VHF: Therapie
bei Frauen
unzureichend
KARDIOLOGIE