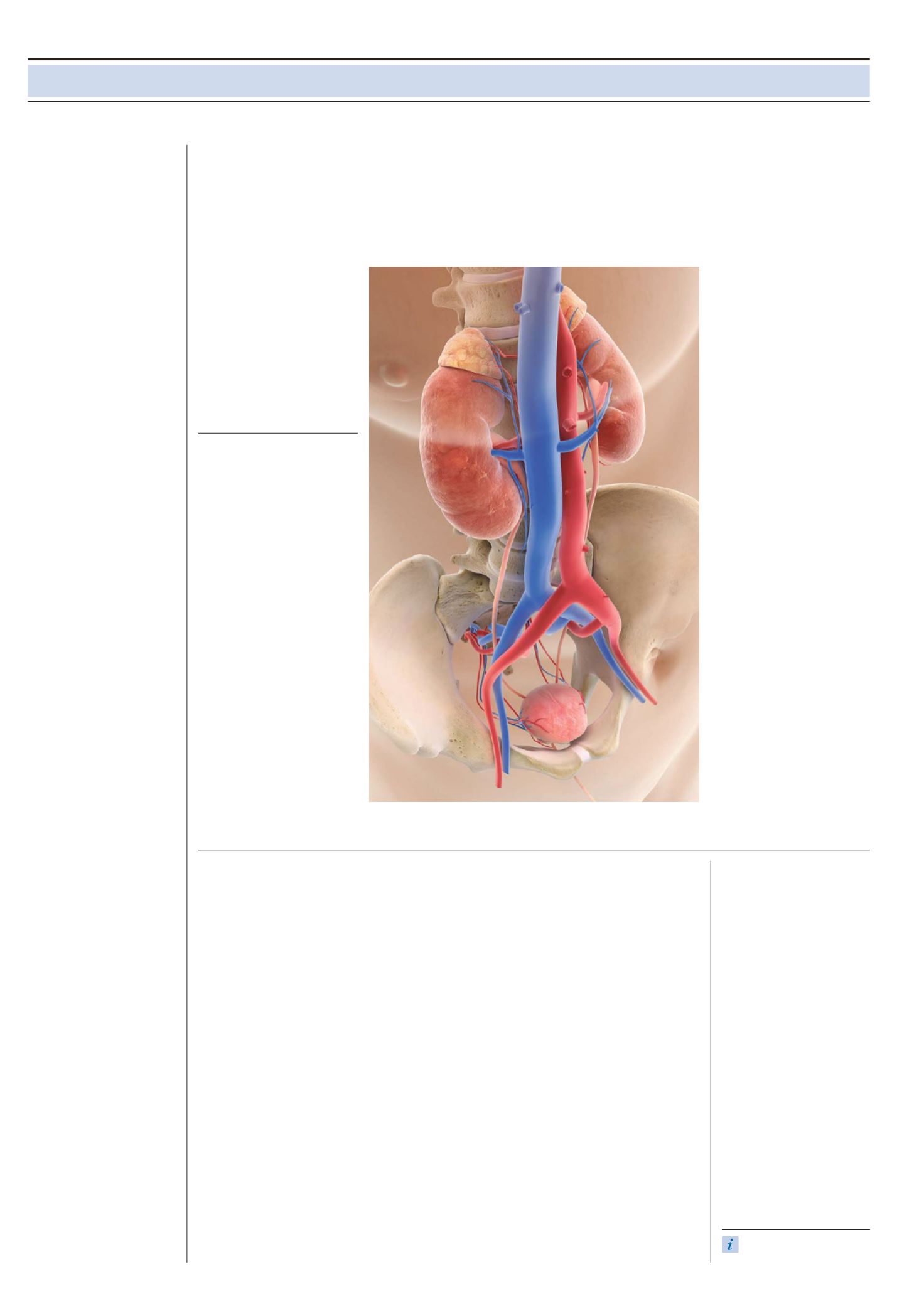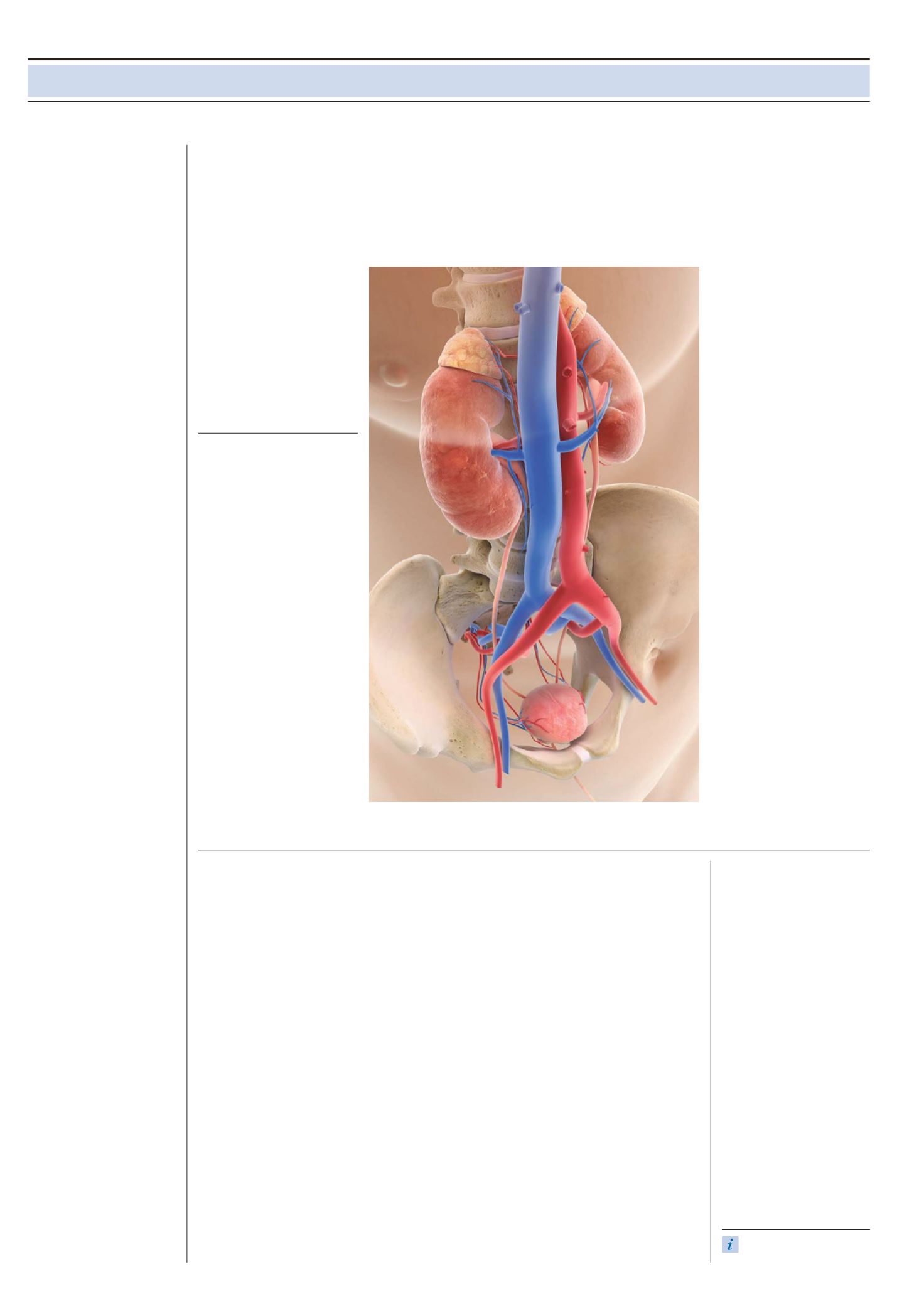
Die Immuntherapie mithilfe von
Zytokinen wie Interferon und Inter
leukin 2 hat seit mehreren Jahren
dazu beigetragen, die Prognose von
Patienten mit einem Nierenzellkar
zinom (RCC) zu verbessern. Es
wurde damit ein medianes Überle
ben von 13 Monaten erreicht, wie
Professor Viktor Grünwald von der
Medizinischen Hochschule Hanno
ver während der diesjährigen Jah
restagung der Deutschen Gesell
schaft für Hämatologie und Onko
logie (DGHO) in Basel erinnerte.
Noch bessere Erfolge lassen sich
mit der modernen Immuntherapie
erzielen, in der CheckpointHem
mer wie Nivolumab verwendet wer
den. Median sind mit derartigen
Immuntherapeutika bis zu 29 Mo
nate Überleben zu erreichen.
Studie mit 820 Patienten
Wie sehr sich die Prognose verbes
sert hat, geht unter anderem aus
der aktuellen Checkmate25Studie
hervor, wie Grünwald berichtete. In
der großen Studie mit mehr als 820
vorbehandelten Patienten, die an ei
nem klarzelligen RCC erkrankt wa
ren, wurde die Wirksamkeit – ge
messen am Parameter Gesamtüber
leben – von Nivolumab im Ver
gleich zum mTOR (mammalian
target of rapamycin)Hemmer
Everolimus geprüft (NEJM 2015;
online 25. September).
Beim primären Endpunkt schnit
ten Patienten mit Nivolumab signi
fikant besser ab (25 versus 19,6
Monate). Das Sterberisiko wurde
durch den CheckpointHemmer
um 27 Prozent verringert (Hazard
Ratio: 0,73; 95%Konfidenzinter
vall zwischen 0,57 und 0,93; p =
0,002). Hochrisikopatienten profi
tierten am meisten, so Grünwald.
CheckpointHemmer seien inzwi
schen bei dieser Indikation etabliert
und Bestandteil der Sequenzthera
pie.
Eine weitere neue Option als
Zweitlinientherapeutikum ist der
Multikinasehemmer Cabozantinib.
Das Präparat hat im August von der
USamerikanischen Zulassungsbe
hörde FDA auf der Basis der Pha
seIIIStudie METEOR – Ver
gleichspräparat war ebenfalls Ever
olimus – den Status „Breakthrough
Therapy Designation“ erhalten, der
ein beschleunigtes Zulassungsver
fahren verspricht (NEJM 2015; on
line 25. September).
In Leitlinie berücksichtigt
In der aktuellen S3Leitlinie des
Leitlinienprogramms Onkologie
zum Nierenzellkarzinom wird die
Immuntherapie ebenfalls berück
sichtigt und die Behandlung mit
VEGF (vascular endothelial growth
factor)und mTORHemmern in
der Erstlinie beziehungsweise
Zweitlinie empfohlen. Die klassi
schen Zytokinbasierten Therapien
kämen heute nicht mehr zum Ein
satz. Allerdings sei die hochdosierte
intravenöse IL2Gabe bei Patien
ten mit einem oligometastatischen
Befall und sehr gutem Allgemeinzu
stand eine Alternative für die Erstli
nientherapie, allerdings nur in spe
zialisierten Zentren.
(ple)
NierenCa: Die
Immuntherapie
wandelt sich
Patienten mit Nierenzell
karzinom profitieren wie
Melanompatienten von
der modernen Immun
therapie durch Check
pointHemmer.
ONKOLOGIE
Aufgrund des Mangels an Spender
organen stammen in Europa heute
schon bei etwa 50 Prozent der Lei
chennierenTransplantationen die Or
gane von Spendern, die nicht die Stan
dardkriterien erfüllen (standard crite
ria donors, SCD). Spender mit erwei
terten Kriterien (expanded criteria do
nors, ECD) haben entweder schon das
60. Lebensjahr erreicht oder sie sind
zwischen 50 und 59 Jahre alt, leiden
aber bereits an Gefäßerkrankungen.
Ausschlaggebend für das Langzeit
ergebnis einer Nierentransplantation
mit ECDOrganen sind, einer franzö
sischen Studie zufolge, vor allem zwei
Faktoren – die Anwesenheit von do
norspezifischen AntiHLAAntikör
pern (donor specific antibody, DSA)
beim Empfänger zum Zeitpunkt der
Transplantation und die Länge der
kalten Ischämiezeit: Sofern die Rezipi
enten keine DSA aufweisen und die
Ischämiezeit unter 12 Stunden bleibt,
ist das Transplantatüberleben ähnlich
gut wie mit SCDOrganen (BMJ
2015; 351: h3557). Die Studienauto
ren um Olivier Aubert vom INSERM
in Paris empfehlen daher, speziell bei
der Verteilung von ECDNieren diese
beiden Kriterien stärker zu berück
sichtigen.
Die Ärzte haben den Erfolg von
2763 Transplantationen ausgewertet,
die zwischen 2004 und 2011 vorge
nommen worden waren. 916 Patienten
(33,2 Prozent) hatten ECDNieren er
halten. Nach sieben Jahren lebten
noch 80 Prozent von ihnen mit dem
Spenderorgan. In der Gruppe mit
SCDNieren war dies bei 88 Prozent
der Patienten der Fall.
Die Prognose der ECDPatienten
war besonders schlecht, wenn ihr Se
rum am Tag der Organverpflanzung
positiv auf zirkulierende DSA getestet
worden war (mittlere Floureszenz
intensität über 500 Einheiten). Die
mittlere Lebenszeit einer ECDNiere
bei einem DSApositiven Empfänger
lag bei 4,6 Jahren – gegenüber 9,5 Jah
ren bei einem DSAnegativen Emp
fänger. Das SiebenJahresÜberleben
betrug 44 versus 85 Prozent.
Zum Vergleich: Bei Patienten mit
SCDNieren lag das SiebenJahres
Überleben bei 73 Prozent mit DSA
und bei 90 Prozent ohne DSA. Damit
war das Risiko, die Niere binnen sie
ben Jahren zu verlieren, bei DSAposi
tiven ECDPatienten 4,4mal so hoch
wie bei DSAnegativen und sogar
5,6mal so hoch wie bei allen anderen
Patienten zusammen. Schon ein Jahr
nach der Transplantation hatten die
Nieren in der ECDGruppe mit DSA
den stärksten Funktionsverlust. Auch
die histologische Beurteilung fiel bei
ihnen deutlich schlechter aus als bei
ECDPatienten ohne DSA.
Ob es zu einem Transplantatversa
gen kam, war bei ECDNieren außer
vom Nachweis von DSA hauptsächlich
von der kalten Ischämiezeit abhängig:
Wenn die Konservierungszeit zwischen
12 und 24 Stunden lag, war das Risiko
um den Faktor 2,5, bei Zeiten über 24
Stunden um den Faktor 3,8 erhöht.
Der Nachweis zirkulierender DSA am
Tag der Operation ging mit einem
4,6fach erhöhten Risiko einher. Dabei
waren höhere DSASpiegel mit höhe
ren Risiken für den Transplantatver
lust verknüpft. Im Gegensatz dazu hat
te die bioptische Beurteilung der
Spenderniere vor der Übertragung kei
nen eigenständigen Wert bei der Ab
schätzung der Prognose.
Der langfristige Erfolg einer
LeichennierenTransplanta
tion ist schlechter, wenn
der Organspender nur den
erweiterten Kriterien
genügt. Durch geeignete
Empfängerauswahl kann
das Ergebnis aber erheblich
verbessert werden.
Transplantation: gute Prognose
auch bei Nieren zweiter Wahl
Von Beate Schumacher
Nierenspende: Auch mit Organen von älteren oder kranken Spendern sind gute
Transplantationsergebnisse zu erzielen.
© SPRINGER VERLAG GMBH
Das Grundproblem der Bluthoch
drucktherapie in der Schwangerschaft
lässt sich nicht auflösen. Einerseits
kann der Fetus schlecht damit umge
hen, wenn die Plazenta therapiebe
dingt weniger durchblutet wird. Die
Blutgefäße sind noch unreif. Eine Au
toregulation findet intrauterin nur sehr
begrenzt statt.
Andererseits gefährdet Bluthoch
druck in der Schwangerschaft die Ge
sundheit der Mutter. „Wir wissen bei
spielsweise, dass sich eine linksventri
kuläre Hypertrophie in der Schwan
gerschaft verschlechtern kann“, sagte
Professor Duska Dragun von der Cha
rité Berlin bei der Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Nephrolo
gie. Dies korreliere mit der kardiovas
kulären Gesamtprognose.
Leitlinien sind zurückhaltend
Was also tun bei Frauen, die vielleicht
schon mit Bluthochdruck in die
Schwangerschaft hineingehen? Dass
Medikamente umgestellt werden müs
sen, ist klar. Zur Verfügung stehen im
Wesentlichen Methyldopa, selektive
Betablocker wie Labetalol, außerdem
Nifedipin und Dihydralazin bezie
hungsweise Hydralazin. Was die Blut
druckziele angeht, sind die meisten na
tionalen und internationalen Leitlinien
sehr zurückhaltend. Eine Blutdruck
senkung aus mütterlicher Indikation
wird meist erst bei Werten ab 170/110
mmHg empfohlen, beziehungsweise
ab 160/100 mmHg wenn der Blut
hochdruck schon vorher bestand.
Möglicherweise ist das etwas zu
streng. Professor Dragun berichtete in
Berlin über eine kürzlich publizierte,
randomisierte Studie von Professor
Laura Magee von der University of
British Columbia, Kanada (N Engl J
med 2015; 372:40717). An der Stu
die nahmen über 1000 Frauen von der
14. bis zur 34. Schwangerschaftswoche
teil, die entweder an einem vorbeste
henden Bluthochdruck oder einem
Gestationshypertonus ohne Proteinu
rie litten. Verglichen wurde eine stren
ge mit einer weniger strengen Blut
druckeinstellung mit einem diastoli
schen Zielblutdruck von 85 mmHg
beziehungsweise 100 mmHg.
Senkung bis 85 mmHg diastolisch
Primärer Endpunkt der Studie war ein
breites Spektrum von Schwanger
schaftskomplikationen auf Seiten des
Fetus vom Schwangerschaftsabbruch
über den Spontanabort bis zum neo
natalen Tod. Dabei gab es keinen sta
tistisch signifikanten Unterschied zwi
schen den Gruppen. Auch bei den se
kundären Endpunkten gab es wenig
Grund zur Sorge. Weder unterschie
den sich die Kinder stark im Geburts
gewicht noch in ihrem Wachstumsver
halten.
Auf Seiten der Mutter wiederum
traten schwere Komplikationen bei
strengerer Blutdruckeinstellung nume
risch seltener auf. „Insgesamt hilft uns
diese Studie, in der individualisierten
Therapie zugunsten der Mutter etwas
mutiger zu werden“, so Dragun. Zu
mindest wenn maternale Komplikatio
nen aufträten, sei eine Absenkung des
Blutdrucks bis 85 mmHg diastolisch
erlaubt.
(gvg)
Die Blutdrucksenkung in
der Schwangerschaft ist ein
heikles Thema. Es gibt
kaum Medikamente, und
der Fetus schätzt Blut
druckabfälle nicht. Trotz
dem können Ärzte in vielen
Fällen zugunsten der Mut
ter etwas mutiger werden.
Hypertonie bei Schwangeren
14
November 2015
BDI aktuell
Medizin
Das Leitlinienprogramm Onkologie
hat eine S3Leitlinie zur Diagnostik
und Therapie des Nierenzellkarzi
noms vorgelegt. Die Leitlinie ent
stand unter der Federführung der
Deutschen Gesellschaft für Urolo
gie (DGU) und der Deutschen Ge
sellschaft für Hämatologie und Me
dizinische Onkologie (DGHO); sie
soll einheitliche medizinische Stan
dards für die Diagnose, Therapie
und Nachsorge des Nierenzellkarzi
noms in Abhängigkeit von Histolo
gie und Tumorstadium schaffen,
heißt es in einer Mitteilung der
Deutschen Krebsgesellschaft e. V.
Die neue Leitlinie enthält außer
dem Qualitätsindikatoren, die mit
einer standardisierten Methodik ab
geleitet wurden und im Rahmen
der Zertifizierung von Krebszentren
zur Qualitätssicherung bei der Be
handlung von Nierenzellkarzino
men genutzt werden können.
(eb)
Die Leitlinie ist einzusehen unter:
leitlinienprogrammonkologie.de/
Nierenzellkarzinom.85.0.html
S3Leitlinie
zum Nierenkrebs
erschienen
LEITLINIENPROGRAMM