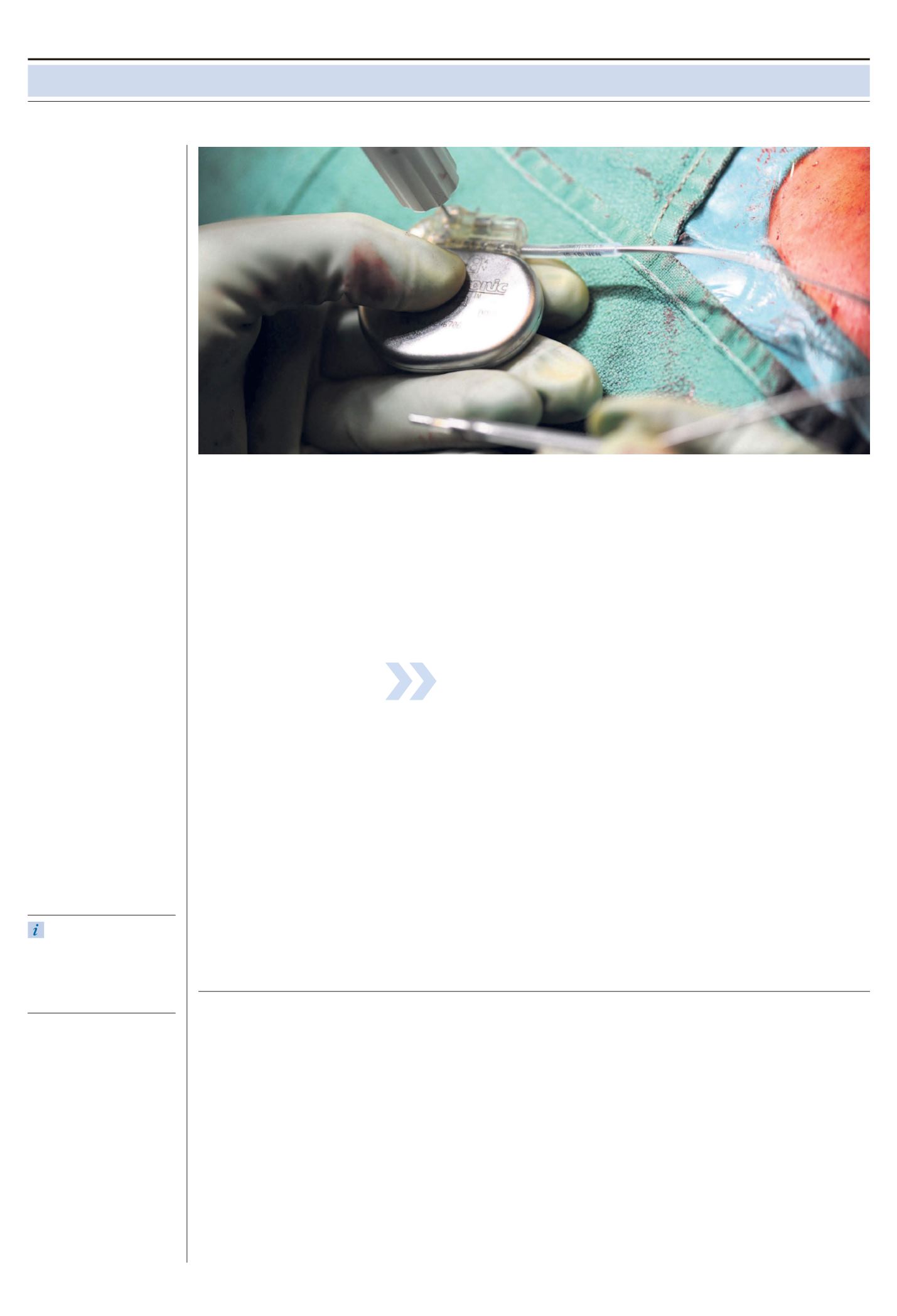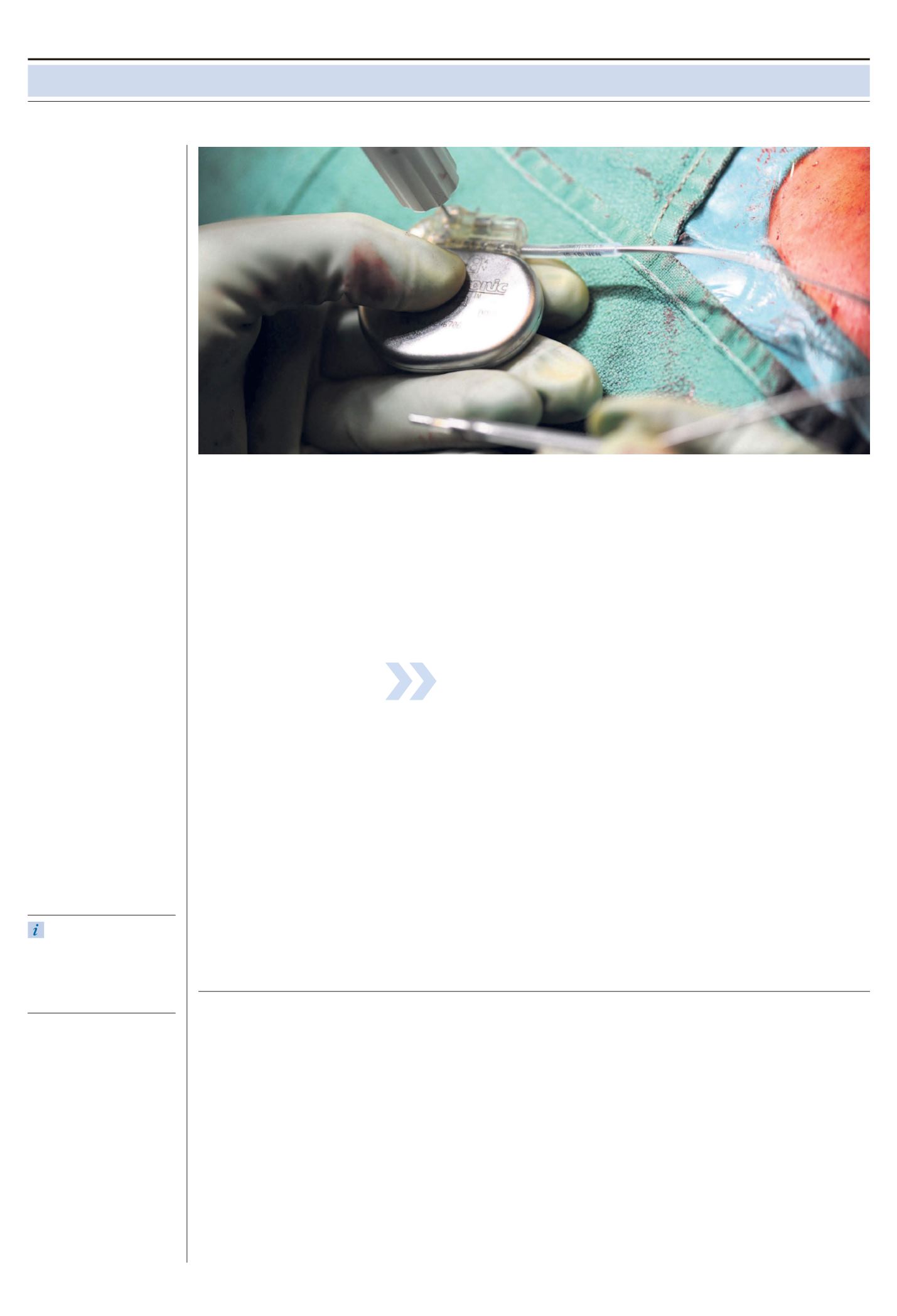
Immer mehr Patienten informieren
sich vor einem Arztbesuch über das
Internet oder überprüfen Vorschlä
ge zur Diagnose und Therapie über
dieses elektronische Medium. So
haben besonders aufgeklärte Pati
enten schon vorher ihre Beschwer
den etwa bei Wikipedia
pedia.de) eingegeben und kommen
zumindest mit einer medizinischen
Definition ihrer Symptomatik zum
Arzt, nach dem Motto: Wenn ich
meine Beschwerden mit den Anga
ben im Internet vergleiche, habe ich
Angina pectoris.
Oft gelingt es nur mit Mühe,
wieder zur Schilderung der originä
ren Beschwerden zurückzufinden.
Noch komplexer geht es bei der In
formation über Risiken und Neben
wirkungen diagnostischer und the
rapeutischer Verfahren zu.
Fundamentale Fehleinschätzung
Hier kommt es zu manchen funda
mentalen Fehleinschätzungen, weil
Risiken immer im Zusammenhang
mit dem individuellen Krankheitszu
stand zu bewerten sind. Dazu ist der
einzelne Patient selten in der Lage.
Sein Verhalten wird emotional ge
steuert. Bei Krankheiten spielt die
Angst vor der Wahrheit oft eine wich
tige Rolle. Der Patient nutzt die In
formation aus dem Internet dazu,
sein emotional motiviertes Verhalten
logisch zu begründen. Auch Ärzte
unterliegen oft diesem Verhaltens
muster, wenn sie Patienten werden.
Diese Überlegungen setzen vo
raus, dass die Internetinformatio
nen sachlich richtig sind und nur
bei individueller Bewertung falsch
eingeschätzt werden. Stimmt das?
Das Ärzteteam der Central Kran
kenversicherung hat rund 100 me
dizinische RatgeberWebsites un
tersucht und ist zu einem alarmie
renden Ergebnis gekommen: Mehr
als 30 Prozent der Websites stufte
das Team als mangelhaft und unge
nügend ein. Im Interesse der Pati
entensicherheit wird deshalb gefor
dert, dass für Gesundheitsinforma
tionen im Netz verbindliche Stan
dards zu gelten haben.
Man sollte deshalb in der Praxis
oder in der Klinik ein Plakat aufhän
gen mit der Aufforderung: Bevor Sie
das Internet konsultieren, fragen Sie
ihren behandelnden Arzt!
(HFS)
Gerade einmal eine Durchschnittsnote
von 4+ erreichten die rund 100
medizinischen RatgeberWebsites, die
das Ärzteteam der Central Krankenver
sicherungsseite geprüft hat. Nur neun
OnlineRatgeber wurden mit gut be
wertet, kein einziges mit sehr gut.
Zu Risiken
fragen Sie
Ihren Arzt
DR. INTERNET
Mit großer Mehrheit und in einem
Eilverfahren hat der Bundestag am
16. Oktober das umstrittene Gesetz
zur Vorratsdatenspeicherung be
schlossen. Telekommunikationsun
ternehmen und Internetprovider
müssen demnach Verkehrsdaten ih
rer DiensteNutzer zehn Wochen
speichern. Dabei werden zwar Perso
nen, Behörden und Organisationen
in sozialen oder kirchlichen Berei
chen, die anonyme Beratung
anbieten, von der Speicherung aus
genommen – für Ärzte und Kliniken
gilt diese Ausnahme aber nicht.
(reh)
Auch Arztdaten
werden erfasst
VORRATSDATENSPEICHERUNG
Die KV SchleswigHolstein (KVSH)
arbeitet an einem GutscheinModell
als Lösung für die vom Gesetzgeber
geforderte Terminservicestelle. Das
Ziel: Die Praxen möglichst wenig be
lasten, sich aber auch nicht weit vom
bisherigen Modell entfernen.
Die KV stellte das Modell auf ihrer
jüngsten Vertreterversammlung vor.
Die Idee stammt aus dem Berufsver
band der Orthopäden und Unfallchir
urgen und findet unter weiteren Ver
bänden Zustimmung.
So soll das Modell funktionieren:
Patienten erhalten von ihrem Hausarzt
eine Überweisung und suchen sich zu
nächst wie bislang selbst einen Fach
arztTermin. Gelingt dies nicht in ak
zeptabler Zeit, holt sich der Patient ei
nen Überweisungscode beim Hausarzt
und wendet sich damit an die Termin
servicestelle, die alle Daten von ihm
aufnimmt, ihm einen Facharzt in
Wohnortnähe und einen Gutschein
code nennt. Mit diesem Code, der als
Etikett auf die Überweisung geklebt
wird, wendet sich der Patient an den
betreffenden Facharzt, der ihm einen
Termin innerhalb der gesetzlichen
VierWochenfrist nennt.
Der Facharzt koppelt die Terminver
einbarung über das elektronische
KVSHPortal zurück, sodass dort eine
Auswertung aller vermittelten Termine
erfolgen kann. Die Terminservicestelle
stellt über einen Verteilungsalgorithmus
sicher, dass eine gleichmäßige Bean
spruchung der Fachärzte unter Berück
sichtigung der regionalen Dichte erfolgt.
Sollte kein Termin in einer Praxis mög
lich sein, vermittelt die Stelle einen Ter
min im Krankenhaus. Dazu sind eine
Rahmenvereinbarung mit der Kranken
hausgesellschaft und feste Ansprech
partner in den Kliniken erforderlich.
Das Modell erfüllt mehrere KVZiele:
Die meisten Patienten werden ohne Ein
schaltung der Terminstelle ihren Fach
arzttermin weiter selbst organisieren,
weil sie eine Wunschpraxis bevorzugen.
So wird wenig in die bisherige Praxis
eingegriffen. Fachärzte müssen eine be
grenztere Zahl an Terminen als bei Al
ternativmodellen an die Servicestelle
melden. Und es ist eine saubere Auswer
tung der vermittelten Termine möglich.
KVVorstand Dr. Ralph Ennenbach
hofft, dass die Auswertung eine „Do
kumentation des Unsinns“ der von
Ärzten unbeliebten Terminservicestel
len ermöglicht. Er erwartet, dass Pati
enten nur drei von fünf Terminen
wahrnehmen. Die KV stellte klar, dass
die Terminservicestelle zu vergleich
baren Zeiten wie Arztpraxen erreich
bar sein wird und von Patienten nicht
als „Medizinservicestelle“ genutzt
werden kann.
(di)
Die KV SchleswigHolstein
will die ungeliebte Termin
servicestelle mit einem Gut
scheinModell umsetzen. Es
soll Praxen wenig belasten.
BürokratieDiät: Per Gutschein zum Termin
6
November 2015
BDI aktuell
Berufspolitik
Eine „Innovationsbremse“ sieht die
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie
(DGK) in der im GKVVersorgungs
stärkungsgesetz geforderten Nutzen
bewertung für bestimmte Medizinpro
dukte. „Wir glauben, dass diese Rege
lungen gewaltige Auswirkungen auf
die Einführung innovativer Medizin
technik haben werden“, sagte DGK
Präsident Professor KarlHeinz Kuck
bei der DGKHerbsttagung in Berlin.
Das Versorgungsstärkungsgesetz
sieht für Medizinprodukte mit hoher
Risikoklasse, die wie etwa Implantate
oder Herzschrittmacher invasiv einge
setzt werden, eine Nutzenbewertung
vor. Anhand wissenschaftlicher Evi
denz sei nachzuweisen, dass die Inno
vation im Vergleich zu den bisher ein
gesetzten Verfahren einen Zusatznut
zen bringt, so Kuck. Er fürchtet, dass
sich die großen Erfolge, die in den ver
gangenen 20 Jahren etwa bei der Re
duzierung der kardialen Sterblichkeit
auch durch Innovationen bei Medizin
produkten erreicht wurden, in Zukunft
nicht mehr so fortschreiben lassen.
Die große Frage der Zukunft werde
sein, wie sich der Zusatznutzen eines
Medizinprodukts überhaupt nachwei
sen lasse. Die Methoden der Pharma
industrie, wie etwa die placebokontrol
lierte Studie oder die doppelte Ver
blindung, seien nicht übertragbar.
Hohe GBAAnforderungen befürchtet
Kuck äußerte die Befürchtung, dass
die Anforderungen an den Nachweis
durch den Gemeinsamen Bundesaus
schuss (GBA) recht hoch angesetzt
werden könnten. Das bisher in
Deutschland praktizierte innovations
freundliche Prinzip, nach dem Kran
kenhäuser alle zugelassenen Verfahren
einsetzen dürfen, so lange sie nicht
verboten sind, werde womöglich durch
ein Konzept der Innovationsbremse
abgelöst. „Wenn die Hürden so hoch
sind, dass sie nicht refinanzierbar wer
den, dann werden wir die neuen inno
vativen Produkte nicht verfügbar be
kommen oder nur mit erheblicher zeit
licher Verzögerung“, warnte Kuck.
Zudem bestehe die Gefahr, dass
sich Forschergruppen und medizini
sche Zentren aufgrund unrealistischer
Auflagen nicht mehr an internationa
len Studien zu Medizinprodukten be
teiligen können. Kuck nannte als Bei
spiel aus der Vergangenheit eine Stu
die zu einem elektrodenlosen Herz
schrittmacher. Das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) hatte damals zur Auflage ge
macht, nur Patienten einzuschließen,
die keinen anderen Herzschrittmacher
vertragen. „Das wäre in Deutschland
nur jeder 100000. Patient gewesen“,
so der DGKPräsident. Mangels Pati
enten sei die Studie hierzulande also
nicht durchführbar gewesen.
AOK fordert strengere Verfahren
Für neue Diskussion in der Debatte
um das Zulassungsverfahren für Medi
zinprodukte könnte der Bandschei
benSkandal in Niedersachsen sorgen.
Das Klinikum Leer berichtete von
zahlreichen RevisionsOperationen,
die nötig wurden, weil Patienten eine
defekte BandscheibenProthese einge
setzt bekommen haben.
Da die mangelhaften Prothesen
auch an andere Kliniken geliefert wur
den, rechnen Kassen mit mehr als
11000 Fällen. Die AOK Niedersach
sen hat in diesem Zusammenhang er
neut ein strengeres Zulassungsverfah
ren für Medizinprodukte gefordert.
(juk/ths)
Kardiologen: Hohe Hürden für
Innovationen treffen Patienten
Die Deutsche Gesellschaft
für Kardiologie schlägt
Alarm: Die vorgesehene
Nutzenbewertung für Medi
zinprodukte wie Implantate
oder Herzschrittmacher
könnte sich als Fortschritts
bremse erweisen.
Für Herzschrittmacher oder Implantate, die invasiv eingesetzt werden, sieht das Versorgungsstärkungsgesetz eine Nutzenbewertung vor.
© MATHIAS ERNERT, DEUTSCHES HERZZENTRUM BERLIN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
In den vergangenen
20 Jahren ist die
kardiale Sterblich
keit beim akuten
Herzinfarkt um 40
Prozent zurückge
gangen.
Professor KarlHeinz Kuck
Präsident der DGK