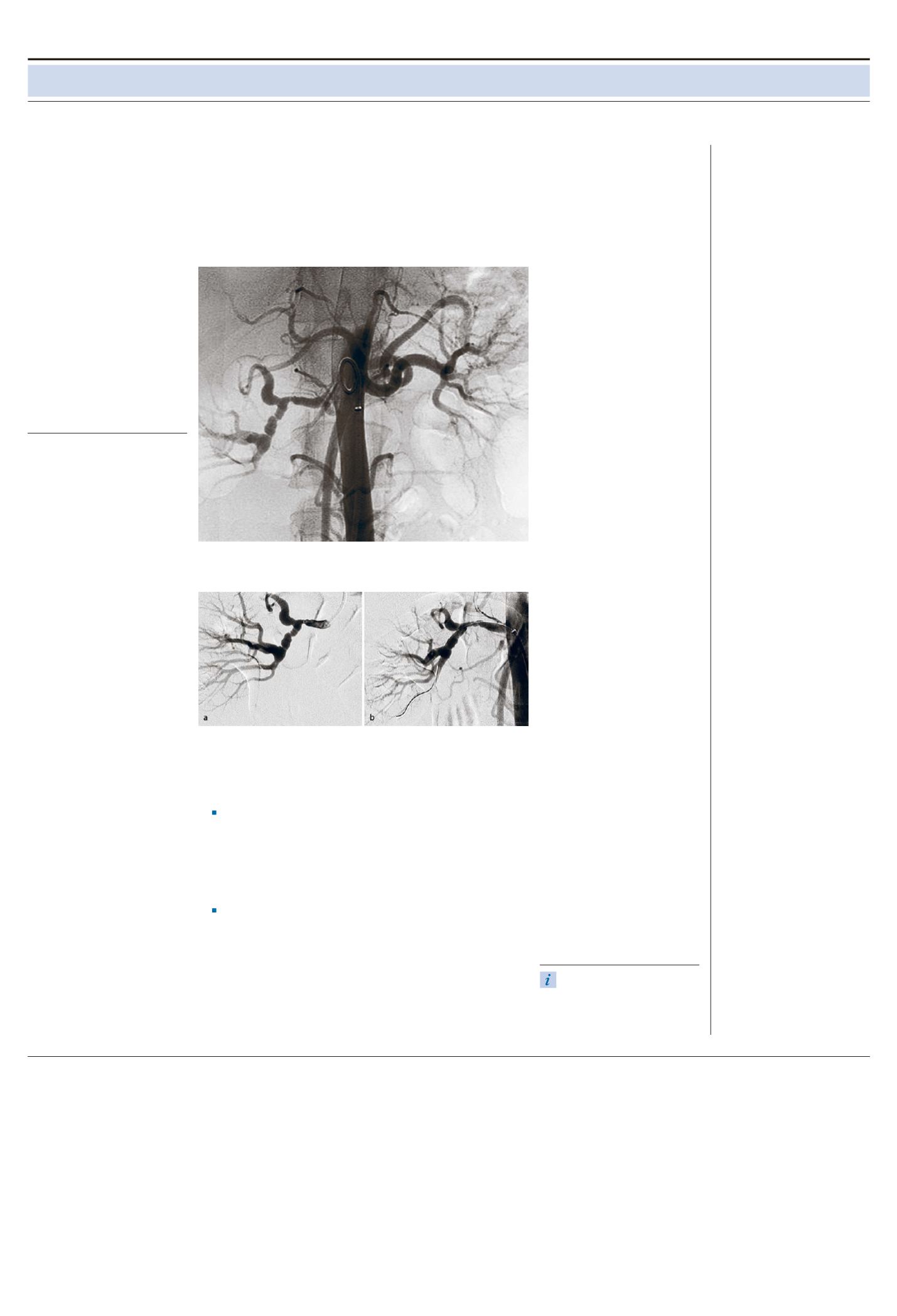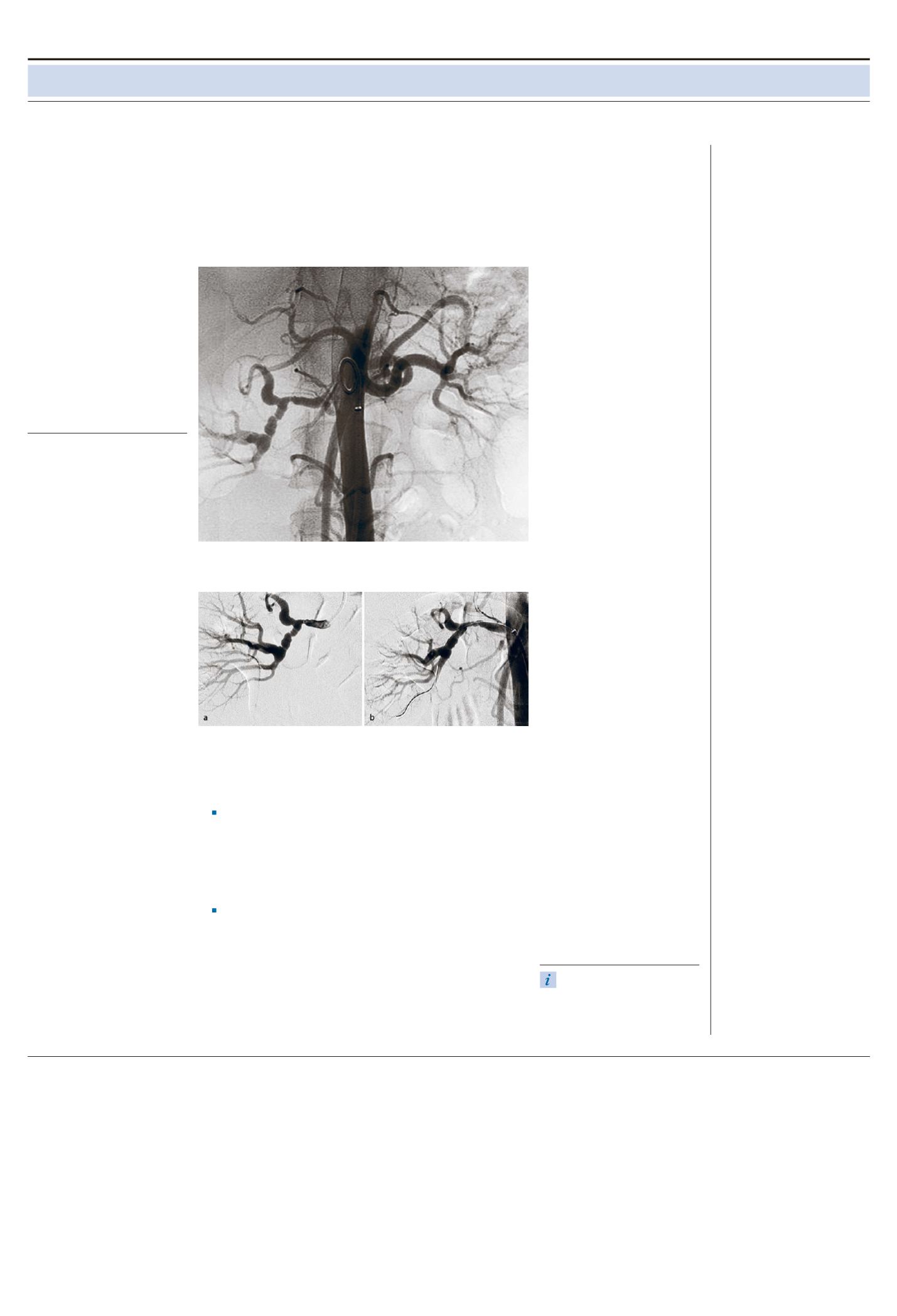
Medizin
BDI aktuell
November 2015
15
Neurologen um Dr. Nathália Viso
ná de Figueiredo aus São Paulo
dachten nicht gleich an Neurolues,
als sich bei ihnen eine 50jährige
Frau mit plötzlicher Hemiparese
und einer linksseitigen taktilen Hy
poästhesie vorstellte (JAMA Neu
rol., online 27. April). Das MRT
deutete auf einen ischämischen
Schlaganfall in der rechten tempo
parietalen Region. Zudem war an
deutungsweise ein BasilarAneurys
ma zu erkennen. Die Angiografie
bestätigte die Gefäßaussackung und
deckte zwei weitere Aneurysmen in
der mittleren Zerebralarterie auf.
Die Neurologen hätten es nun
dabei belassen können: Mehrere
Aneurysmen und ein Schlaganfall,
eigentlich schien damit alles klar.
Stutzig wurden sie jedoch, als ihnen
der schlechte kognitive Zustand der
Patientin auffiel. Im MiniMental
StatusTest schaffte sie gerade noch
20 Punkte und hatte damit fast
schon eine moderate Demenz. Die
Neurologen wollten eine infektiöse
Ursache ausschließen und veran
lassten eine Liquoruntersuchung.
Dabei fanden sie eine erhöhte Pro
teinkonzentration, der VDRLTest
auf Treponema pallidum war posi
tiv, und es zeigten sich im Blut An
tikörper gegen den Erreger.
Aneurysmen kommen immer
wieder bei SyphilisInfektionen vor.
Vermutet wird, dass die Erreger die
Gefäßwände infiltrieren und zu ei
ner Entzündungsreaktion führen,
die dann auch Infarkte auslösen
kann. Die Forscher konnten einen
Zufallsbefund zwar nicht ausschlie
ßen, vermuteten aber einen Zusam
menhang zwischen der Infektion,
der frühen Demenz, den Aneurys
men und dem Schlaganfall. Vor al
lem bei einer präsenilen Demenz
sollten Ärzte auch eine infektiöse
Ursache wie Syphilis ausschließen,
schreiben sie. In dem beschriebe
nen Fall kam die Hilfe jedoch zu
spät: Trotz PenicillinAntibiose ver
besserte sich die kognitive Leistung
nicht mehr.
Seit 1990 hat sich die Syphilis
Inzidenz in etwa verdreifacht; jähr
lich werden zwischen 3000 und
3500 Neuerkrankungen in
Deutschland gemeldet. Da eine
Neurosyphilis mit gewisser Latenz
auftritt, könnten auch in Deutsch
land bald wieder häufiger ZNS
Komplikationen durch Treponema
pallidum beobachtet werden.
(mut)
Demenz mit
50: Schuld war
die Syphilis
Eine 50Jährige wurde
durch geistigen Abbau,
neurologische Probleme,
Aneurysmen und Apo
plexie auffällig.
KASUISTIK
Den Autoren von der Pittsburgher
Uniklinik wird ein 46jähriger Patient
zur Abklärung von RadikulopathieBe
schwerden zugewiesen (Clin Orthop
Relat Res 2015; online 10. April). Seit
er vor einem Jahr ein schweres Arbeits
gerät gehoben hat, leidet der Mann an
Kreuzweh und an Schmerzen, die vom
rechten hinteren Oberschenkelbereich
aus in den Unterschenkel und den
Fuß ausstrahlen.
Seine Symptome führen den Pati
enten zuerst zum Chiropraktiker, ohne
Erfolg. Der Hausarzt verordnet physi
kalische Therapie. Als das nichts
bringt, veranlasst er ein MRT und
schickt den Mann zum Spezialisten für
epidurale Steroidinjektionen. Es tritt
keine Besserung ein. Parallel beginnt
eine GabapentinTherapie. Der Mann
erzählt den Orthopäden auch von ei
ner ipsilateralen Oberschenkelzerrung.
Seine Beschwerden, so sagt er, näh
men beim Sitzen zu.
Die Untersuchung des rechten
Beins ergibt eine normale Kraft im
Unterschenkel, eine Sensibilitätsmin
derung an der Unterseite der Ferse
und seitlich am Fuß sowie einen abge
schwächten Achillessehnenreflex. Bei
der Palpation des Oberschenkels ist in
der Tiefe des Weichteilgewebes eine
Raumforderung tastbar. Das Hoff
mannTinelZeichen ist positiv, die
Parästhesien strahlen beim Palpieren
in den Fuß aus. Nachdem das MRT
der LWS die Symptome nicht klärt,
werden eine konventionelle Röntgen
aufnahme und ein KontrastMRT ge
macht. Schon im Röntgenbild zeigt
sich eine Weichteilverdichtung im hin
teren rechten Oberschenkel. Das
MRT zeigt eine 6 x 7 cm große Weich
teilmasse, die den Ischiasnerv um
schließt. Weitere Tests sichern die Di
agnose: extraossäres EwingSarkom.
Das Staging verläuft negativ. Der Pati
ent unterzieht sich präoperativ drei
ChemotherapieZyklen mit Vincristin,
Ifosfamid, Doxorubicin und Etoposid.
Dies lässt den Tumor schrumpfen.
Vier Wochen nach dem letzten Zyklus
wird der Tumor chirurgisch en bloc
entfernt. Postoperativ erhält der Pati
ent zwei adjuvante ChemotherapieZy
klen wie gehabt, dazu noch vier Zyklen
mit Vincristin, Actinomycin und Ifos
famid.
(rb)
Orthopäden berichten über
eine nicht alltägliche Ursa
che für die Symptome einer
lumbalen Radikulopathie.
Lumbale Radikulopathie: Die Bandscheibe war es nicht!
Eine 34jährige Patientin stellte sich
vor mit arterieller Hypertonie, die seit
vier Jahren bekannt ist. Ambulant war
zur Abklärung der Hypertonie eine
farbkodierte Duplexsonographie der
Nierenarterien durchgeführt worden.
Aktuell ist der Blutdruck unter der
Medikation mit Metoprolol 95 mg 1
00 gut eingestellt. Es bestehen keine
weiteren Beschwerden.
Klinischer Befund
Patientin in altersentsprechendem AZ
und schlankem EZ. Herz, Lunge und
Abdomen mit unauffälligem Untersu
chungsbefund. Blutdruck bei stationä
rer Aufnahme 134/93 mmHg.
Labor und apparative Untersuchungen
Unauffällige Werte für Blutbild, Krea
tinin, Harnstoff, Elektrolyte, Leber
werte, CrP, CK, LDH und venöse
Blutgasanalyse.
Die farbkodierte Dupexsonogra
phie zeigt eine unauffällige linke Nie
renarterie mit einem V
max
unter 1 m/s.
Die rechte Nierenarterie hingegen
zeigt im Abgang ein pathologisches
Strömungssignal mit reduzierter Amp
litude und vermindertem Strömungs
anstieg; 2 cm nach Abgang dann Tur
bulenzen und eine Strömungsbe
schleunigung bis auf über 4 m/s. Intra
renal weisen beide Nieren eine deut
lich seitendifferente Perfusion auf. Der
ResistanceIndex ist rechts
(0,43–0,45) deutlich kleiner als links
(0,56–0,61). Die rechte Niere ist mit
einem Längsdurchmesser von 9,5 cm
deutlich kleiner als die linke Niere mit
11,7 cm.
Die Langzeitblutdruckmessung
zeigt einen Mittelwert von 132/83,
tagsüber 135/85 und nachts 121/74.
Prozedere
Bei der Patientin wurde eine Angio
graphie durchgeführt (siehe Abbildung
1).
Es zeigte sich eine kurzstreckige
mittelgradige Stenose der A. renalis
dextra unmittelbar proximal der Auf
zweigung sowie mehrere hintereinan
dergeschaltete, perlschnurartige Ein
engungen im unteren Hauptast. Die
Diagnose: Nierenarterienstenose
rechts durch fibromuskuläre Dysplasie
Diagnostik und Therapie
Warum sucht man bei einem Hoch
druckpatienten eine Nierenarterienste
nose? Zum einen möchte man durch
Korrektur der Stenose den Blutdruck
senken und zum anderen die Nieren
funktion verbessern oder eine zukünf
tige Verschlechterung der Nierenfunk
tion der stenosierten Niere verhindern.
Angioplastie und Stentung von arte
riosklerotischen Stenosen sind inzwi
schen technisch leicht durchzuführen,
gut etabliert und werden flächende
ckend durchgeführt.
Senken Angioplastie und Stent den
Blutdruck und verbessern die Nieren
funktion? Die Antwort fällt leider ne
gativ aus. Mit CORAL ist die bisher
größte randomisierte Studie publiziert
worden, bei der Patienten mit arterio
sklerotischer Nierenarterienstenose di
latiert oder medikamentös behandelt
wurden (N Engl J Med 2014;
370:13–22). Über einen Zeitraum von
fünf Jahren ergab die Korrektur der
Stenose keinen Benefit in renalen und
kardiovaskulären Endpunkten. Sie be
stätigt damit die Ergebnisse der
ASTRALund der STARStudie (N
Engl J Med 2009; 361:1953–1962,
Ann Intern Med 2014; 150:840–848).
Wie immer, wenn eine Studie liebge
wonnene Eingriffe in Frage stellt, gibt
es Kritik an der Studie. Die vermutlich
beste Erklärung für den negativen
Ausgang der randomisierten Studien
ist, dass die in den Studien und damit
auch im klinischen Alltag dilatierten
Stenosen weder für den Hochdruck
noch für die Niereninsuffizienz verant
wortlich sind und damit ihre technisch
erfolgreiche Korrektur auch beide
nicht beeinflussen kann. Es mag noch
Einzelindikationen für die Korrektur
von arteriosklerotischen Nierenarte
rienstenosen geben, ein routinemäßi
ges Suchen danach und Korrigieren
kann nicht mehr empfohlen werden.
Anders sieht es bei jungen Hoch
druckpatienten aus. Bei ihnen liegen
parallel keine essenzielle Hypertonie
und keine Nierenerkrankung vor. Kor
rektur der Stenose durch Ballonangio
plastie führt zu einer langanhaltenden
Offenheit der Arterie und senkt den
Blutdruck (J Hypertens 2014;
32:1367–1378). Stenteinlage ist in den
meisten Fällen nicht notwendig. Auch
hier liegen keine randomisierten Stu
dien vor, die Intervention mit medika
mentöser Therapie vergleichen.
Da aber die Intervention einen so
eindeutigen Erfolg hat und fibromus
kuläre Nierenarterienstenosen sehr
selten sind, sind randomisierte Studien
ethisch nicht vertretbar und auch nicht
möglich. Im vorliegenden Fall war die
Stenose sicher hämodynamisch rele
vant, da es schon zur Schrumpfung
der betroffenen Niere gekommen war.
Eine Größendifferenz von mehr als 1
cm ist eine harte Indikation für eine
Angioplastie (J Hypertens 2014;
32:1367–1378).
Weiteres Prozedere und Verlauf
Es wurde eine erfolgreiche perkutane,
transluminale Angioplastie der Eng
stellen in der rechten Nierenarterie
durchgeführt (siehe Abbildung 2). Es
wurde Acetylsalicylsäure (ASS) 100
mg 100 für 4 Wochen verordnet. Der
bei Entlassung gemessene Blutdruck
betrug 111/60 mmHg.
Quelle: Turner JE,Henes F O et al (2015)
Arterielle Hypertonie bei einer jungen Pati
entin Dos and Donts in Diagnostik und
Therapie der sekundären Hypertonie.
Nephrologe 10:135136. Der Abdruck
erfolgte mit freundlicher Genehmigung der
Autoren.
Die Kasuistik stellt den Fall
einer 34jährigen Patientin
mit arterieller Hypertonie
vor. Es stellt sich heraus,
dass eine Stenose der
rechten Nierenarterie durch
fibromuskuläre Dysplasie
für den Bluthochdruck
verantwortlich ist.
Kasuistik: Arterielle Hypertonie
bei einer jungen Patientin
Von J.ETurner, F. O. Henes et al.
Abb.1: Aortographie: Kurzstreckige mittelgradige Stenose der A. renalis dextra proximal
der Aufzweigung sowie Einengungen im unteren Hauptast.
© SPRINGER VERLAG GMBH
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Fazit für die Praxis
Die Indikationsstellung
zur
Diagnostik und Intervention bei
atherosklerotischen Nieren
arterienstenosen sollte
zurückhaltend erfolgen. Eine
Intervention mag weiterhin
sinnvoll sein bei ausgewählten
Hochrisikopatienten.
Bei jungen Hochdruckpatienten
,
insbesondere bei Frauen, ist eine
Nierenarteriendiagnostik
weiterhin sinnvoll, und
fibromuskuläre Stenosen können
und sollten angegangen werden.
Abb. 2: Angiographie der rechten Nierenarterie vor (a) und nach (b) erfolgreicher
perkutaner transluminaler Angioplastie mittels Ballonkatheter.
© SPRINGER VERLAG GMBH