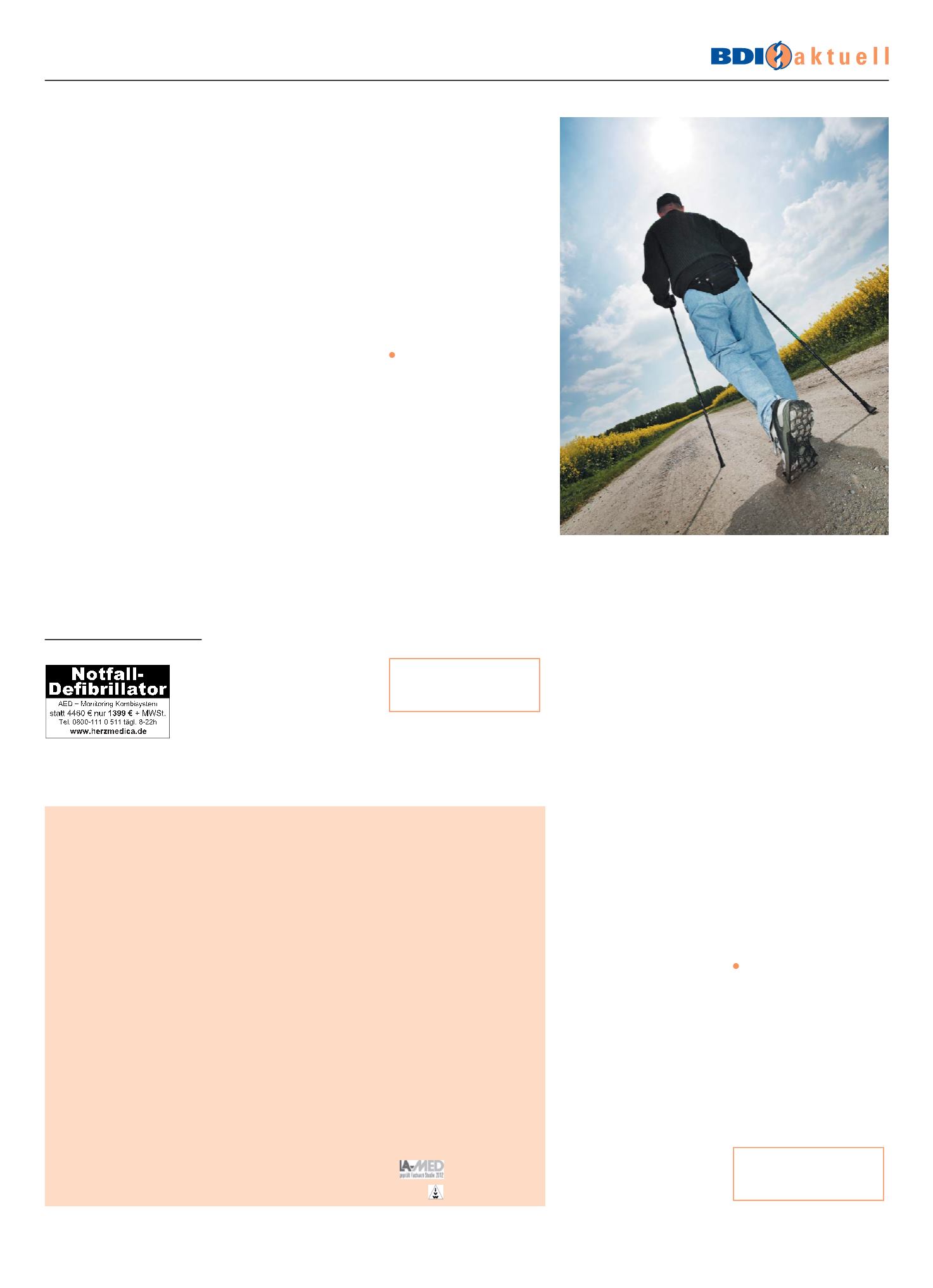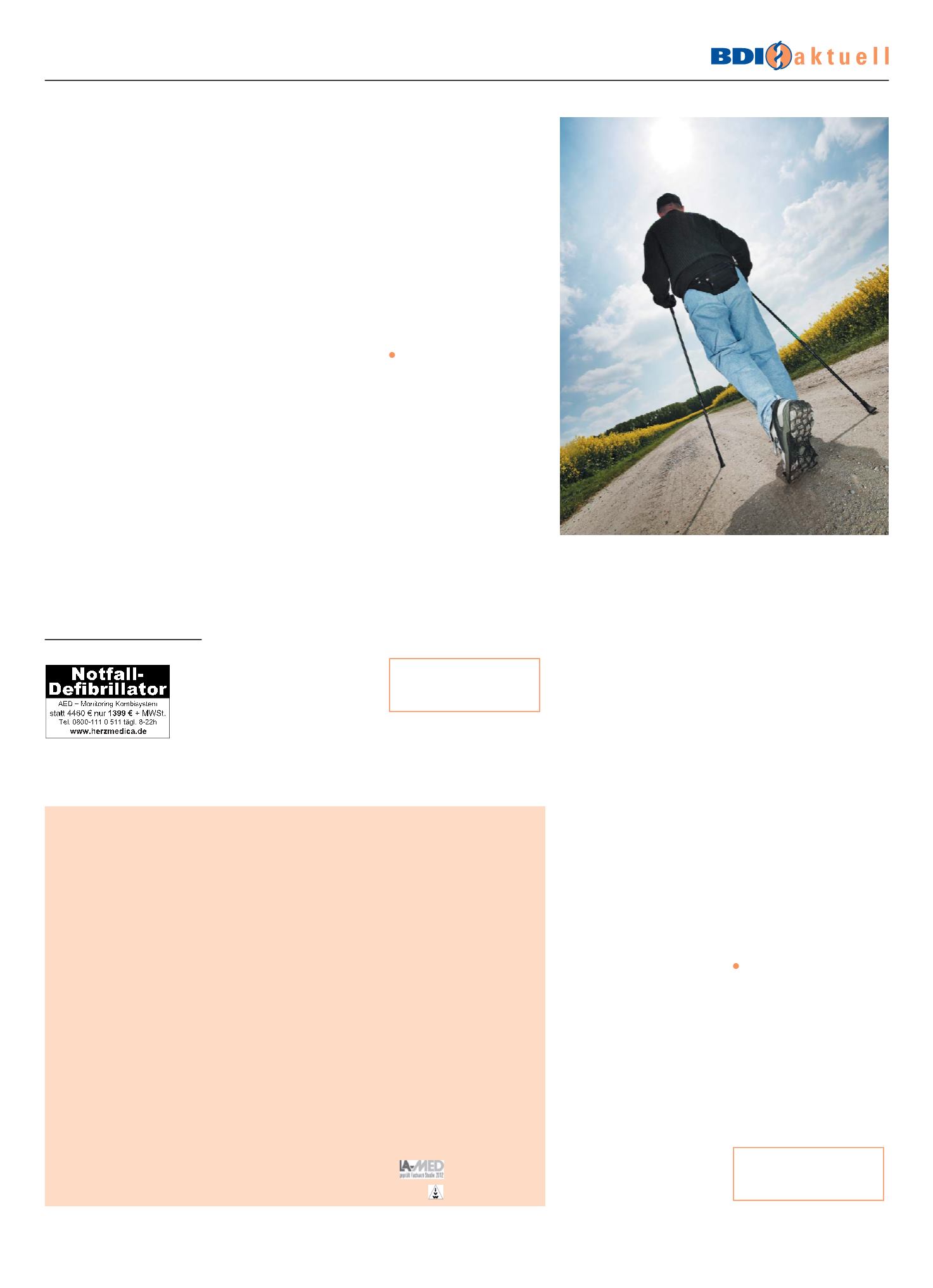
Medizin
Nr. 11 • November 2013
12
BDI aktuell wird vom Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) e.V. herausgegeben und erscheint im Georg Thieme Verlag KG. Die Zeitung erscheint
monatlich mit Doppelnummer im August/September. BDI-Mitglieder erhalten BDI aktuell im Rahmen ihres BDI-Mitgliedsbeitrags.
Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) e.V.
•
• Schöne Aussicht 5, 65193 Wiesbaden • Tel.: 0611/181 33-0 • Fax: 0611/181 33-50
• E-Mail:
• Präsident: Dr. med. Wolfgang Wesiack • Geschäftsführer: Tilo Radau
Georg Thieme Verlag KG
Stuttgart New York •
• Rüdigerstr. 14, 70469 Stuttgart • Tel.: 0711/8931-0, Fax: 0711/8931-235
• E-Mail:
Redaktion:
Chefredakteur: Dr. med. Hans-Friedrich Spies (HFS), V.i.S.d.P • Redaktion (Mantelteil): Dr. med. Stefanie Conrads • Layout-Entwurf (Mantelteil):
Michael Zimmermann • Layoutentwurf und Redaktion (Kongresse & Services) sowie Herstellung und Layout: Andrea Hartmann
• Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, Leibnizstraße 5, 97204 Höchberg
Weitere Mitarbeiter und Autoren dieser Ausgabe:
Klaus Schmidt (KS) sowie die namentlich unter den Artikeln genannten Autorinnen und Autoren
Anzeigenverwaltung/-leitung:
Manfred Marggraf, pharmedia Anzeigen- und Verlagsservice GmbH, Rüdigerstr. 14, 70469 Stuttgart, Tel.: 0711/8931-
464, Fax: 0711/8931-470, E-Mail:
• Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6.
Kleinanzeigen
schicken Sie bitte an die BDI-Geschäftsstelle (Adresse s.o.) oder an
Wichtiger Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere
Erkenntnisse, insbesondere was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Heft eine Dosierung oder eine Applikation
erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass die Autoren und der Verlag große Sorgfalt daran verwandt haben, dass diese Angabe dem Wis-
sensstand bei Fertigstellung der Zeitung entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine
Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der verwendeten Präparate und gegebenen-
falls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindikationen
gegenüber der Angabe in dieser Zeitung abweicht. Eine solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten oder solchen, die neu
auf den Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden
Benutzer, ihm auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen. Geschützte Warennamen werden nicht in jedem Fall besonders kenntlich gemacht.
Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright:
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Impressum
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
LA-MED Kommunikationsforschung
im Gesundheitswesen e. V.
Mitglied der Informationsgemein-
schaft zur Feststellung der Verbrei-
tung von Werbeträgern e. V.
Insgesamt 5145 Patienten mit einem
Typ-2-Diabetes nahmen an der Stu-
die teil. Einschlusskriterien waren
u.a. ein Alter von 45-75 Jahren, Über-
gewicht (BMI ≥ 25), ein HbA
1c
≤ 11%,
maximale systolische und diastoli-
sche Blutdruckwerte von 160 und
100 mmHg und ein Triglycerid-Spie-
gel < 600 mg/dl. 2570 Teilnehmer
wurden in die Gruppe mit einer
intensiven Umstellung der Lebensge-
wohnheiten randomisiert. Sie wur-
den intensiv in Gruppen- und Einzel-
sitzungen betreut, waren mindestens
175 Minuten pro Woche körperlich
aktiv und reduzierten die Energieauf-
nahme auf 1200–1800 kcal täglich.
Die 2575 Teilnehmer der Kontroll-
gruppe erhielten Unterstützung und
Schulungen.
Die Teilnehmer waren durchschnitt-
lich 58,7 Jahre alt, hatten einen BMI
von 36, hatten den Diabetes seit 5
Jahren, 14% hatten bereits kardiovas-
kuläre Probleme gehabt. Nach der
Beobachtungszeit von 9,6 Jahren
lagen von 96% der Patienten auswert-
bare Daten vor. Verglichen mit der
Kontrollgruppe nahmen die Teilneh-
mer der Interventionsgruppe stärker
ab. Die Unterschiede waren im ersten
Jahr am größten (8,6% vs. 0,7%), blie-
ben aber über den gesamten Zeit-
raum signifikant. Am Ende der Studie
betrug der Gewichtsverlust 6% (Inter-
ventionsgruppe) vs. 3,5% (Kontroll-
gruppe). Der Taillenumfang nahm in
der Interventionsgruppe stärker ab
und der regelmäßige Sport erhöhte
die körperliche Fitness. Die kardio-
vaskulären Risikofaktoren (u. a.
HbA
1c
) wurden durch die Lebensstil-
änderung positiv beeinflusst und der
Medikamentenbedarf, insbesondere
von Insulin, war geringer.
403 Patienten der Interventions- und
418 Patienten der Kontrollgruppe
starben an kardiovaskulären Erkran-
kungen, hatten Myokardinfarkte und
Schlaganfälle oder waren wegen
Angina pectoris stationär behandelt
worden. Der Gruppenunterschied
war nicht signifikant (1,83 und 1,92
Ereignisse pro 100 Personenjahre;
Hazard Ratio 0,95; 95%-Konfidenzin-
tervall 0,83–1,09; p=0,51). Schwere
Hypoglykämien, Gallensteine, Ampu-
tationen, kongestive Herzinsuffizien-
zen und Frakturen unterschieden sich
nicht signifikant zwischen den bei-
den Gruppen.
Fazit
Trotz unbestreitbarer Vorteile, wie
einer gesteigerten Fitness, besseren
Beweglichkeit, dem reduziertem
Medikamentenbedarf und der positi-
ven Beeinflussung von Risikofakto-
ren, wurde die erwartete Konsequenz
einer geringeren kardiovaskulären
Morbidität und Mortalität nicht
erfüllt. Die Autoren sehen die Gründe
dafür u. a. in der möglicherweise
unzureichenden Gewichtsreduktion,
fehlenden Beeinflussung bestimmter
Ernährungskomponenten sowie der
hohen Motivation und Schulung der
Kontrollgruppe.
Sponsoring:
Die Studie wurde von
öffentlichen Institutionen und Phar-
maunternehmen finanziell unter-
stützt.
Dr. med. Susanne Krome
Der Beitrag ist erstmals erschienen in der
Deutschen Medizinischen Wochenschrift
(Dtsch Med Wochenschr 2013; 138:1923).
Alle Rechte vorbehalten.
Übergewichtigen und adipösen Patienten mit Typ-2-Diabetes wird eine Gewichtsreduktion
empfohlen. Ob eine intensive Lebensstilintervention zur Gewichtsreduktion die Mortalität
und Morbidität in dieser Population senkt, untersuchte nun die Look-AHEAD-Gruppe in
einer randomisierten, multizentrischen klinischen Studie.
N Engl J Med 2013; 369: 145-154
Diabetologie
Typ-2-Diabetes: Wie wirksam ist eine
intensive Lebensstilintervention?
Eine intensive Lebensstilmodifikation mit körperlicher Aktivität zur Gewichtsreduktion bei
Typ-2-Diabetes reduzierte die Mortalität und Morbidität nicht, so die Autoren (Quelle:
MEV).
Die 351 Studienteilnehmer litten an
einer leicht bis mäßig ausgeprägten
Kniegelenksarthose mit gleichzeiti-
gem Meniskuseinriss. Sie wurden ran-
domisiert einer von zwei Gruppen
zugewiesen:
▶ Gruppe 1: arthroskopische Teil-
Meniskektomie mit Meniskusglät-
tung und anschließender standardi-
sierter Physiotherapie (n = 161)
▶ Gruppe 2: alleinige Physiotherapie
(n = 169)
Beurteilt wurde als primärer End-
punkt der Unterschied zwischen bei-
den Behandlungsgruppen gemäß dem
WOMAC-Score 6 Monate nach der
Randomisierung. Der WOMAC reicht
von 1 bis 100, wobei höhere Werte
stärkere Beschwerden bedeuten. Die
Ergebnisse zeigten vergleichbare
Befundbesserungen, mit 20,9 Punkten
in der Arthroskopiegruppe und 18,5
Punkten in der konservativ behandel-
ten Gruppe. Allerdings waren insge-
samt 51 Patienten, die der Gruppe 2
zugewiesen worden waren, innerhalb
der 6 Monate doch noch operiert wor-
den. 9 Patienten aus Gruppe 1 hatten
dahingegen nur Physiotherapie erhal-
ten. Eine abschließende Untersuchung
12 Monate nach Studienbeginn zeigte
stabile Ergebnisse ohne erneute Ver-
schlechterungen.
Fazit
Nach 6 Monaten konnte zwischen den
Behandlungsgruppen kein signifikan-
ter Unterschied festgestellt werden.
30% der Patienten, die eine alleinige
Physiotherapie erhalten sollten, wur-
den jedoch innerhalb der 6 Monate
operiert, so die Autoren.
Sponsoring: Die Studie wurde von einer
öffentlichen Institution finanziert.
Dr. med. Elke Ruchalla
Der Beitrag ist erstmals erschienen in der
Deutschen Medizinischen Wochenschrift
(Dtsch Med Wochenschr 2013; 138:1642).
Alle Rechte vorbehalten.
Zwei Drittel der Meniskusrisse sind asymptomatisch; falls aber bei
gleichzeitiger Arthrose des Kniegelenks Beschwerden auftreten, wird
das optimale Vorgehen kontrovers diskutiert. Wird der Meniskusriss
für ursächlich gehalten, kann eine arthroskopische Teil-Meniskekto-
mie durchgeführt werden. Bessert dies aber die Beschwerden stärker
als die alleinige Physiotherapie? Katz et al. haben beide Verfahren
verglichen.
N Engl J Med 2013; 368: 1675-1684
Orthopädie
Meniskusriss bei Knie-
gelenksarthrose: Operieren
oder Trainieren?
– Anzeige –