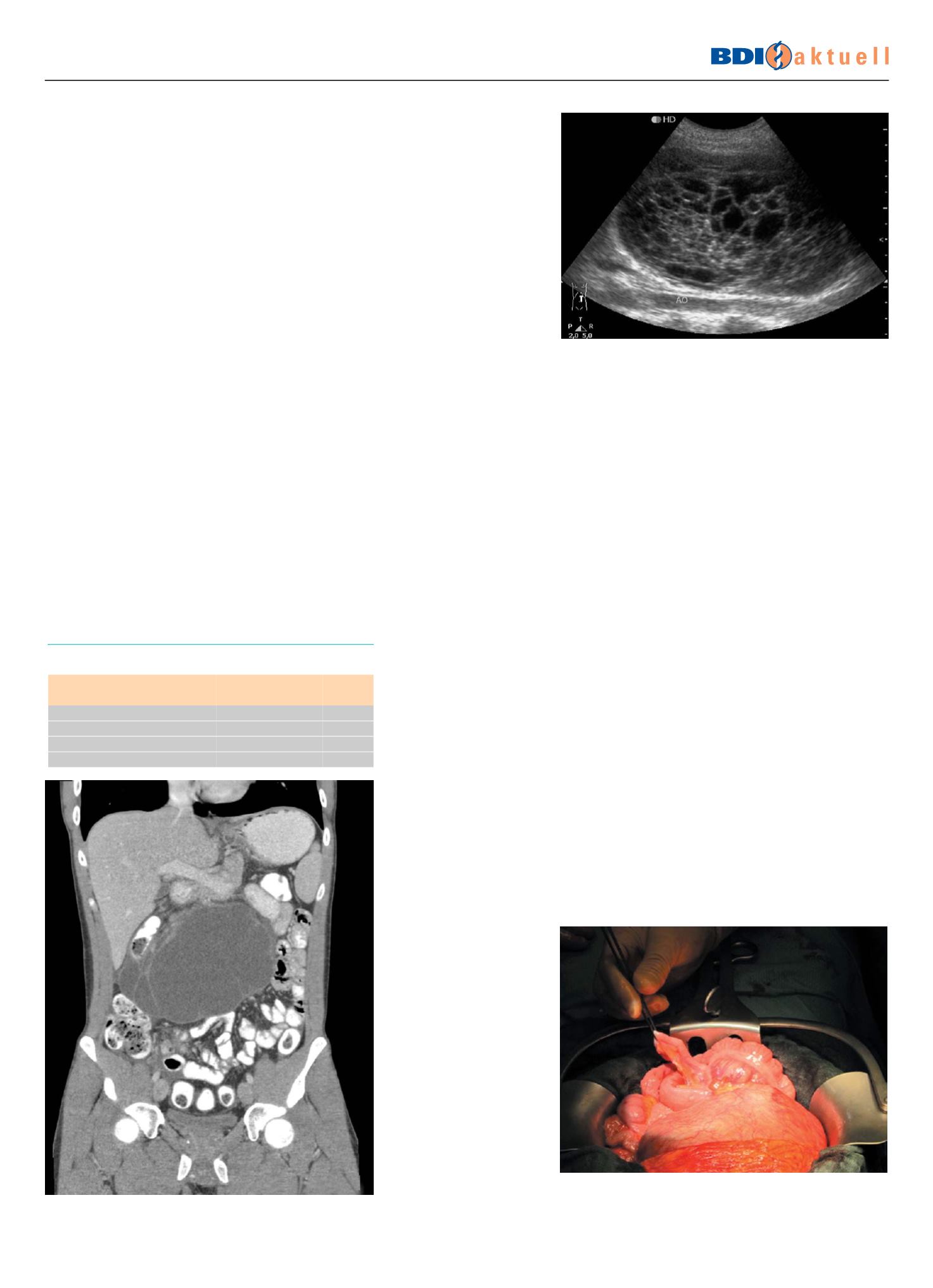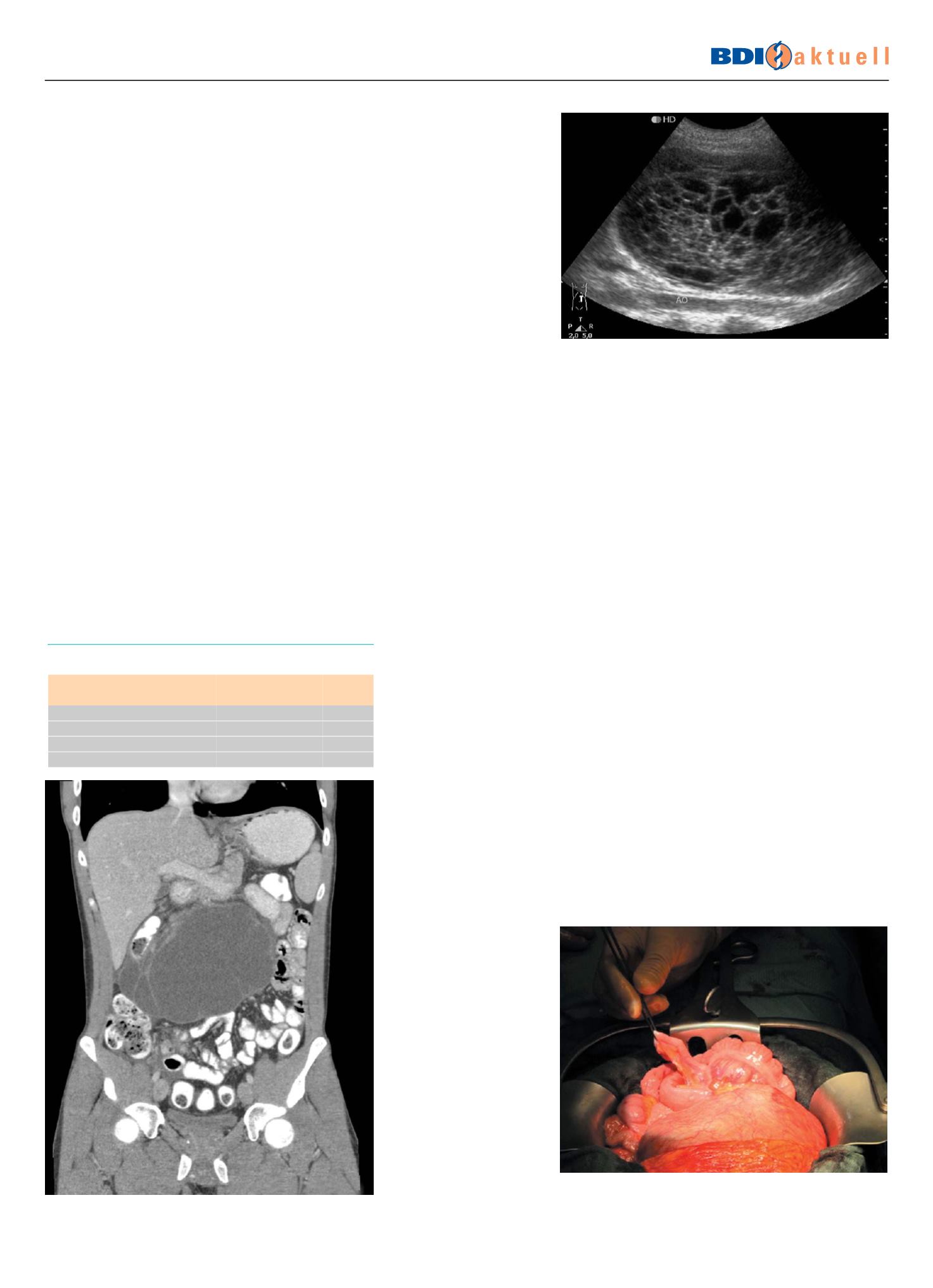
Medizin
Nr. 11 • November 2013
10
Die Appendizitis ist die häufigste spe-
zifische Ursache akuter abdomineller
Beschwerden [7]. Rechtsseitige, peri-
tonitische Unterbauchschmerzen bei
einem jungen Patienten lassen an die-
ses Krankheitsbild denken. In dem
vorgestellten Fall konnte bei einem
Patienten mit diesen Beschwerden
durch eine geeignete Bildgebung und
ein besonnenes chirurgisches Vorge-
hen eine seltene Differenzialdiagnose
gestellt und behandelt werden.
Kasuistik
Anamnese
Ein 17-jähriger Mann stellte sich mit
seit 3 Tagen bestehenden periumbili-
kalen Schmerzen vor, die im Verlauf
in den rechten Unterbauch gewandert
seien. Übelkeit, Erbrechen und Stuhl-
unregelmäßigkeiten wurden verneint.
Vorerkrankungen oder -operationen
waren nicht bekannt. Eine dauerhafte
Medikamenteneinnahme oder ein
Trauma wurden verneint.
Körperlicher Untersuchungsbefund
Der sehr schlanker Patint wies eine
diskrete Vorwölbung der Bauchdecke
im rechten Mittel- und Unterbauch
durch eine tastbare, derbe, etwa
kindskopfgroße Raumforderung auf.
Es bestand diffuser Druckschmerz mit
Punctum maximum im rechten
Unterbauch und Abwehrspannung
sowie kontralateralem Loslass-
schmerz. Temperatur bei Aufnahme:
37,5 °C axillär, 38,6 °C rektal.
Ergänzende Untersuchungen
Wichtige Laborwerte und deren Verlauf
sind in Tab. 1 zusammengefasst. Weite-
re Laborwerte im Referenzbereich.
Sonografie
Ventral der Aorta und Vena cava infe-
rior ca. 15 × 10,4 × 7,2 cm messende,
cranial bis an die Leber und den
Magen reichende Raumforderung
(Abb. 1) mit zwiebelschalenartiger
echoarmer Wand mit multiplen Sep-
tierungen im zentralen echoarmen
bis echofreien Anteil. Gute Abgren-
zung von der Aorta abdominalis, ohne
Verbindung zu Nieren, Leber oder
Milz. Abgrenzung vom Pankreas nicht
eindeutig möglich. Wenig freie Flüs-
sigkeit. Appendix sonografisch nicht
darstellbar.
Abdominelle Computertomografie
mit intravenöser und oraler Kon-
trastmittelgabe
Hypodense, septierte, zystisch, glatt
begrenzt Raumforderung 17,8 × 14,2
× 9,4 cm ohne Nachweis von Luftein-
schlüssen oder Kontrastmittel-Über-
tritt. Wandverdickte Appendix, ent-
zündliche Umgebungsreaktion des
Coecalpols als Zeichen einer Appendi-
zitis ohne Abszess (Abb. 2). Freie Flüs-
sigkeit perihepatisch, parakolisch
rechts und im kleinen Becken. Reaktiv
vergrößerte Lymphknoten im Meso-
kolon rechts. Keine ossären Läsionen.
Röntgen-Thorax: regelrechter Herz-
und Lungenbefund.
Therapie und Verlauf
Der Patient erhielt eine kalkulierte
Antibiotikatherapie (Piperacillin /
Tazobactam 3 × 4,5 g i. v.) sowie Anal-
gesie und eine intravenöse Flüssig-
keitssubstitution. Die Bildgebung
legte das Vorliegen eines unter
Umständen malignen Tumors nahe.
Differenzialdiagnostisch musste an
ein Lymph- oder Hämangiosarkom
gedacht werden. Aufgrund der Größe
des Befundes fiel der Entschluss gegen
eine Laparoskopie. Nach entsprechen-
der Planung wurde eine Laparotomie
durchgeführt.
Intraoperativ zeigte sich trübes Sekret
im Douglasraum und eine makrosko-
pisch unauffällige Appendix (Abb. 3).
Es bestand eine maligne erscheinende
Infiltration des rechten Hemikolons
mit Beteiligung der Arteria ileocolica
und großflächigem Kontakt zu den
Mesenterialwurzelgefäßen. Es erfolgte
daher eine Hemikolektomie rechts
mit Ileotransversostomie. Der Tumor
konnte en bloc unter onkologischen
Gesichtspunkten reseziert werden.
Der postoperative Verlauf gestaltete
sich komplikationslos. Die histologi-
sche Aufarbeitung des Präparates
ergab eine abgekapselte Pseudozyste
mit resorbierter Blutung und chro-
nisch-granulierender Entzündung. Die
Appendix wies eine Wandfibrose auf,
die Serosa des Kolons Zeichen einer
fibrinösen Peritonitis. Der Patient
konnte am siebten Tag entlassen wer-
den. Er ist 4 Monate nach dem Ein-
griff weiterhin beschwerdefrei.
Diskussion
Mesenterialzysten sind eine seltene
Ursache abdomineller Beschwerden.
Die Inzidenz wird auf 1:100 000 bis
1:250 000 Klinikaufnahmen geschätzt
[5]. Sie können in jedem Alter symp-
tomatisch werden, davon etwa 25–
40 % in Säuglings- und Kindesalter.
Häufig sind sie Zufallsbefunde im
Rahmen einer Routineuntersuchung
oder bei unspezifischen abdominellen
Beschwerden. Kommt es zu einer
Infektion, Blutung, Volvolus, Perforati-
on oder einer Obstruktion angrenzen-
der Darmanteile, können sie ein aku-
tes Abdomen verursachen. Es gibt
Hinweise dafür, dass Beschwerden
insbesondere bei einer Zystengröße
über 5 cm auftreten [10]. Vermutlich
werden am ehesten junge Patienten
symptomatisch [8, 9].
Die derzeit gebräuchliche Einteilung
der Mesenterialzysten [1] unterschei-
det zwischen Lymphangiom, nicht-
pankreatischer Pseudozyste, enteraler
Duplikationszyste, enteraler Zyste und
Mesothelialzyste. In diesem Fall han-
delte es sich um eine Pseudozyste mit
möglicherweise infektiöser oder trau-
matischer Genese. Differenzialdiag-
nostisch musste präoperativ auch an
ein Lymph- oder Hämangiosarkom
gedacht werden.
Mesenterialzysten können entlang des
gesamten Gastrointestinaltraktes auf-
treten, am häufigsten im Bereich des
Ileums. Histologisch besteht die Kap-
sel meist aus Endothelzellen, an man-
chen Stellen unvollständig [6]. In die-
sem Fall bestand die Zystenwand aus
Fibroblasten-Proliferationsgewebe mit
lymphozytärer Entzündungsreaktion.
Bei fehlenden Endothelzellen handelt
es sich somit um eine Pseudozyste. Im
Inneren der Zysten fand sich älteres
Blut, was die Theorie eines zurücklie-
genden Traumas mit folgender Infek-
tion als Ursache unterstützt. Die Lite-
ratur beschreibt auch eine Superin-
fektion mit E. coli [4]. Bei einem Drit-
tel der Patienten mit Mesenterialzys-
ten finden sich ein abdominelles
Trauma, bei einem Fünftel eine
Appendektomie in der Vorgeschichte.
In unserem Fall war kein Trauma
erinnerlich, und auch eine Appendek-
tomie oder andere abdominelle Ope-
ration hatte nicht stattgefunden. Auf-
grund der Schmerzen im rechten
Unterbauch und der Infektparameter
lag bei unserem Patienten bereits
bei Aufnahme der Verdacht einer
(Begleit-)Appendizitis oder Superin-
fektion des Tumors nahe, sodass eine
Antibiose begonnen wurde.
Die Therapie der Wahl bei Mesenteri-
alzysten ist eine komplette Exzision
gegebenenfalls mit einer sparsamen
Segmentresektion des betroffenen
Der Begriff des „akuten Abdomens“ umfasst Symptomkomplexe unterschiedlicher Ursachen,
denen ein ernstzunehmender abdomineller Befund gemeinsam ist. Neben Anamnese, klinischem
Befund und Laboranalysen sind bildgebende Untersuchungen hilfreich bei der Diagnosestellung.
Die Abdomensonografie und abdominelle Computertomografie (CT) sind je nach Fragestellung
und Verfügbarkeit geeignete Verfahren [11].
Kasuistik: Symptomatische Mesenterialzyste
Rechtsseitige Unterbauchschmerzen –
die üblichen Verdächtigen?
Abb. 3
Intraoperativer Situs. OP-Situs von kranio-ventral. Am unteren Bildrand: Omentum
majus, Bildmitte: große Raumforderung, von Pinzette gehalten: blande imponierenden
Appendix vermiformis (am Meso mobilisiert).
Abb. 1
Sonografie der Darstellung am Aufnahmetag. B-Bild des Sagittalschnittes in der
Ebene der Aorta mit Darstellung der Raumforderung. Die echoreichen Septen flottieren im
B-Bild pulssynchron. AO = Aorta abdominalis.
Abb. 2
Computertomografie am Aufnahmetag. Große, teilweise septierte zystisch hypo-
dense Raumforderung im Oberbauch mit enger Lagebeziehung zum rechten Hemikolon.
Freie Flüssigkeit um den Coecalpol, im Anschnitt erfasste Appendix.
Tab.
ʃ
1
Wichtige Laborwerte. Tag 0͂=͂Aufnahmetag.
Tag nach Aufnahme (post-OP)
0
3 (1)
7 (5)
Hämoglobin (g/dl) [n: 14,0–18,0]
13,6
12,1
11,9
Leukozyten (/nl) [n: 4,0–6,3]
8,3
7,3
6,6
Quick (%) [n: 70–120]
66
62
73
CRP (mg/dl) [n:
ɾ
<
ɾ
0,5]
14,33
10,11 5,45