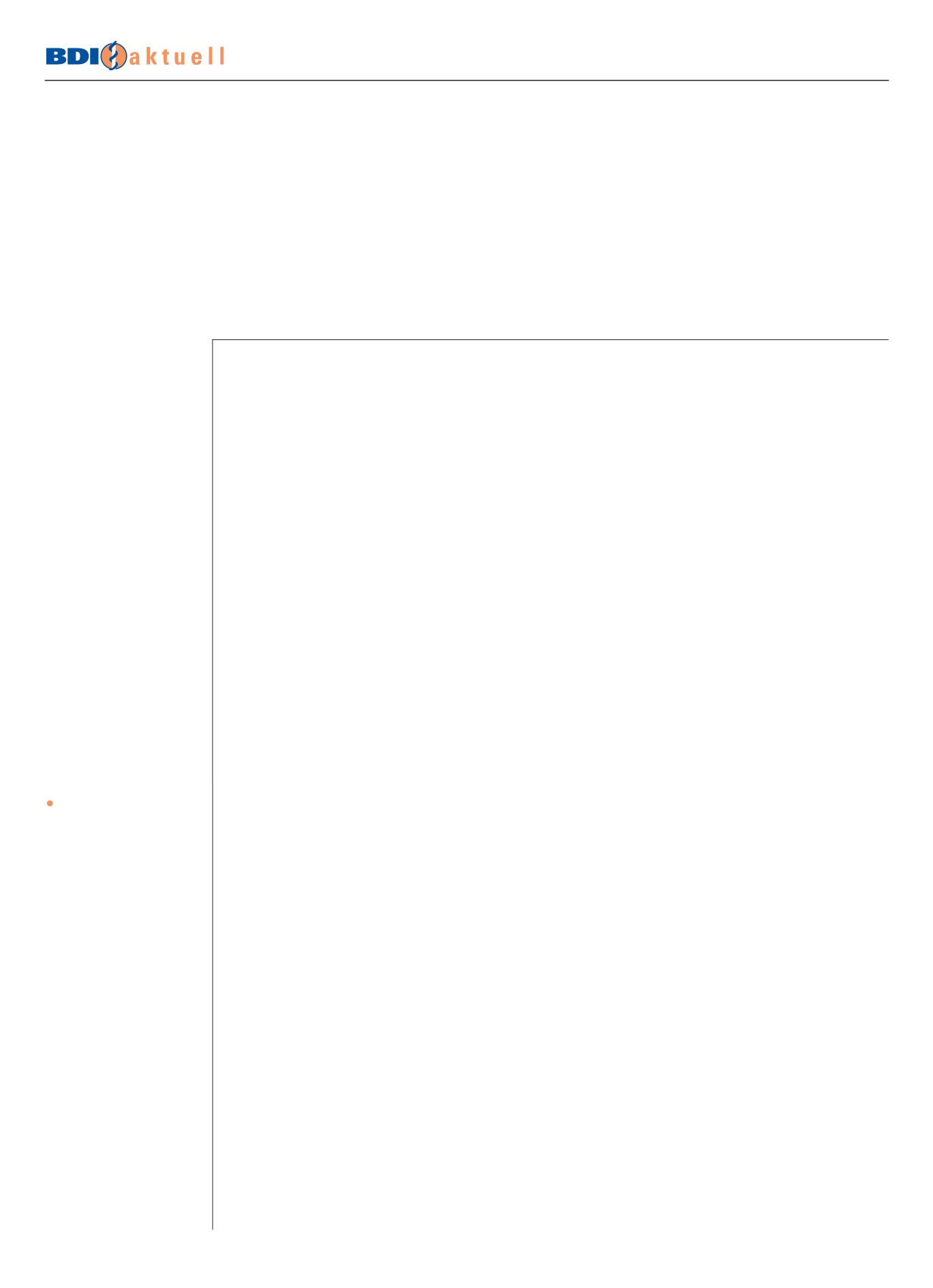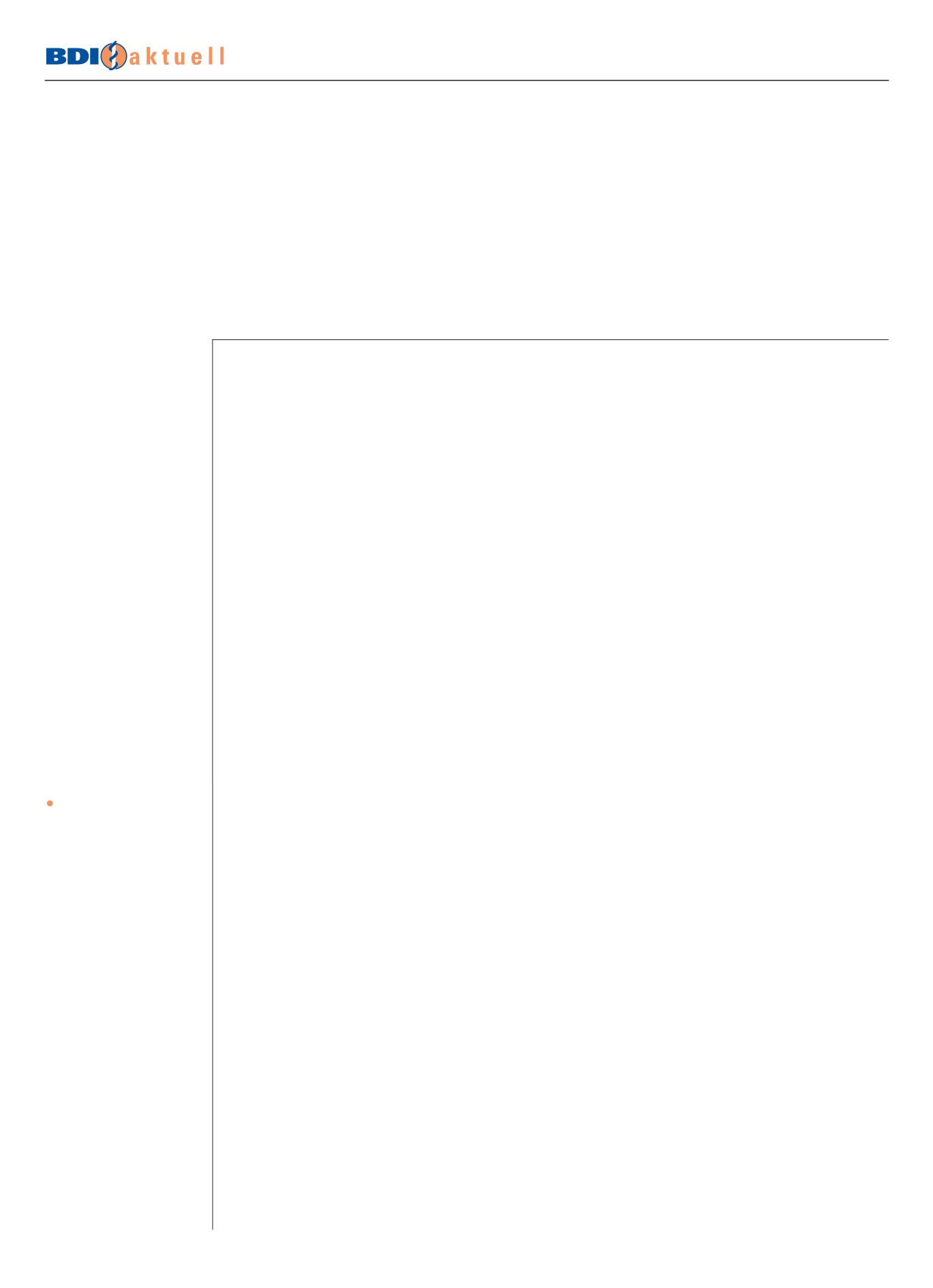
pende Umsetzung des neu geschaffe-
nen spezialärztlichen ambulanten
Versorgungsbereichs (ASV). Durch
den ASV sollen Krankenhäuser und
Praxen niedergelassener Fachärzte
die Behandlung von schweren, selte-
nen und komplizierten Erkrankun-
gen, insbesondere Krebsbehandlun-
gen, besser als bisher durchführen.
Mitverantwortlich für die Blockaden
in der Selbstverwaltung seien gesetz-
liche Vorgaben, die den GKV-Spit-
zenverband und die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV) dazu ani-
mierten, die Umsetzung zu verzö-
gern, zu verkomplizieren und zu ver-
schleppen. Der revidierte Paragraf
116 b SGB V lahme – wie bisher
schon – deswegen, weil immer noch
die Leistungsdefinitionen, Leistungs-
begrenzungen und Zuständigkeitsab-
grenzungen nicht operational seien
und überzogene bürokratische Über-
prüfungs- und Kontrollnetze aufge-
baut werden sollen. Notwendig seien
Klarstellungen, die das beenden. Die
gesetzlich vorgegebene Unterschei-
dung zwischen leichten und schwe-
ren Krebserkrankungen sei nicht
umsetzbar und sollte deshalb revi-
diert werden. Die DKG will in den
zuständigen Bewertungsausschuss
einbezogen werden, um eine leis-
tungsadäquate Finanzierung der
ambulanten Krankenhausleistungen
zu installieren.
Der Vorstandsvorsitzende der Bar-
mer/GEK, Straub, warnte davor, das
DRG-System als „lernendes System“
zu einem „Hamsterrad“ auszubauen.
Die Vertragsärzte hätten mit dem
mehrfach revidierten Einheitlichen
Rettungsmaßstab (EBM) schlechte
Erfahrungen gemacht. Es sei erwie-
sen, dass das vor zehn Jahren imple-
mentierte diagnosenbasierte Fallpau-
schalensystem inzwischen auch kos-
tentreibende Fehlanreize begünstige
und manipulationsanfällig sei.
Kassen: Überhitzte Mengen-
entwicklung stoppen!
Der stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende des GKV-Spitzenverbandes,
Johann-Magnus von Stackelberg,
bezeichnete es als eine „zentrale Auf-
gabe der Strukturreform“, die „über-
hitzte Mengenentwicklung“ zu
bremsen. Im stationären Sektor gebe
es keinen Platz für qualitativ minder-
wertige Leistungserbringer und für
Scheininnovationen. Gute Leistungs-
qualität müsse auch gut finanziert
werden. Darauf müssten die Pla-
nungs- und Preismechanismen aus-
gerichtet werden. Die Beitragszahler
dürften nicht verpflichtet werden,
ineffiziente Krankenhäuser zu finan-
zieren. Operationale Qualitätsindika-
toren und das von den Krankenkas-
sen mit der Bertelsmann-Stiftung
entwickelte System des „Kranken-
hausmonitors“ sowie transparente
Jahres-Qualitätsberichte müssten die
Selbstverwaltungspartner in die Lage
versetzen, qualitätsorientierte Ver-
gütungen zu vereinbaren. Ziel müsse
es sein, den Patienten umfassend zu
informieren, damit er von seinen
Wahlrechten Gebrauch machen
kann. Inzwischen sind die Formvor-
schriften für die Qualitätsreports
unter diesen Vorgaben geändert
worden.
Die Krankenkassen befürworten
einen Qualitätswettbewerb, bei dem
sich die Qualitätsunterschiede in
Erlösdifferenzen widerspiegeln.
Voraussetzung dafür sei, dass aussa-
gefähige Qualitätsindikatoren entwi-
ckelt werden und die Validität der
Qualitätssicherungsdaten verbessert
wird. Im stationären Sektor sei die
Rolle der Krankenkassen (GKV; PKV)
in einem offensiven Leistungswett-
bewerb noch begrenzt. Die Kranken-
kassen hätten nicht die Definitions-
und Einkaufsmacht wie zum Teil in
den anderen Sektoren, um versor-
gungsnotwendige Leistungen zu ver-
einbaren. Neue Versorgungsmodelle
– sowohl im kollektiv- als auch im
selektivvertraglichen Rahmen –
müssten bei der Reform eine zentra-
le Rolle spielen. Ein reiner Preiswett-
bewerb sei aber nicht sinnvoll. Im
Vordergrund müssten leistungsori-
entierte Vergütungen stehen. Über-
prüfungswürdig seien die Mengen-
entwicklung und das Leistungsni-
veau. Die Fehlentwicklungen und fal-
sche Anreize müssten kritisch hin-
terfragt werden. Es soll sichergestellt
werden, dass sich die Vergütung
auch an medizinisch-qualitativen
Maßstäben orientiert. Den Patienten
und den Krankenkassen müssten
nicht notwendige und qualitativ
fragwürdige Operationen und
Behandlungen (im Fokus: Knieendo-
prothesen und Hüftimplantationen!)
erspart bleiben. Qualitätsorientierte
Vergütung müsse auf der Basis nach-
gewiesener und vergleichbarer Qua-
lität erfolgen. Dies gelte insbesonde-
re auch für die Pflegequalität, so der
GKV-Spitzenverband. Aussagekräfti-
ge Informationen über die Versor-
gungsqualität müssten Grundlage
finanzieller Anreize für weitere Qua-
litätsverbesserungen werden. Kran-
kenhäuser und Krankenkassen müss-
ten mit transparenten und validen
Qualitätsinformationen dazu beitra-
gen, Patienten und deren Angehöri-
gen einen Überblick über das Spek-
trum und die Qualität des Versor-
gungsangebotes zu vermitteln. Dies
sei notwendig, um die Wahl- und
Entscheidungsrechte der Versicher-
ten wahrzunehmen.
Dr. rer. pol. Harald Clade
Nr. 12 • Dezember 2013
5
Berufspolitik