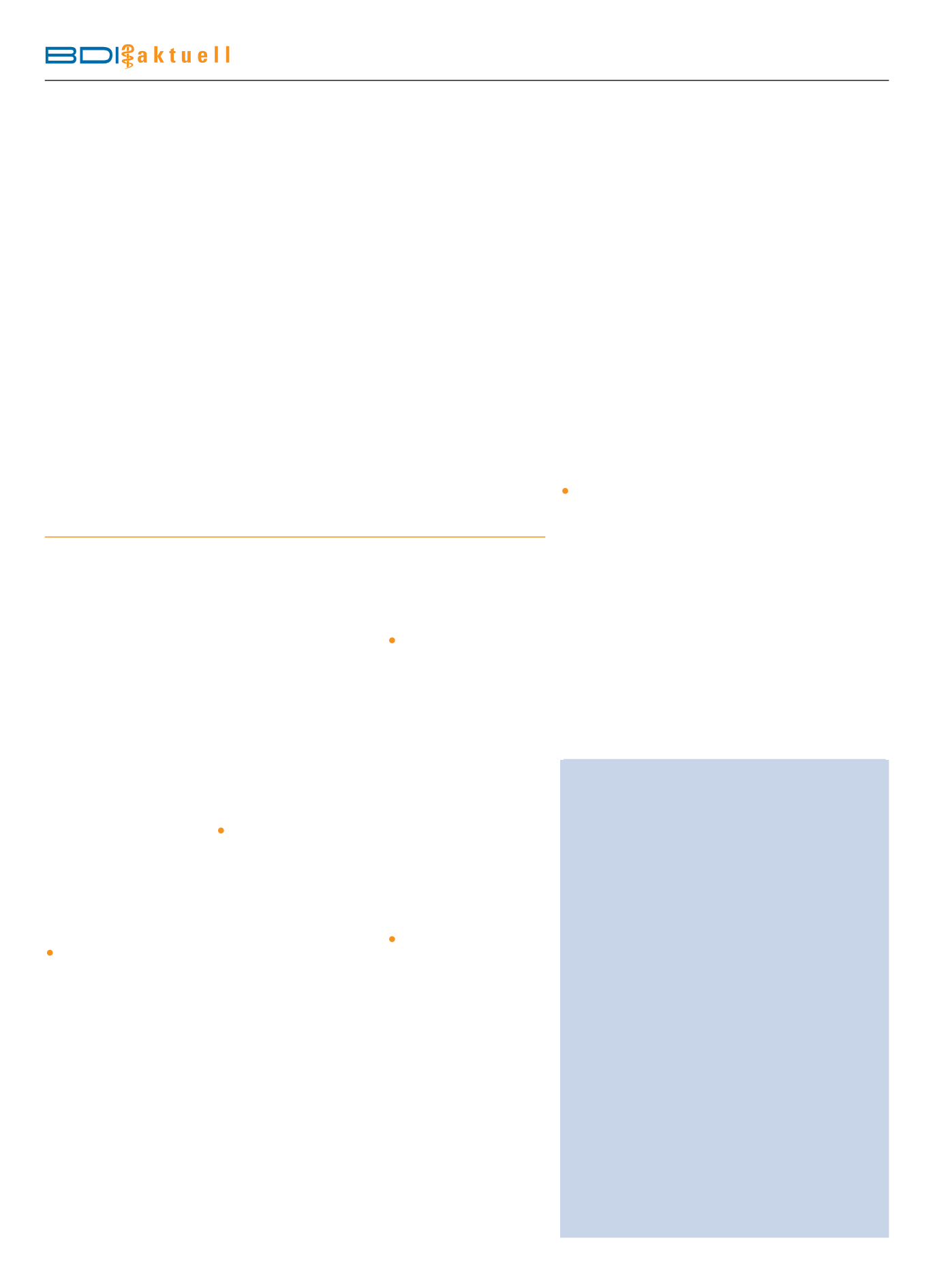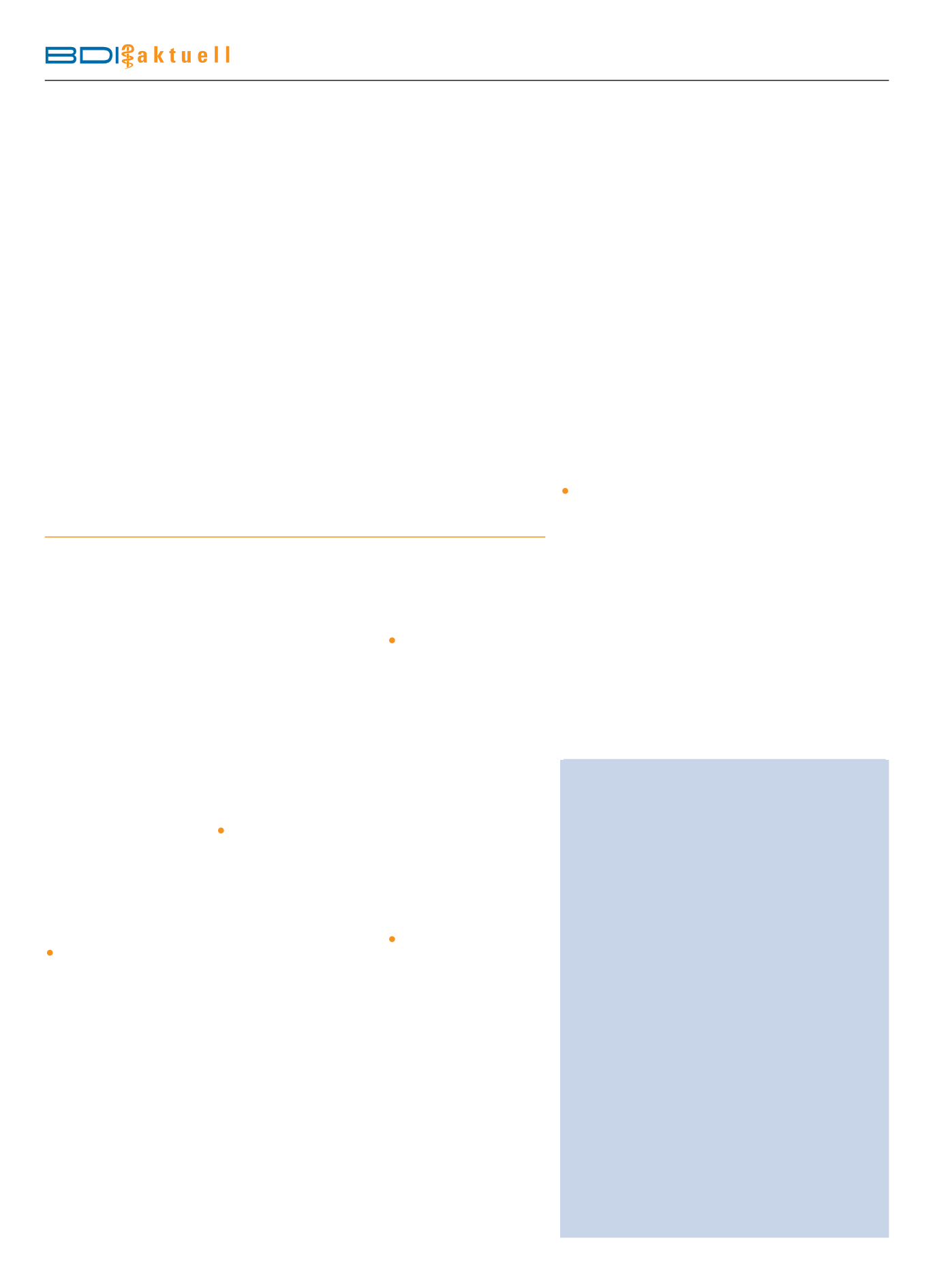
Berufspolitik
Nr. 3 • März 2014
7
Die engste Form ärztlicher Kooperatio-
nen ist die Gemeinschaftspraxis, also
die klassische Berufsausübungsge-
meinschaft (BAG). Sie wird zumeist
ausgeübt in der Rechtsform einer
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).
Noch wenig verbreitet ist dagegen die
Partnerschaftsgesellschaft, die in dem
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
(PartGG) vor zehn Jahren eingeführt
wurde. Erforderlich bei der Gründung
einer Partnerschaftsgesellschaft ist ein
schriftlicher Partnerschaftsvertrag und
die Eintragung in das Partnerschaftsre-
gister.
Rahmenbedingungen
Die haftungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen bei ärztlichen Behandlungs-
fehlern und bei zivilhaftungsrechtli-
chen Einstandspflichten für Verbind-
lichkeiten der Arztpraxis sind unter-
schiedlich, je nach der vertraglichen
Konstruktion der BAG. In einer
Gemeinschaftspraxis kommt der
Behandlungsvertrag zwischen dem
Patienten und sämtlichen Ärzten der
Gemeinschaftspraxis zustande. Bei
einer Gemeinschaftspraxis in der
Rechtsform einer Partnerschaftsgesell-
schaft werden hingegen die Behand-
lungsverträge zwischen den Patienten
und der Partnerschaft abgeschlossen.
Die vertrags- und die privatärztlichen
Leistungen werden durch die Gemein-
schaftspraxis in Rechnung gestellt und
abgerechnet. Bei Behandlungsfehlern
haften sämtliche Ärzte einer Gemein-
schaftspraxis persönlich und unbe-
schränkt als Gesamtschuldner (nach
BGB). Dies gilt auch für die Zusam-
menarbeit in einer Teilgemeinschafts-
praxis.
Vorsicht bei Eintritt in eine beste-
hende Gemeinschaftspraxis!
Der eintretende Arzt haftet auch für
Verbindlichkeiten („Altverbindlichkei-
ten“), die vor seinem Eintritt in die
Praxis entstanden sind. Bereits 2003
und 2005 entschied der Bundesge-
richtshof (BGH), dass ein neu in eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ein-
tretender Gesellschafter auch für Alt-
verbindlichkeiten persönlich und
gesamtschuldnerisch neben den bishe-
rigen Gesellschaftern haftet (BGH vom
7. April 2003, Az.: II ZR 56/02 und BGH
vom 12. Dezember 2005, Az.: II ZR
56/02). In einer Gemeinschaftspraxis,
die als Partnerschaftsgesellschaft ein-
getragen ist, haften die Partner
(Gesellschafter) den Gläubigern –
neben dem Gesellschaftsvermögen –
als Gesamtschuldner (§ 8, Abs. 1, Satz
1 PartGG). Allerdings ist auch eine
Beschränkung der Haftung auf den
jeweils handelnden Partner möglich.
Bei Gemeinschaftspraxen betrifft diese
Beschränkung allerdings nur die Haf-
tung aus „fehlerhafter Berufsaus-
übung“ (zum Beispiel: Behandlungs-
fehler). Für sonstige Forderungen
(etwa Honorarrückforderungen wegen
fehlerhafter Abrechnung, Arzneimittel-
regresse u. a.) gilt diese Haftungsbe-
schränkung nicht.
Weitreichende Haftung
Nach einem älteren Urteil des BGH
(Az.: IX ZR 112/09) kann sich der Arzt
auf das Haftungsprivileg dann nicht
mehr berufen, wenn er – auch zu
einem späteren Zeitpunkt – den
Patienten unmittelbar behandelt. Nach
dem BGH-Urteil ist für die Haftung
nicht die Beteiligung an der eigentli-
chen „Verletzungshandlung“ entschei-
dend, sondern die Beteiligung an der
Behandlung. Dies gilt im Prinzip auch
dann, wenn es sich um einen Behand-
lungsfehler handelt, der auf eine „Ver-
letzungshandlung“ vor Eintritt in die
Partnerschaft zurückgeht. Die Haftung
im Rahmen einer Gemeinschaftspra-
xis, gleichviel, welche Rechtsform
gewählt wurde, gilt auch für den –
erst später eintretenden – „Scheinpart-
ner“ (Nichtpartner).
Praxisgemeinschaft: Jeder Arzt
haftet einzeln
Eine Praxisgemeinschaft beschränkt
die Haftung auf jeden einzelnen Arzt
als Vertragspartner des Patienten. Die
Praxisgemeinschaft ist rechtsformal
eine „Innengesellschaft“. Deshalb rich-
tet sich die vertragliche Haftung aus-
schließlich gegen den Arzt, der einen
Behandlungsfehler verschuldet hat. Ein
erhöhtes Haftungsrisiko und sogar
eine Mithaftung sind dann virulent,
wenn die verschiedenen Ärzte einer
Praxisgemeinschaft handeln, ohne dass
dies dem Patienten bekannt oder für
diesen erkennbar ist. Dann kommt die
Rechtscheinhaftung zum Zuge, die sich
wie ein roter Faden durch das Zivil-
recht zieht.
Dr. Harald Clade
Weitreichende
Einstandspflichten
Arzthaftung in Gemeinschaftspraxen
Der Umfang der Haftung und der Einstandspflichten bei Behandlungs-
fehlern und für Verbindlichkeiten ist für Ärzte unterschiedlich, je
nachdem, ob es sich um eine Gemeinschaftspraxis oder um eine Part-
nerschaftsgesellschaft handelt. Die aktuelle Rechtslage hat der Bundes-
gerichtshof kürzlich in drei Grundsatzurteilen erneut klargelegt.
Es ist allgemein bekannt, dass ein gro-
ßer Teil der Krankenhausinfektionen
von den Patienten in die Krankenhäu-
ser mitgebracht wird. Die heute im G-
BA beschlossene Richtlinie, mit der
ambulante Behandlungsmöglichkeiten
beschrieben werden, bleibt weit hinter
den Möglichkeiten, Infektionen wirk-
sam zu bekämpfen, zurück. Es ist gera-
dezu grotesk, dass Patienten, die eine
stationäre Behandlung vor sich haben,
im Rahmen der häuslichen Kranken-
pflege nur eine ambulante Eradikati-
onstherapie durch die niedergelasse-
nen Ärzte verordnet bekommen dür-
fen, wenn sie sich zuvor im Kranken-
haus die MRSA-Besiedlung haben fest-
stellen lassen. Noch widersprüchlicher
ist die Leistungsbeschreibung für die
Vergütungsregelung der niedergelasse-
nen Ärzte. Dort bleiben die Auslösekri-
terien für die Testung und zur Durch-
führung der Behandlung hinter den
vom RKI festgelegten Empfehlungen
(KRINKO) zurück, bei denen die Kran-
kenhäuser zur präventiven Testung
verpflichtet sind. Während also die
Krankenhäuser nach den strengen
Maßstäben der KRINKO-Kommission
arbeiten und darüber hinaus seitens
der Kassen mit Forderungen konfron-
tiert sind, jeden Patienten unabhängig
von seiner Risikodisposition zu testen,
verweigert der GKV-Spitzenverband
die Empfehlungen zum Bestandteil der
leistungsrechtlichen Regelungen zu
machen. Hier bestätigt sich erneut die
Widersprüchlichkeit der Krankenkas-
sen. In diffamierender Weise wird den
Krankenhäusern vorgeworfen, sie
würden nicht genügend für die Sicher-
heit der Patienten tun, während sie
sich dort, wo konkrete Regeln getrof-
fen werden könnten, verweigern.
Vor diesem Hintergrund gilt es erneut,
die Ungeheuerlichkeit des Vorwurfes
des AOK-Bundesverbandes aus dem
WiDO-Report, in Krankenhäusern
würden 18.800 Menschen durch
Behandlungsfehler und Infektionen zu
Tode kommen, in aller Entschiedenheit
zurückzuweisen.“
Pressemitteilung der Deutschen
Krankenhausgesellschaft e.V. vom
23. Januar 2014
Kassen verweigern wirksame
Infektionsbekämpfung
DKG zur Bekämpfung von MRSA-Infektionen
Zum Beschluss des G-BA über die Verordnungsmöglichkeit ambulanter
Maßnahmen zur Bekämpfung von MRSA-Infektionen erklärte der Präsi-
dent der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Alfred Dänzer:
„Während die Krankenkassen von den Krankenhäusern alles maximal
Mögliche verlangen, um Infektionen zu vermeiden und zu bekämpfen,
verweigern sie sich in einer als skandalös zu bezeichnenden Weise, wenn
es darum geht, im Vorfeld des Krankenhauses im niedergelassenen
Bereich den Ärzten und Pflegenden die Instrumente an die Hand zu
geben, die wirksam zur Bekämpfung von Infektionen beitragen könnten.
Dies bedeutet, dass etwa 360.000 bis
720.000 Patienten pro Jahr geschädigt
würden. Das Ganze kommt noch
schlimmer: Im Jahr würden „rund“
19.000 Todesfälle durch diese Behand-
lungsfehler verursacht. Es fehlt von
Seiten des WIdO nicht der Hinweis,
dass dies fünfmal so viele Tote sind
wie im Straßenverkehr. Die Empfeh-
lung für den Bürger, sich in Zukunft im
Krankheitsfall doch lieber in den Stra-
ßenverkehr und nicht in ein Kranken-
haus zu begeben, hat man sich aber
verkniffen.
Patienten werden verunsichert
Wir alle wissen, dass im täglichen
Leben in allen Bereichen unseres
Lebens Fehler gemacht werden, somit
auch in den Krankenhäusern. Wir wis-
sen auch, dass vergleichbare Fehler bei
einer Krankenbehandlung schlimmere
Folgen haben als z. B. in einer Auto-
werkstatt. Deshalb ist es notwendig,
sie zu minimieren.
Ein Patient benötigt Vertrauen in das
Gesundheitswesen. Krankheit ist
hochgradig angstbesetzt und führt
deshalb oft zu unkalkulierbaren und
fatalen Fehlreaktionen. Wird das Ver-
trauen in die deutsche Krankenhaus-
landschaft grundsätzlich zerstört, wer-
den viele Patienten die Einweisung in
ein Krankenhaus vermeiden, auch
wenn sie für sie lebensnotwendig ist.
Mit diesem Thema muss somit sehr
sensibel umgegangen werden.
Der AOK muss man vorhalten, dass sie
mit offensichtlich statistisch nicht
abgesicherten Daten (2–4 %, geschätzte
19.000 Tote) Patienten verunsichert
und damit die beschriebenen fatalen
Folgen in Kauf nimmt. Auch diese
Patienten sind Versicherte der Allge-
meinen Ortskrankenkasse, sie sollte
darauf Rücksicht nehmen. Es wäre
anzuraten, mit den Fehlern im System
angemessen und im Interesse der
Patienten einfühlsamer umzugehen.
Warum macht eine Krankenkasse so
etwas? Sie will die Krankenhauskosten
senken und beklagt zu Recht, dass sie
mit den steigenden Ausgaben für die
laufenden Kosten via DRG auch noch
die Investitionen finanzieren muss, für
die eigentlich die öffentliche Hand
zuständig ist. Die AOK sollte dieses
Defizit dort anbringen, wo es hinge-
hört, nämlich bei der Politik in Bund
und Ländern.
Anfechtbare Statistiken über Fehler im
Krankenhaus sind zur Lösung des Pro-
blems der falsche Ansatz.
HFS
Lesen Sie auch die Pressemitteilung
des BDI zur WIdO-Studie „BDI verurteilt
maßlose Kritik am Krankenhaus” auf
dieser Seite.
WIdO-Studie zu Fehlern im Krankenhaus
Ein falscher Ansatz
Der AOK-Bundesverband hat die Keule gegen die deutsche Krankenhaus-
versorgung mit einer neuen Studie des Wissenschaftlichen Instituts der
AOK (WIdO) geschwungen. Der Geschäftsführer des WIdO, Jürgen Klau-
ber, hat dabei Ergebnisse einer Studie vorgelegt, nach der bei allen Kran-
kenhausfällen eines Jahres in der Bundesrepublik Deutschland sogenann-
te vermeidbare Ereignisse in einer Häufigkeit von 2–4 % auftreten.
BDI verurteilt maßlose Kritik am Krankenhaus
Wesiack: Man sollte die
Kirche im Dorf lassen
Die Kritik an der Versorgung in den deutschen Krankenhäusern hat
einen neuen Höhepunkt erreicht. Die von einer Krankenkasse im
AOK-Krankenhaus-Report populistisch angestoßene Diskussion
wird plötzlich zum Aufmacher einer großen deutschen Sonntags-
zeitung.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass aus einer in Einzelfällen durchaus
berechtigten Kritik eine regelrechte Kampagne gegen einen unverzichtbaren
Bestandteil unseres Gesundheitswesens, nämlich das Krankenhaus, losgetre-
ten werden soll. Unverständlich sind die Vorwürfe auch deshalb, weil der den
Krankenhäusern vorgeworfene ärztliche und pflegerische Personalmangel
durch eine restriktive Finanzierung über die öffentliche Hand und auch durch
die Krankenkassen selbst ausgelöst wird. Die Krankenkasse scheut in ihren
Stellungnahmen nicht davor zurück, die Verkehrstoten in Deutschland mit
Behandlungsfehlern zu vergleichen. Fehlt nur noch der Hinweis, dass man sich
in Deutschland bei Krankheit besser in den Straßenverkehr und nicht in ein
Krankenhaus begibt.
Krankheit ist immer angstbesetzt. Zerstört man durch überzogene und auch
unangemessene Kritik das Vertrauen in die Krankenhäuser, nimmt man billi-
gend in Kauf, dass Patienten eine dringend notwendige stationäre Aufnahme
verweigern. Hierfür tragen die Kritiker die Verantwortung.
Der Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) hat Verständnis dafür, wenn
Missstände, auch am Finanzierungssystem der stationären Versorgung in
Deutschland, benannt werden, damit sie behoben werden können. Die derzei-
tige Kritik schießt jedoch weit über das Ziel hinaus und gefährdet Patienten.
BDI-Präsident Dr. Wolfgang Wesiack appelliert deshalb an alle Beteiligten, die
Kirche im Dorf zu lassen.
Pressemitteilung des BDI vom 3. Februar 2014