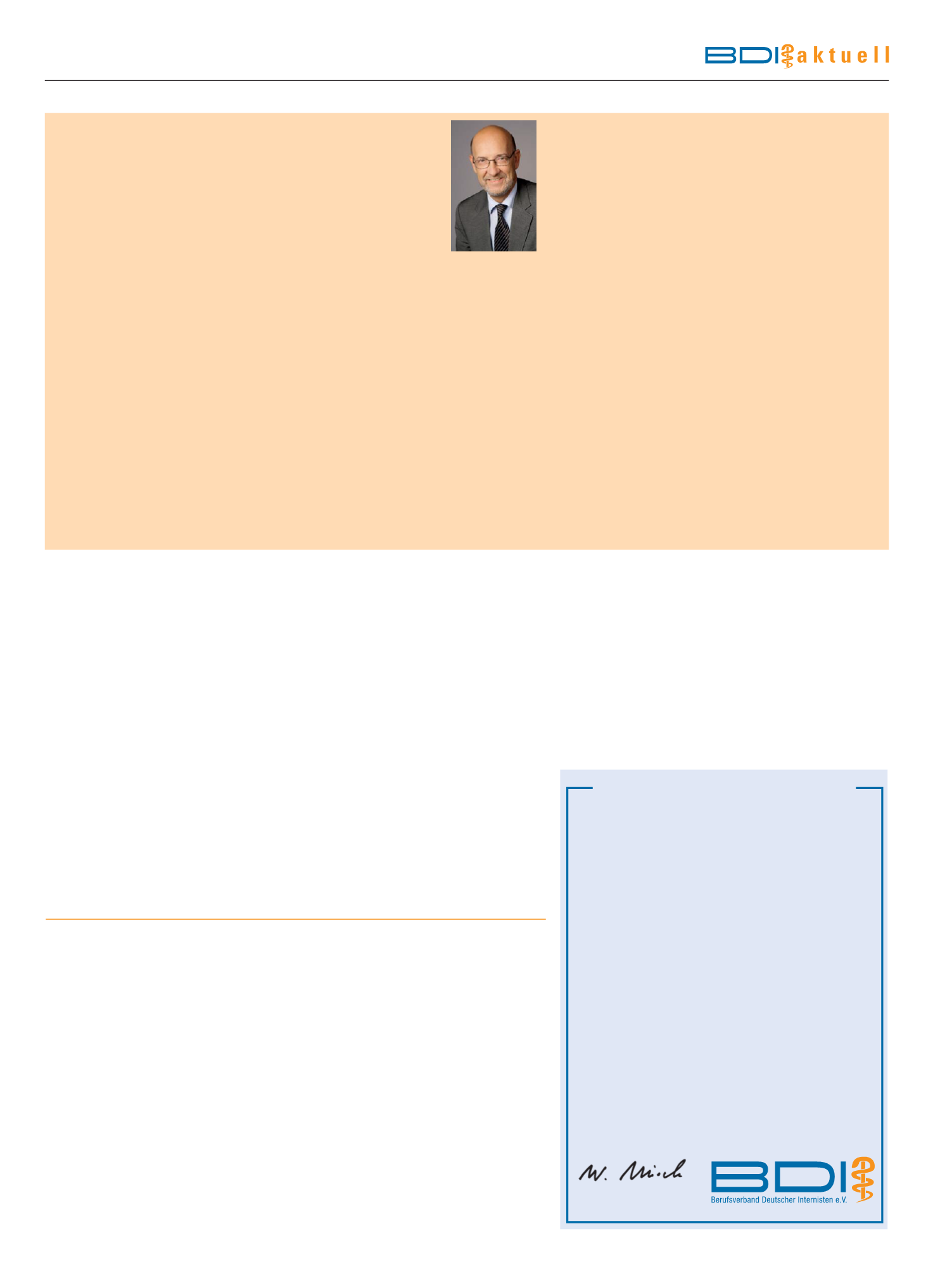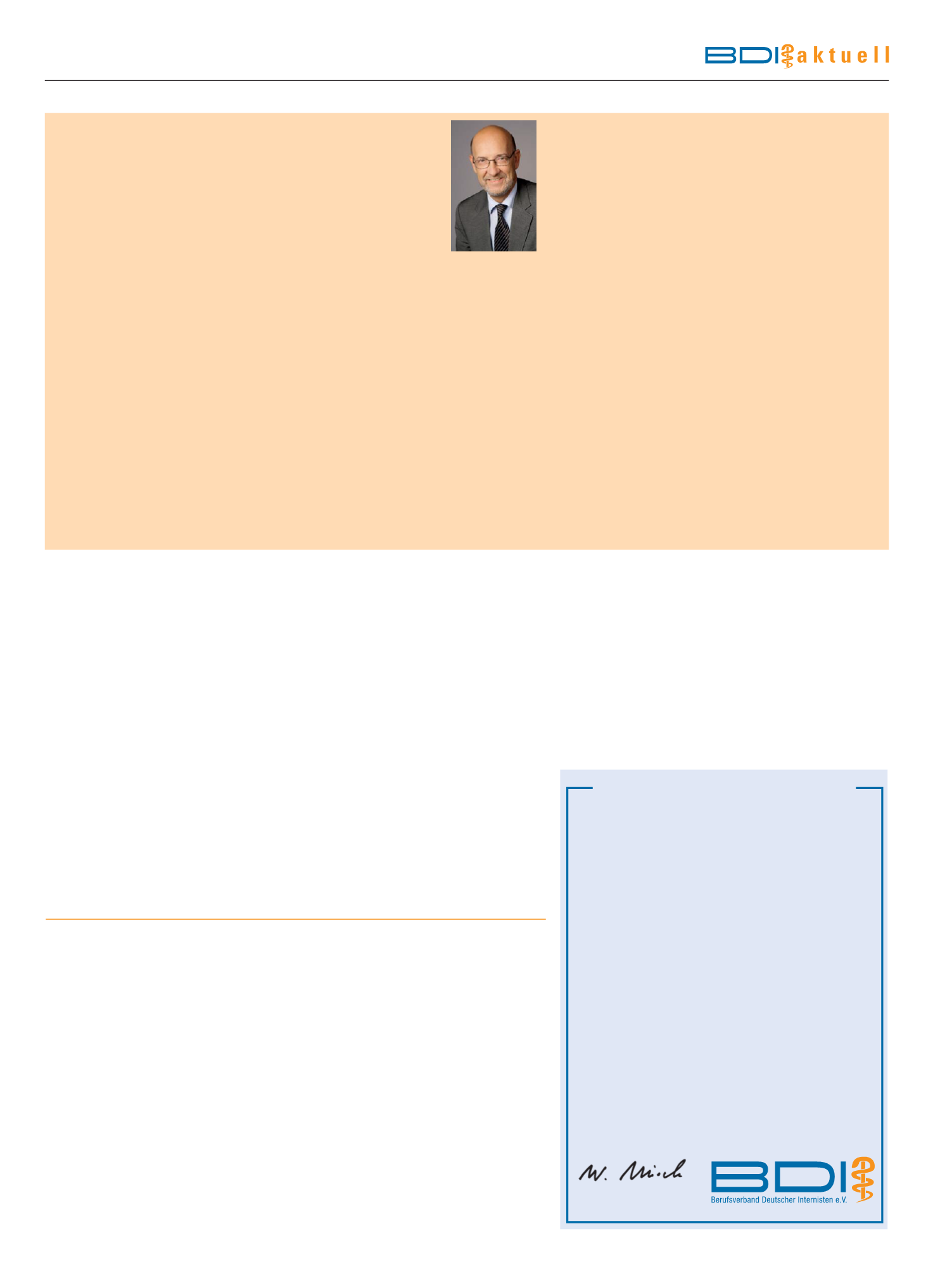
Berufspolitik
Nr. 3 • März 2014
2
Um zu sehen, was die Politik uns in
den nächsten vier Jahren bescheren
wird, ist der Blick in den Koalitions-
vertrag von CDU, CSU und SPD anzu-
raten. „Der Geist dieses Vertrages
heißt, dass wir eine große Koalition
sind, um auch große Aufgaben für
Deutschland zu meistern“, hat die
CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin
Angela Merkel, bei der Vertragsunter-
zeichnung betont. Genauso ist auch
der Inhalt des Papiers: Aussagefreu-
dig mit Sicht auf die großen Ziele,
wenig erhellend zu den Details der
Ausführung. Die Vermutung, dass in
dem Vertrag nicht alles steht, was
noch kommen wird, liegt nahe.
In dem verhältnismäßig kleinen
Kapitel zur Gesundheitspolitik fällt
uns zunächst einmal auf, dass dem
Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) und dem Medizinischen
Dienst der Krankenkassen (MDK)
eine bisher nicht gekannte Stärkung
ihres Gewichts zugewiesen wird. Die
Rolle des G-BA, nicht zu Unrecht als
„kleiner Gesetzgeber“ bezeichnet,
wird kontinuierlich aufgewertet.
Die hausarztzentrierte Versorgung
wird im Sinne des alten § 73b SGB V
gefördert – hier hat sich der Hausärz-
teverband mit Hilfe der SPD im Koali-
tionsvertrag voll durchgesetzt. Die
Fachärzte kommen nur in einem Satz
am Rande vor: „Darüber hinaus soll
die fachärztliche Versorgung gestärkt
werden.“ Kein Wort über das WIE.
Es ist tatsächlich so und bedauerlich,
dass viele Politiker gar nicht wissen,
wer alles in der hausärztlichen Ver-
sorgung tätig ist. Der BDI weist
immer wieder darauf hin, dass die
Internisten hier eine wichtige Rolle
spielen. Ohne sie wäre eine flächen-
deckende hausärztliche Versorgung
nicht zu sichern. Eines muss auch
klar gesagt werden: Geld allein
schafft noch keine neuen Hausärzte
herbei. Die bisherige Förderung der
Hausärzte hat gänzlich versagt.
Im Krankenhaus wird der MDK eine
gewichtigere Rolle spielen als bisher.
Offenbar betrachtet ihn die Politik als
eine unabhängige Institution, was er
jedoch nicht ist. Er ist ein Organ im
Dienste der Krankenkassen und quasi
deren verlängerter Arm. So soll der
MDK nach dem Willen der Koalition
zukünftig unangemeldete Kontrollen
in den Krankenhäusern durchführen,
um zu überprüfen, ob die Vorgaben
des G-BA zur internen und externen
Qualitätssicherung eingehalten wer-
den.
Aus Sicht des Internistenverbandes
ist dies Ausdruck eines Misstrauens
gegenüber den Ärzten in den Klini-
ken. Der BDI warnt vor einem Miss-
brauch des MDK durch die Kranken-
kassen und unterstützt die Ärzte des
Medizinischen Dienstes, wenn sie
ärztlich unabhängig arbeiten und
damit die Qualität der stationären
Versorgung verbessern.
Eingriffe in die Krankenversorgung
und in die Abrechnung der Kranken-
häuser dürfen sich nur dann an Leit-
linien orientieren, wenn es sich um
Kriterien hoher Evidenz handelt und
nicht um Expertenmeinungen. Kon-
trollen des MDK im ambulanten
Bereich lehnt der BDI ab. Das ist
allein Sache der Kassenärztlichen
Vereinigungen. Diesen Standpunkt
hat der Vorstand des BDI auf seiner
Klausurtagung Anfang Februar in
Dresden in einer Presseerklärung
ausdrücklich betont.
In der Honorarpolitik beschreitet
unser Verband künftig neue Wege. Er
will durch Selektivverträge die Nie-
derlassung in der Praxis attraktiver
machen. Die zunehmende Finanzie-
rungsproblematik, vor allem durch
die Honorarumverteilung der KBV,
provoziert und benachteiligt vor
allem die Internisten. Daran ist aus
unserer Sicht in erster Linie die Bud-
getierung schuld.
Aus diesem Grund will der BDI dem-
nächst als Anbieter von Selektivver-
trägen regional und überregional
auftreten, als Ergänzung zum Kollek-
tivvertrag. Ziel sind Vollverträge, die
sowohl die hausarztzentrierte Ver-
sorgung (73b-Verträge), die facharzt-
zentrierte Versorgung (73c-Verträge)
als auch die stationäre Versorgung
(§ 140a ff., § 116b, § 115a SGB V)
betreffen. Darüber soll mit den Kos-
tenträgern verhandelt werden. Die
Abrechnung soll über ein geeignetes
Abrechnungszentrum abgewickelt
werden. Der BDI ist bereit, mit allen
notwendigen Vertragspartnern darü-
ber zu verhandeln.
Ihr
Dr. med. Wolfgang Wesiack
Präsident BDI e.V.
Präsident
Dr. med. Wolfgang Wesiack,
Hamburg
Editorial
Es ist nicht gelungen, den kalkulatori-
schen Punktwert von 5,11 Cent ver-
bindlich mit den Krankenkassen zu
vereinbaren. Es konnte somit auch
nicht demonstriert werden, dass das
kalkulierte Honorar für die erbrach-
ten Leistungen der Vertragsärzte
nicht ausreicht. Dies lag nicht am
damaligen Hauptgeschäftsführer
Köhler, sondern an der Mehrheit des
damaligen KBV-Vorstandes, der den
Kassen nachgegeben hat.
Nach seiner Ernennung 2004 als
Hauptgeschäftsführer in der Nachfol-
ge von Dr. Hess wurde er nach der
KV-Reform 2005 zum hauptamtli-
chen Vorstand der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung gewählt. Er ver-
trat dort die fachärztlichen Belange,
sein hausärztliches Pendant war
Ulrich Weigeldt, der schon nach zwei
Jahren seine Position nach innerbe-
trieblichen Auseinandersetzungen im
Vorstand zur Verfügung stellte. Dr.
Köhler blieb im Vorstand weiter die
Konstanz, da auch Dr. Müller als
Nachfolger von Dr. Weigeldt die haus-
ärztlichen Vorstandsposten vorzeitig
aufgab. Auch unter dessen Nachfolge-
rin, Regina Feldmann, konnten die
Streitigkeiten zwischen Hausärzten
und Fachärzten nicht beigelegt wer-
den – im Gegenteil, sie eskalierten.
Ein schwerer Herzinfarkt, den Herr
Dr. Köhler – Gott sei Dank – überlebt
hat, veranlasst ihn jetzt, aus gesund-
heitlichen Gründen zurückzutreten.
Die Internisten haben für diesen
Schritt volles Verständnis, ist doch
der Posten an der Spitze der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung auch
persönlich extrem belastend.
Der Rücktritt ist aber auch Anlass,
aus der Sicht der Internisten eine
Bilanz der KBV-Epoche Dr. Köhler zu
ziehen. Sowohl die Internisten in der
hausärztlichen als auch der fachärzt-
lichen Versorgungsebene haben man-
che Probleme mit der von Dr. Köhler
vertretenen Honorarpolitik – ange-
fangen beim Stellenwert der haus-
ärztlich tätigen Internisten in ihrer
Versorgungsebene bis hin zum jüngs-
ten Ablauf bei der Entscheidung über
die fachärztliche Grundpauschale.
Die unglückselige Kombination von
Sicherstellungsauftrag und Budget
hat auch Dr. Köhler nicht auflösen
können, da war die Politik strikt
dagegen und eine KV ist eben an
deren Gesetze gebunden. Sie ist eine
Körperschaft und kein Berufsverband.
Schon lange bestanden tiefgreifende
Differenzen zwischen den Hausärzten
und Fachärzten, die die Arbeitsfähig-
keit einer Kassenärztlichen Vereini-
gung immer wieder bedroht haben.
Unter seiner Führung sind beide
Arztgruppen nicht zusammengeführt
worden, sondern mehr denn je ausei-
nander gedriftet.
Der BDI bedankt sich bei Dr. Köhler
für die engagierte Vertretung der
Vertragsärzte und wünscht ihm für
die Zukunft alles Gute nach dem
Motto: Es gibt auch noch ein Leben
nach der KBV!
HFS
Rücktritt von Dr. Andreas Köhler
(Fortsetzung von S. 1)
Alles Gute für das Leben
nach der KBV!
7. Delegiertenversammlung
des Berufsverbandes Deutscher Internisten e.V.
am Samstag, 26. April 2014, 13.30 Uhr,
Nassauer Hof, Raum Jawlensky,
Kaiser-Friedrich-Platz 3-4, 65183 Wiesbaden
Dr. med. Wolfgang Wesiack, Präsident
Bekanntmachung
Tagesordnung:
TOP 1 Genehmigung des Protokolls der 6. Delegiertenver-
sammlung vom 27. September 2013 in Berlin
TOP 2 Bericht des Präsidenten zur aktuellen berufspolitischen
Lage
TOP 3 Bericht aus der Geschäftsstelle des BDI
– Umsetzung der Beschlüsse der 6. Delegiertenver-
sammlung
– Mitgliederentwicklung im BDI e. V.
TOP 4 Erwartungen an die zukünftige Gesundheitspolitik
aus Sicht des BKK-Verbandes
Referent: Franz Knieps – Vorstand BKK Dachverband e.V.
angefragt
TOP 5 Bericht aus den Landesverbänden und Sektionen
TOP 6 Anträge
TOP 7 Verschiedenes
Grundsätzlich hat sich an der
Abrechnung des DRG-Systems nichts
verändert. Der ursprüngliche Gedan-
ke, dass die Investitionskosten in vol-
ler Höhe von dem Steuerzahler über
die Sozialministerien der Länder
getragen werden und die laufenden
Kosten sich durch die DRG abbilden,
die sich an den Ist-Kosten orientie-
ren, dieser Gedanke ist bisher nicht
lupenrein umgesetzt worden. So wird
kolportiert, dass etwa 50 % der Inves-
titionskosten der Krankenhäuser
durch Gewinne aus der DRG-Abrech-
nung finanziert werden müssen,
wenn die Krankenhäuser in ihrer
Substanz erhalten bleiben sollen.
Genau genommen werden damit die
DRG für die Investitionskosten
zweckentfremdet. Dies wäre weniger
schlimm, wenn hier nicht unter-
schiedliche Kostenträger betroffen
wären. Die Krankenkassen bezahlen
heimlich einen wesentlichen Teil der
Investitionskosten in den Kranken-
häusern über ihre Beiträge mit und
entlasten damit den Steuerzahler, der
die Investitionskosten durch das Sozi-
alministerium übernehmen müsste.
Diese Umsetzung der DRG-Finanzie-
rung in den Krankenhäusern hat für
die Länder durchaus Charme. Ohne
dass sie die notwendigen Finanzmit-
tel aufbringen müssen, können sie
über die Verteilung der Gelder
bestimmen, die ihnen von den Kran-
kenkassen indirekt zur Verfügung
gestellt werden – eine elegante
Lösung. Ob dies aber dem Finanzie-
rungssystem der deutschen Kranken-
häuser auf Dauer gut tut, ist mehr als
fraglich. Unter solchen Bedingungen
ist eine vernünftige monistische
Krankenhausfinanzierung noch wei-
ter in die Ferne gerückt.
HFS
Landesbasisfallwerte für die Krankenhäuser sind festgesetzt
Alles beim Alten
Die Landesbasisfallwerte für 2014 sind festgesetzt. Sie liegen
sämtlich über 3.000 Euro. Dabei stehen die Rheinland-Pfälzer mit
3.325 Euro mit großem Abstand an der Spitze.