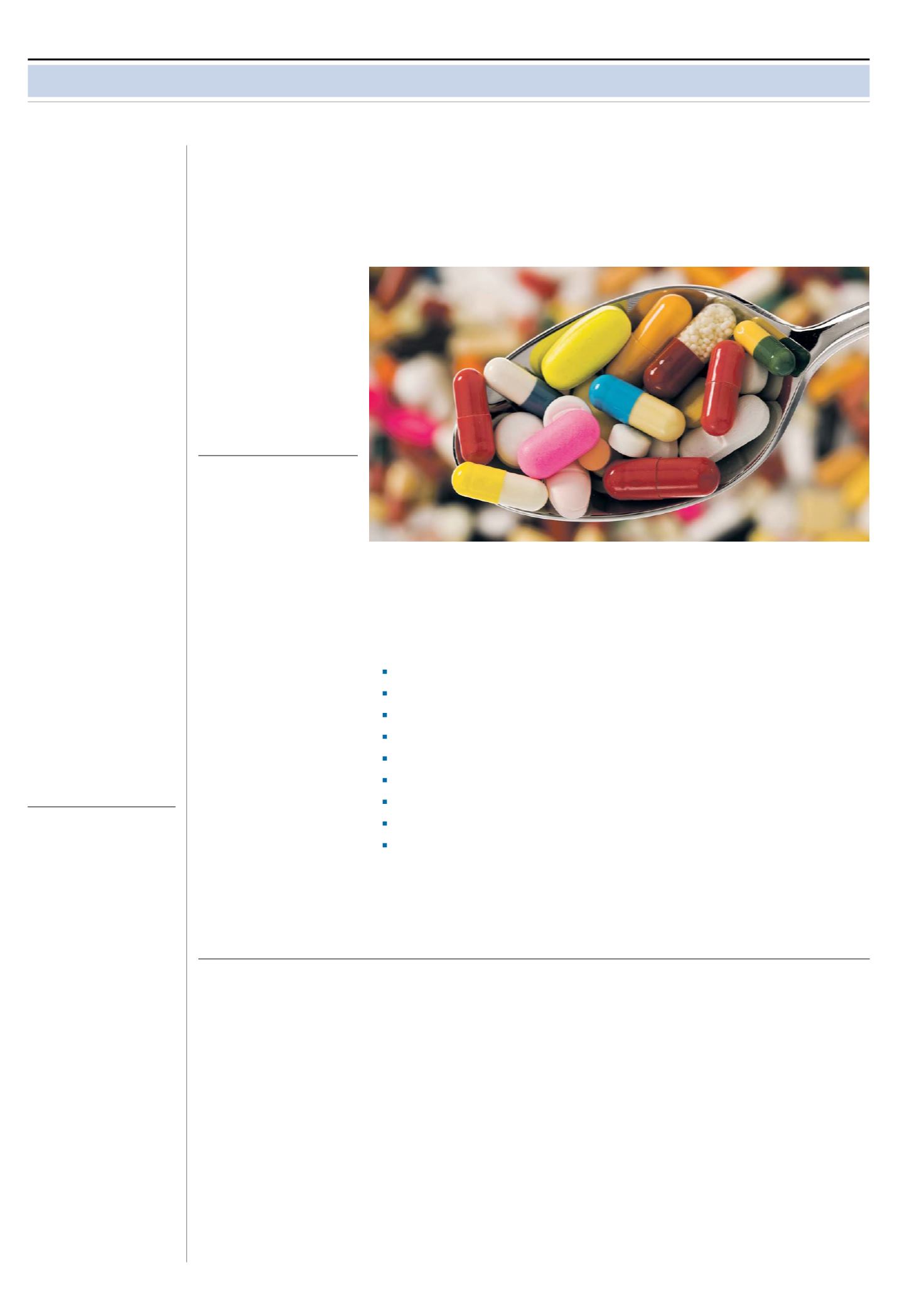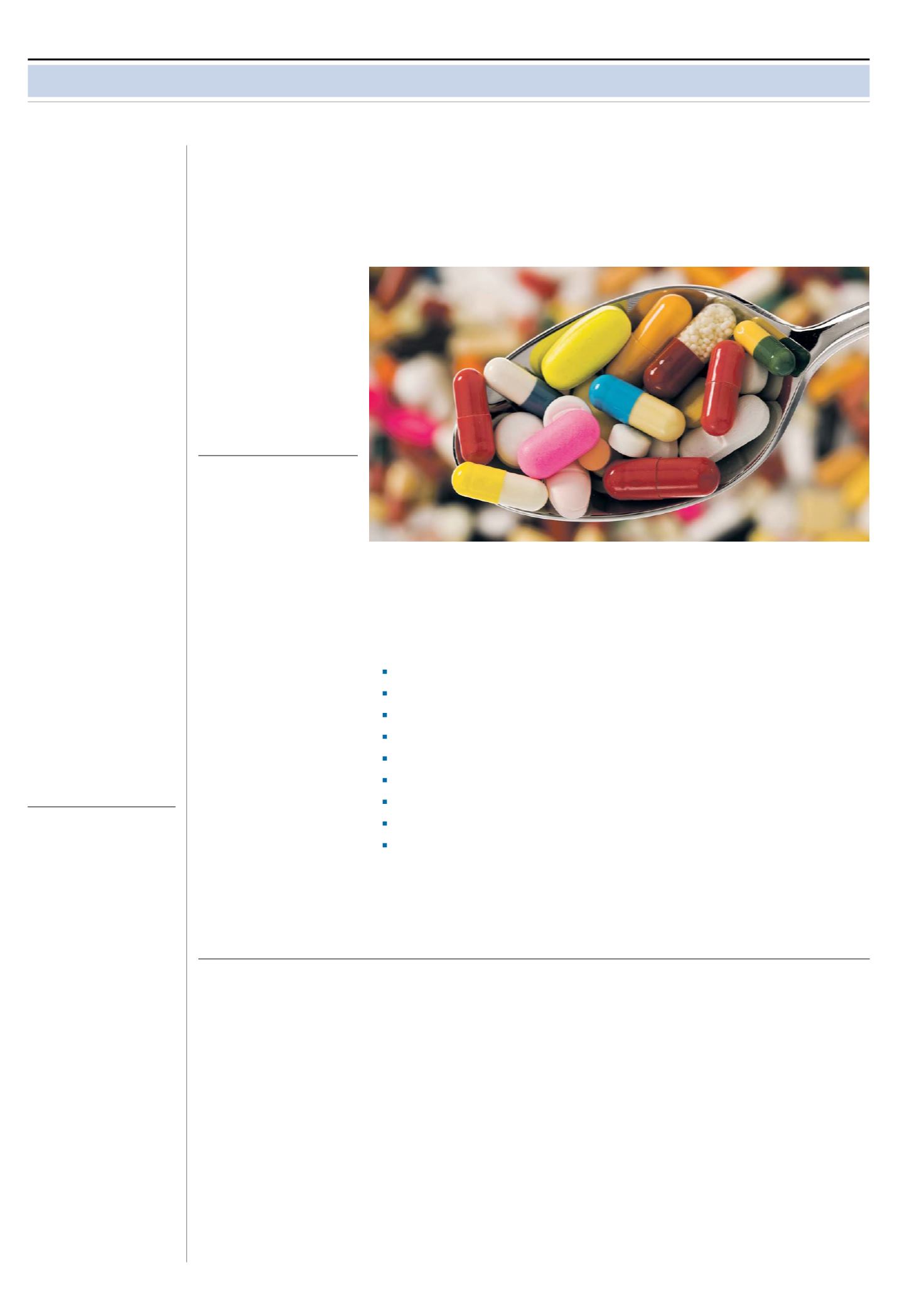
Die meisten Fälle eines Immunrekons-
titutionssyndroms (IRIS) werden bei
AIDS-Patienten unter der Behandlung
von opportunistischen Infektionen
(OI) beobachtet. Eine antiretrovirale
HIV-Therapie führt bereits innerhalb
von wenigen Wochen zu einem starken
Abfall der HI-Viruslast und parallel zu
einer Besserung der zellulären Immu-
nität. In größeren Studien wird von ei-
ner Inzidenz eines IRIS zwischen 7,6
bis 13 Prozent der Fälle bei der Be-
handlung von OI bei HIV-infizierten
Patienten ausgegangen.
Durch das IRIS werden sowohl lo-
kale (z. B. Lymphknotenvergrößerun-
gen, zunehmende pulmonale Infiltrate
oder zerebrale Entzündungsherde) wie
auch systemische Symptome (z. B.
Fieber und Abgeschlagenheit) hervor-
gerufen. Als Risikofaktoren für das
Auftreten eines IRIS wurden bei
HIV-infizierten Patienten beschrieben:
initial niedrige CD-4-Helferzellzahl
( 100/ l), hohe HI-Viruslast, rascher
Anstieg der CD-4-Helferzellzahl und
rascher Abfall der HI-Viruslast unter
der antiretroviralen Therapie.
Die Therapie von autoimmun be-
dingen Erkrankungen mit TNF-Inhi-
bitoren erhöht das Risiko für klassi-
sche Infektionen, OI sowie eine Neu-
infektion mit oder die Reaktivierung
einer latenten Tuberkulose. Auch nach
Absetzen einer Therapie mit Gluko-
kortikosteroiden oder nach dem Ende
einer chemotherapieassoziierten Neu-
tropenie wurden Fälle eines IRIS bei
viralen und invasiven Pilzinfektionen
beschrieben. Weitere Fälle eines IRIS
wurden nach Absetzen von Natalizu-
mab bei Patienten mit multipler Skle-
rose beschrieben, die unter dieser Be-
handlung eine progressive multifokale
Leukenzephalopathie (PML, verur-
sacht durch Reaktivierung einer JC-
Virusinfektion) entwickelt hatten.
Aktuell ließen sich in einer Litera-
turrecherche (Medline) durch den Au-
tor keine Fälle eines IRIS nach Abset-
zen von Therapien mit Abatacept,
Anakinra, Etanercept, Golimumab,
Certolizumab und Tocilizumab identi-
fizieren. Für Rituximab aber wurde ein
Fall sechs Monate nach einer auf Ritu-
ximab basierenden Chemotherapie ei-
nes Lymphoms im Rahmen einer Tu-
berkulose mit schwerer Lymphadeno-
pathie berichtet.
Management bei IRIS-Verdacht
Besteht im klinischen Alltag der Ver-
dacht auf ein IRIS bei einem Patien-
ten, der eine (opportunistische) Infek-
tion unter medikamentöser Immun-
suppression entwickelt hat, müssen
sorgfältig andere mögliche Differenzi-
aldiagnosen zuvor ausgeschlossen wer-
den, da es für ein IRIS keine bewei-
senden Symptomkonstellationen gibt.
So können IRIS-ähnliche Symptome
auch hervorgerufen werden durch eine
fehlende Wirkung der antibiotischen
Therapie bei resistenten Erregern
(z. B. bei multiresistenter Tuberkulo-
se), simultanem Vorliegen einer weite-
ren Infektion mit einem anderen Erre-
ger, fehlender Einnahme der antibioti-
schen Therapie (Non-Compliance)
oder allergischen Reaktionen auf die
eingesetzten Arzneimittel.
Mangels fehlender kontrollierter
Studien ist die Therapie des IRIS der-
zeit noch nicht klar definiert. Bei mil-
der Symptomatik kann eine sympto-
matische Therapie mit NSAR versucht
werden. Analog zu den Erfahrungen
bei HIV-infizierten Patienten kann bei
ausgeprägten Symptomen eine kurz-
zeitige Therapie mit Glukokortikoste-
roiden erwogen werden. Bei vitaler Be-
drohung (z. B. bei einer Trachealkom-
pression durch zervikale Lymphome)
mussten jedoch in Einzelfällen auch
chirurgische Maßnahmen eingesetzt
werden.
Für den Sonderfall eines IRIS bei
Patienten mit PML wurde erst kürz-
lich eine erfolgreiche Prophylaxe/Be-
handlung durch den CCR-5-Antago-
nisten Maraviroc mitgeteilt.
Mit Ausnahme der Fälle einer
HBV-Reaktivierung ohne antivirale
Behandlung konnte in den meisten
Fällen eines IRIS nach Absetzen einer
medikamentösen Therapie im Verlauf
einiger Wochen ein günstiger Ausgang
beobachtet werden.
Iris nach Absetzen von
immunsuppressiver Therapie
Wird bei immunsupprimier-
ten Patienten eine schwere
Infektion diagnostiziert und
behandelt, kann trotz einer
adäquaten antibiotischen
Behandlung eine im Verlauf
wieder erstarkende Funkti-
on des Immunsystems zu
einer sekundären klinischen
Verschlechterung führen.
Von PD Dr. Boris Ehrenstein
IRIS – nicht nur bei HIV-Patienten ein mögliches Problem, sondern auch nach Absetzen einer Therapie mit TNF-Inhibitoren.
© ERWIN W. / PANTHERMEDIA.NET
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
IRIS
Die meisten IRIS-Fälle werden bei
OI beobachtet, die hervorgerufen
werden durch:
Mycobacterium tuberculosis
atypische Mykobakterien
Zytomegalievirus
Cryptococcus spp.
Pneumocystis jirovecii
Herpes-simplex-Virus
Herpes-zoster-Virus
Hepatitis-B-Virus
humanes Herpes-Virus-8
(HHV-8 assoziiertes Kaposisarkom)
Da die wichtigsten Risikofaktoren für
viele Zivilisationserkrankungen Über-
gewicht und Alter sind, war es das Ziel
des Projekts, das biologische Alter ver-
schiedener Gewebe innerhalb des
menschlichen Organismus zu verglei-
chen und damit genauere Erkenntnis-
se über den Zusammenhang zwischen
Übergewicht und gesundheitlichen Ri-
siken bestimmter Organe zu erhalten,
so eine Mitteilung des Universitätskli-
nikums Carl Gustav Carus Dresden
(Proceedings of the National Academy
of Sciences of the USA 2014, online
13. Oktober).
Höheres Risiko für Leberkrebs
Nur bei Leberzellen fand sich eine As-
soziation von Übergewicht und einem
schnelleren Altern des Organs. Dieser
Befund könnte helfen, das erhöhte Ri-
siko von Fettleibigen zu erklären, an
Leberkrebs zu erkranken.
Bisher war es lediglich möglich, das
Altern eines einzelnen Gewebes gut zu
untersuchen. Aber der Vergleich des
Gewebealters zwischen verschiedenen
Organen war eine Herausforderung.
Hier kam den Forschern die „epigene-
tische Uhr“ zu Hilfe, die der Biostatis-
tiker Steve Horvath von der University
of California kürzlich entwickelt hat:
Durch die Analyse von Veränderungen
an der Erbsubstanz lässt sich das Al-
tern der genetischen Informationsver-
packung in der Zelle messen.
So war es möglich, erstmals eine
Reihe von Geweben wie Blut, Muskel,
Fettgewebe und auch Leber auf ihr Al-
ter sowohl bei Normalgewichtigen als
auch überwichtigen und fettleibigen
Patienten zu prüfen.
Risikoerhöhung bleibt bestehen
Der Befund, dass nur die Leber über-
gewichtiger Patienten vorzeitig altert,
wurde auch nach einer Gewichtsab-
nahme nicht wieder zurückgenommen
– die Leber „merkt“ sich also ihr Alter,
zumindest in den von den Forschern
bisher untersuchten Zeiträumen. In
Zahlen gemessen wäre beispielsweise
die Leber bei einer 100 kg schweren
Frau mit einer Größe von 1,65 Me-
tern etwa drei Jahre älter als bei einem
Körpergewicht von 70 kg. Das schnel-
lere Altern der Leber könnte erklären,
warum bestimmte Lebererkrankungen
bei Übergewichtigen deutlich häufiger
vorkommen als bei schlanken Perso-
nen.
Nun wollen die Wissenschaftler den
Mechanismen dieser Alterungsprozes-
se auf den Grund gehen, um therapeu-
tisch eingreifen zu können. Jedenfalls
seien die Ergebnisse ein Argument,
sich um ein normales Körpergewicht
zu bemühen. Das über mehr als fünf
Jahre angelegte Forschungsprojekt
wurde vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) im
Rahmen der Systembiologieinitiative
„Die virtuelle Leber“ gefördert. In den
USA haben die National Institutes of
Health öffentliche Mittel für diese
Forschungen bereitgestellt.
(eb)
Ob bestimmte Gewebe oder
der Körper insgesamt bei
übergewichtigen Menschen
schneller altern, war Gegen-
stand einer Studie. Dafür
nutzten die Forscher den
Ansatz der „epigenetischen
Uhr“.
Übergewicht lässt die Leber schneller altern
Sie kombinierten die Messung eines
gängigen Tumormarkers im Blut
mit einem Test auf bestimmte Ver-
änderungen des Erbguts. Anhand
des genetischen Tests lassen sich
Risikopatienten mit chronischer
Entzündung der Gallenwege (pri-
mär sklerosierende Cholangitis,
PSC), nun erstmals in drei Grup-
pen einteilen, für die – das zeigten
die Forscher in einer Studie – je-
weils ein anderer Grenzwert des
Tumormarkers gilt. Ist dieser über-
schritten, weist dies auf einen Tu-
mor in den Gallenwegen hin.
Der kombinierte Test erwies sich
im Rahmen der Studie als deutlich
zuverlässiger als die reine Messung
des Markers im Blut. „Dieses Ver-
fahren bietet erstmals die Chance,
ohne invasive Eingriffe Tumoren
der Gallenwege früh zu entdecken
und rechtzeitig zu behandeln“, sagt
Seniorautor PD Dr. Daniel Gott-
hardt (Journal of Hepatology
12/2013).
Rund 8000 Menschen in
Deutschland leiden an der seltenen
PSC. Sie tragen ein hohes Risiko,
eine Krebserkrankung der Gallen-
gänge zu entwickeln: Die bösartigen
Tumoren treten bei ungefähr jedem
zehnten Patienten mit PSC, vorwie-
gend Männer im Alter um die 40
Jahre, auf. Diese sind in den ent-
zündlich veränderten und vernarb-
ten Gallengängen im Anfangsstadi-
um mittels bildgebender Verfahren
oder Spiegelungen der Gallengänge
kaum zu diagnostizieren. Auch der
gängige Tumormarker CA 19-9
liefert bisher meist nur vage Hin-
weise.
(eb)
Früherkennung:
Gentest plus
Tumormarker
Heidelberger Kliniker
haben eine Methode zur
Früherkennung von Gal-
lenwegskrebs entwickelt.
GALLENWEGSKREBS
Es gibt eine Reihe möglicher Ursa-
chen dafür, dass sich der Urin
plötzlich rot färbt. Andrew Harris
vom Freeman Hospital in New-
castle Upon Tyne und Kollegen un-
tersuchten Malignitätsraten und Ri-
sikofaktoren von ambulanten Pati-
enten, die sich wegen Makrohämat-
urie in einer Notfallambulanz vor-
gestellt hatten. Bei 29 Prozent der
Patienten fanden sich außerdem
Blutklümpchen. In die retrospektive
Analyse wurden 77 Männer und 19
Frauen mit einem Durchschnittsal-
ter von 68 Jahren eingeschlossen.
Bei der Mehrzahl wurde eine
Krebserkrankung der Blase (15
Neudiagnosen und zwei bekannte)
festgestellt, fast immer war es ein
Urothelkarzinom. Die zweithäufigs-
te Diagnose war Prostatakrebs (bei
14 Patienten, darunter sechs Erstdi-
agnosen). Weitaus seltenere Ursa-
chen für den blutigen Urin waren
Malignome der Niere und des Ho-
dens sowie ein metastasiertes Ko-
lonkarzinom. Koageln scheinen ein
zusätzlicher Hinweis auf ein Krebs-
geschehen zu sein. Als positiven
Vorhersagewert für Malignität er-
rechneten die Autoren für diese Pa-
tienten sogar 50 Prozent.
(st)
Jeder Dritte hat
ein malignes
Geschehen
MAKROHÄMATURIE
14
November 2014
BDI aktuell
Medizin