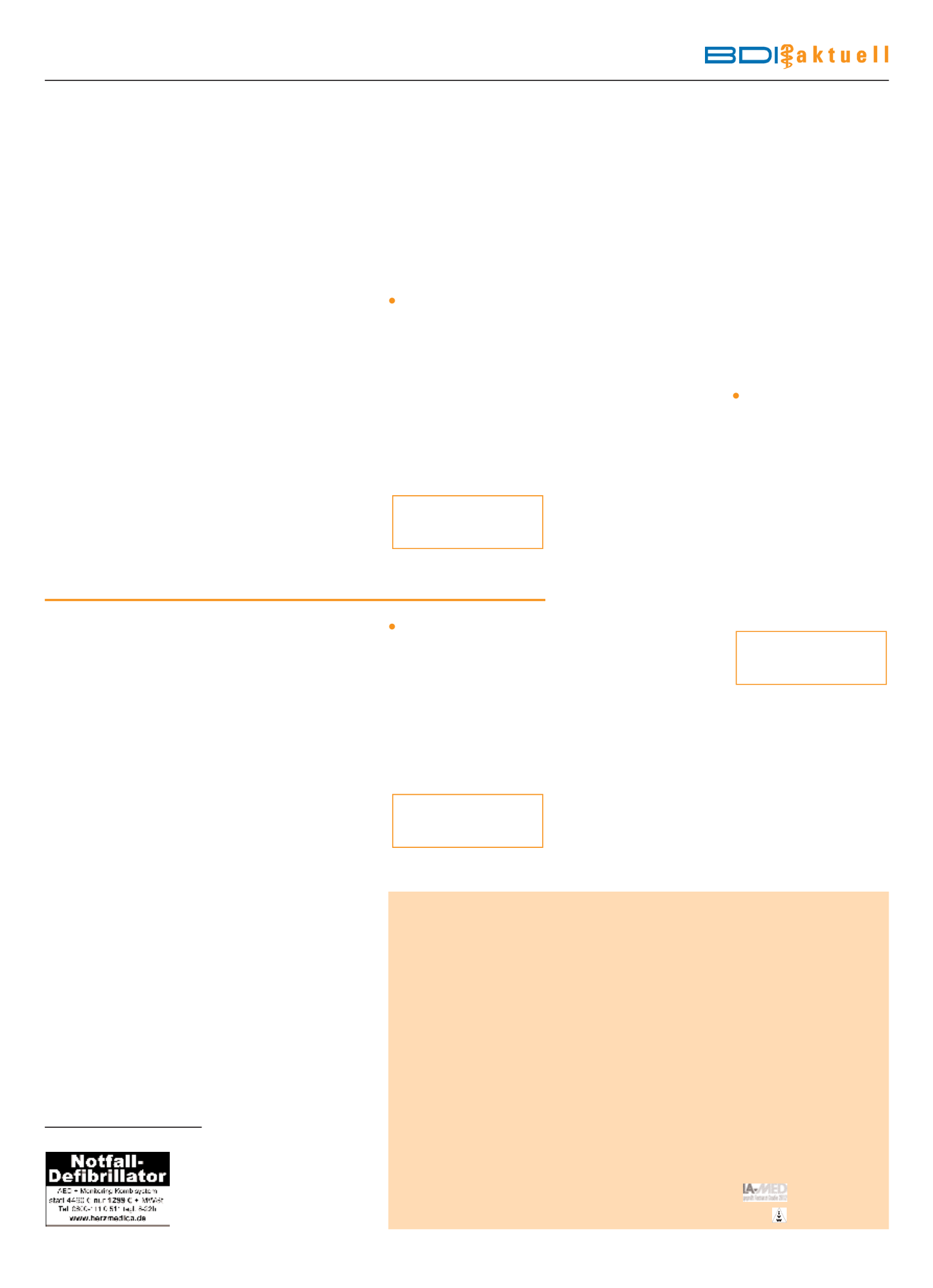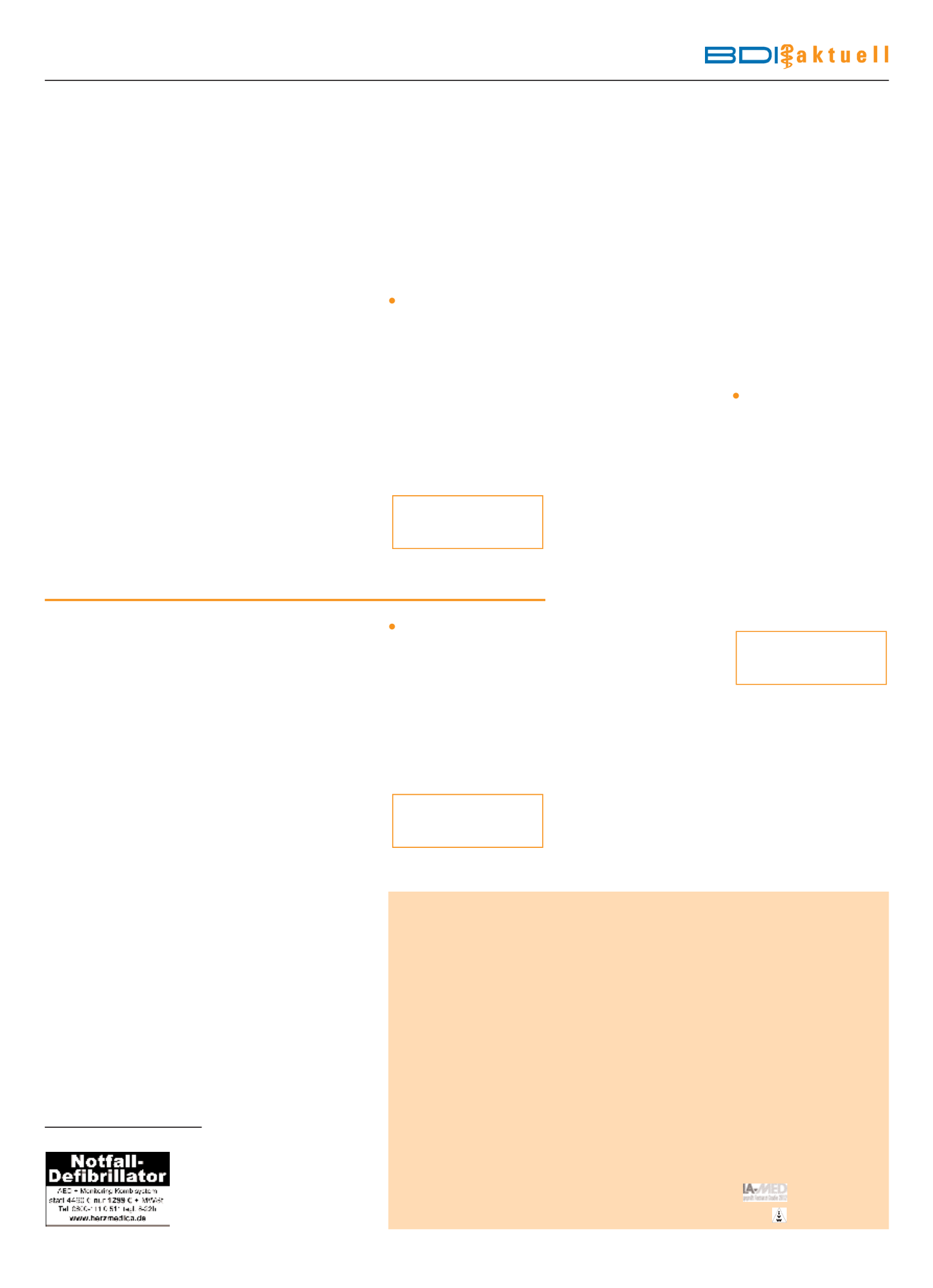
Nr. 4 • April 2014
Medizin
14
Haben Patienten mit Diabetes eine
Proteinurie, erhöht sich das Risiko
einer terminalen Niereninsuffizienz.
Die Blockade des Renin-Angiotensin-
Aldosteron-Systems kann die Entste-
hung einer Proteinurie hinauszögern
und damit eine weitere Reduktion der
glomerulären Filtrationsrate (GFR)
verlangsamen. Effektivität und Sicher-
heit einer solchen doppelten Hem-
mung sind jedoch unklar.
Fried et al. untersuchten Patienten
mit Typ-2-Diabetes, die einen Urin-
Albumin-Kreatinin-Quotienten von
mindestens 300 hatten und deren
GFR zwischen 30,0 und 89,9 ml/min
lag. Die 1448 Probanden wurden mit
100 mg Losartan pro Tag behandelt
und erhielten anschließend 1:1 ran-
domisiert zwischen 10 und 40 mg
Lisinopril täglich oder Placebo. Primä-
rer Endpunkt der Studie war die
Abnahme der GFR (≥30 ml/min bei
GFR ≥60 ml/min bzw. ≥50%, wenn
GFR <60 ml/min gewesen ist), die
Entwicklung einer terminalen Niere-
ninsuffizienz oder Tod. Zu den Sicher-
heitsendpunkten zählten u.a. Mortali-
tät, Hyperkaliämie und akutes Nie-
renversagen.
Aufgrund von Sicherheitsbedenken
wurde die Studie vorzeitig gestoppt.
Die mittlere Nachbeobachtungszeit
lag an diesem Punkt bei 2,2 Jahren.
152 Patienten aus der Monotherapie-
und 132 aus der Kombinationsgruppe
hatten den primären Endpunkt
erreicht (Hazard Ratio mit Kombinati-
onstherapie 0,88; 95%-Konfidenzin-
tervall 0,70–1,12; p=0,30). Hinsicht-
lich Mortalität oder kardiovaskulärer
Ereignisse gab es keinen Unterschied.
Die Kombinationstherapie erhöhte
jedoch signifikant das Risiko für
Hyperkaliämien und akutes Nieren-
versagen.
Fazit
Bei Patienten mit diabetischer Neph-
ropathie erhöhte die Kombinations-
therapie mit ACE-Hemmern und
Angiotensin-Rezeptor-Blockern die
Rate schwerer Nebenwirkungen signi-
fikant gegenüber einer Monotherapie.
Sponsoring: Die Studie wurde von
einer öffentlichen Institution finanziell
unterstützt.
Dr. med. Christoph Feldmann
Der Beitrag ist erstmals erschienen in der
Deutschen Medizinischen Wochenschrift
(Dtsch Med Wochenschr 2014; 139: 310).
Alle Rechte vorbehalten.
Die Kombinationstherapie mit ACE-Inhibitoren und Angiotensin-
Rezeptor-Blockern vermindert eine Proteinurie. Sicherheit und
Auswirkung der Therapie auf die diabetische Nephropathie sind
aber unklar.
N Engl J Med 2013; 369: 1892–1903
Nephrologie – Diabetologie
Diabetische Nephropathie:
Kombinierte Angiotensin-
Hemmung schädlich
Eine Phase-3-Studie mit etwa 8 300
Teilnehmern zeigte, dass die Einnah-
me von Edoxaban 1 × pro Tag genauso
wirksam ist wie die Einnahme von
Warfarin hinsichtlich der Prävention
venöser Thromboembolien. Die Lang-
zeitwirkung und -sicherheit bei
Patienten mit Vorhofflimmern im
Vergleich zu Warfarin wurde nun im
Rahmen einer randomisierten, dop-
pelblinden Studie mit 21 105 Patien-
ten untersucht.
Die Probanden bekamen entweder
Edoxaban 30 mg, 60 mg oder Warfa-
rin (Ziel-INR 2,0–3,0). Die mittlere
Nachbeobachtungszeit betrug 2,8
Jahre. Primärer Wirksamkeitsend-
punkt war das Auftreten von Schlag-
anfall oder Embolie. Sicherheitsend-
punkt waren schwere Blutungen.
Auf ein Behandlungsjahr umgerech-
net, lag die Rate für das Auftreten des
primären Endpunkts unter Warfarin
bei 1,5% vs. 1,18% unter Edoxaban
60 mg/Tag (Hazard Ratio [HR] 0,79;
97,5%-Konfidenzintervall [KI] 0,63–
0,99; p<0,001 für Nichtunterlegen-
heit). Unter Edoxaban 30 mg/Tag lag
die Rate im Vergleich zu Warfarin bei
1,61% (HR 1,07; 97,5%-KI 0,87–1.31;
p=0,005 für Nichtunterlegenheit). In
der Intention-to-treat-Analyse schnitt
Edoxaban 60 mg/Tag verglichen mit
Warfarin im Gegensatz zu 30 mg/Tag
Edoxaban verglichen mit Warfarin
besser ab. Die jährliche Rate an
schweren Blutungen betrug unter
Warfarin 3,43% vs. 2,75% unter Edoxa-
ban 60 mg (HR 0,80; 95%-KI 0,71–
0,91; p<0,001). Unter Edoxaban 30
mg lag die Rate bei 1,61% (HR 0,47;
95%-KI 0,41–0,55; p<0,001). Die jähr-
liche Rate an Todesfällen aus kardio-
vaskulären Gründen lag mit Warfarin
bei 3,71% vs. 2,74% Edoxaban 60 mg
(HR 0,86; 95%-KI 0,77–0.97; p=0,01)
und 2,71% Edoxaban 30 mg (HR 0,85;
95%-KI 0,76–0,96; p=0,008).
Fazit
Edoxaban ist Warfarin laut den Autoren
hinsichtlich Prävention von Schlagan-
fall und Embolien nicht unterlegen.
Außerdem ist es mit signifikant weni-
ger Blutungsereignissen und Todesfäl-
len kardiovaskulärer Ursache assoziiert.
Sponsoring: Die Studie wurde von
Daiichi Sankyo finanziell unterstützt.
Dr. med. Markus Escher
Der Beitrag ist erstmals erschienen in der
Deutschen Medizinischen Wochenschrift
(Dtsch Med Wochenschr 2014; 139: 310).
Alle Rechte vorbehalten.
Der Faktor-Xa-Inhibitor Edoxaban hat eine nachgewiesen anti-
thrombotische Wirkung. Giugliano et al. untersuchten nun die
Langzeiteffektivität und -sicherheit bei Patienten mit Vorhofflim-
mern im Vergleich zu Warfarin.
N Engl J Med 2013; 369: 2093–2104
Kardiologie – Pharmakologie
Edoxaban ist Warfarin auch
bei Langzeitanalysen nicht
unterlegen
BDI aktuell wird vom Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) e.V. herausgegeben und erscheint im Georg Thieme Verlag KG. Die Zeitung erscheint
monatlich mit Doppelnummer im August/September. BDI-Mitglieder erhalten BDI aktuell im Rahmen ihres BDI-Mitgliedsbeitrags.
Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) e.V.
•
• Schöne Aussicht 5, 65193 Wiesbaden • Tel.: 0611/181 33-0 • Fax: 0611/181 33-50
• E-Mail:
• Präsident: Dr. med. Wolfgang Wesiack • Geschäftsführer: Tilo Radau
Georg Thieme Verlag KG
Stuttgart New York •
• Rüdigerstr. 14, 70469 Stuttgart • Tel.: 0711/8931-0, Fax: 0711/8931-235
• E-Mail:
Redaktion:
Chefredakteur: Dr. med. Hans-Friedrich Spies (HFS), V.i.S.d.P • Redaktion (Mantelteil): Dr. med. Stefanie Conrads • Layout-Entwurf (Mantelteil):
Michael Zimmermann • Layoutentwurf und Redaktion (Kongresse & Services) sowie Herstellung und Layout: Andrea Hartmann
• Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, Leibnizstraße 5, 97204 Höchberg
Weitere Mitarbeiter und Autoren dieser Ausgabe:
Klaus Schmidt (KS) sowie die namentlich unter den Artikeln genannten Autorinnen und Autoren
Anzeigenverwaltung/-leitung:
Manfred Marggraf, pharmedia Anzeigen- und Verlagsservice GmbH, Rüdigerstr. 14, 70469 Stuttgart, Tel.: 0711/8931-
464, Fax: 0711/8931-470, E-Mail:
• Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6.
Kleinanzeigen
schicken Sie bitte an die BDI-Geschäftsstelle (Adresse s.o.) oder an
Wichtiger Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere
Erkenntnisse, insbesondere was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Heft eine Dosierung oder eine Applikation
erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass die Autoren und der Verlag große Sorgfalt daran verwandt haben, dass diese Angabe dem Wis-
sensstand bei Fertigstellung der Zeitung entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine
Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der verwendeten Präparate und gegebenen-
falls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindikationen
gegenüber der Angabe in dieser Zeitung abweicht. Eine solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten oder solchen, die neu
auf den Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden
Benutzer, ihm auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen. Geschützte Warennamen werden nicht in jedem Fall besonders kenntlich gemacht.
Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien
Warennamen handelt.
Copyright:
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset-
zungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Impressum
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
LA-MED Kommunikationsforschung
im Gesundheitswesen e. V.
Mitglied der Informationsgemein-
schaft zur Feststellung der Verbrei-
tung von Werbeträgern e. V.
– Anzeige –
Am Beispiel der Migränetherapie überprüften Meissner et al.,
ob unterschiedliche Arten von Placebo mit verschiedenen Effekt-
stärken einhergehen.
JAMA Intern Med 2013; 173: 1941–1951
Neurologie
Art der Placebo-Therapie
beeinflusst Effektstärke deutlich
Die Wirksamkeit eines Placebo hängt
u.a. davon ab, wie es verabreicht
wird. Für manche Studien können
solche Faktoren entscheidend das
Ergebnis beeinflussen, etwa bei der
Untersuchung chronischer Schmer-
zen oder ansonsten eher subjektiver
Symptome.
Die Autoren durchsuchten die gängi-
gen Datenbanken und schlossen ran-
domisierte, placebokontrollierte
Untersuchungen ein, in denen
Erwachsene zur Vorbeugung von
Migräneattacken mindestens
8 Wochen beobachtet wurden.
Die Daten von 9278 Patienten aus
79 Studien wurden ausgewertet. Als
primären Endpunkt beschrieben die
Autoren die Ansprechrate: Als „res-
ponder“ galt, wer um mindestens
50% seltener Migräneattacken erlitt
als zuvor (ersatzweise: Halbierung
der migräne-/kopfschmerzfreien
Tage, des Kopfschmerz-Scores oder
eine signifikante Symptomverbesse-
rung). Placebo gab es anstelle eines
oral eingenommenen Medikaments
oder pflanzlichen, homöopathischen
oder Vitamin-Präparaten. In einigen
Untersuchungen erfolgte eine kogni-
tive Verhaltenstherapie zum Schein,
in anderen führten Ärzte eine Place-
boinjektion oder -akupunktur durch.
Auch scheinbar elektromagnetische
Behandlung und Scheinoperationen
wurden durchgeführt.
Insgesamt war die aktive Therapie
effektiver als Placebo (relatives Risi-
ko 1,4; 95%-Konfidenzintervall [KI]
1,23–1,59). Die Placebo-Akupunktur
ging mit einem hohen Responder-
Anteil [RA] von 0,38 einher (95%-KI
0,30–0,47). Auch die Chirurgie zeigte
deutliche Effekte, für ein eindeutiges
Ergebnis lagen jedoch zu wenige
Daten vor. Orale Placebo-Gaben zeig-
ten sich weniger wirksam (RA 0,22;
95%-KI 0,17–0,28).
Fazit
Nichtspezifische Wirkungen können
einen großen Teil der beobachteten
Wirkung ausmachen – und zwar
eine Schein-Akupunktur oder
-Operation deutlicher als ein orales
Placebo. Aktive Therapien sollten
nach Meinung der Autoren auch
direkt miteinander verglichen wer-
den, um die beschriebenen Placebo-
effekte auszuschließen.
Sponsoring: Die Studie wurde von
einer öffentlichen Institution finan-
ziell unterstützt.
Dr. med. Susanne Meinrenken
Der Beitrag ist erstmals erschienen in der
Deutschen Medizinischen Wochenschrift
(Dtsch Med Wochenschr 2014; 139: 362).
Alle Rechte vorbehalten.