Basic HTML-Version











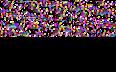





















Nr. 8/9 • August 2012
5
Berufspolitik
,QQHUH 0HGL]LQ
7HOHIRQEHVWHOOXQJ
.XQGHQVHUYLFH
#WKLHPH GH
)D[EHVWHOOXQJ
ZZZ WKLHPH GH
-HW]W EHVWHOOHQ YHUVDQGNRVWHQIUHLH /LHIHUXQJ LQQHUKDOE 'HXWVFKODQGV
5LFKWLJ IRNXVVLHUW
/HUQHQ LQ DOOHQ 3KDVHQ GHU :HLWHUELOGXQJ
*DUDQWLHUWH 6LFKHUKHLW
([DNW QDFK GHQ 5LFKWOLQLHQ
GHU '(*80 XQG GHU .%9
2SWLPDOH *HUlWHHLQVWHOOXQJ
XQG %LOGLQWHUSUHWDWLRQ
.ODUH ,QVWUXNWLRQHQ
]XP 8QWHUVXFKXQJVDEODXI
$OOH 'RSSOHUYHUIDKUHQ LQ HLQHP %XFK
0HWKRGHQ
GLIIHUHQ]LHUW HLQVHW]HQ
$XVIKUOLFKH 'DUVWHOOXQJ GHU 'LDJQRVWLN
YRQ
DOOHQ SHULSKHUHQ XQG QLFKWSHULSKHUHQ *HIlHQ
hEHU
QHXH $EELOGXQJHQ
]X %HIXQGHQ
DOOHU *HIlSURYLQ]HQ
,QKDOWOLFK DXI GHP QHXHVWHQ 6WDQG
QHXHV $XWRUHQWHDP QHXH .DSLWHO
'XUFKEOLFN DXFK RKQH (OHNWURWHFKQLN 6WXGLXP
9HUVWlQGOLFK KDQGOXQJVRULHQWLHUW SUD[LVQDK
LQ GHU $XIODJH
&DUGLDF 5K\WKP 0DQDJHPHQW &50
ls ,QWHJULHUWH 'DUVWHOOXQJ YRQ +HU]VFKULWWPDFKHUQ
XQG ,&'V
6\QNRSHQ XQG $UUK\WKPLHGLDJQRVWLN
ls /HLWOLQLHQJHVWW]WH $OJRULWKPHQ
'HYLFH 7KHUDSLH GHU +HU]LQVXIIL]LHQ]
ls .DUGLDOH 5HV\QFKURQLVDWLRQVWKHUDSLH &57
ls &DUGLDF &RQWUDFWLOLW\ 0RGXODWLRQ &&0
6\VWHPDWLVFKH $QDO\VH YRQ 60 ,&' (.*V
ls Å7URXEOH 6KRRWLQJ´ LQ W\SLVFKHQ 6LWXDWLRQHQ
7HOHNDUGLRORJLH PLW 5K\WKPXVLPSODQWDWHQ
2SWLPDOH %HIXQGVLFKHUKHLW
6FKQHOO XQG VLFKHU ]XU ULFKWLJHQ 'LDJQRVH
.ODUH ,QGLNDWLRQVNULWHULHQ
:HOFKH )UDJHVWHOOXQJHQ
N|QQHQ EHDQWZRUWHW ZHUGHQ"
:DV OHLVWHW GDV 9HUIDKUHQ LP
9HUJOHLFK LQ (UJlQ]XQJ
]X NRPSOHPHQWlUHQ 0HWKRGHQ"
hEHUVLFKWVWDEHOOHQ GHU GLDJQRVWLVFKHQ .ULWHULHQ
DXVIKUOLFKH %LOGOHJHQGHQ
2ULHQWLHUW DQ GHQ NOLQLVFKHQ )UDJHVWHOOXQJHQ
)DVW
EULOODQWH $EELOGXQJHQ
XQG 9HUJOHLFKVELOGHU
$NWLYHV %HIXQGXQJVWUDLQLQJ PLW '9'
)DVW
)DOOEHLVSLHOH XQG EHU
%LOGVFKOHLIHQ
7\SLVFKH %HIXQGH XQG 9DULDQWHQ *UHQ]HQ QRUPDO
SDWKRORJLVFK
+HU]VFKULWWPDFKHU
XQG 'HILEULOODWRUWKHUDSLH
)U|KOLJ &DUOVVRQ -XQJ .RJOHN
/HPNH 0DUNHZLW] 1HX]QHU
+DOEM
YROOVW EHUDUE $XIO
&D 6 FD
$EE JHE
,6%1
&D
ʣ >'@
&D ² ʣ >$@ FD ² &+)
.XUVEXFK 'RSSOHU
XQG 'XSOH[VRQRJUDILH
$PDQQ 9HVWL 7KDOKDPPHU
+XFN +UVJ
YROOVW EHUDUE X DNW $XIO
6
$EE JHE
3OXV '9'
,6%1
ʣ >'@
² ʣ >$@
² &+)
7UDQV|VRSKDJHDOH
(FKRNDUGLRJUDILH
/DPEHUW] /HWKHQ +UVJ
&D +DOEM
DNW X HUZ $XIO
&D 6 FD
$EE JHE
%XFK LQNO '9'
,6%1
&D
ʣ >'@
&D
ʣ >$@ FD ² &+)
'9' PLW ]DKOUHLFKHQ
%HLVSLHOILOPHQ
7
Die 10 Thesen von Spahn beinhalten
folgende Punkte:
1. Spahn sieht im deutschen Gesund-
heitswesen drei große Qualitäts-
merkmale: eine flächendeckende
Versorgung rund um die Uhr, einen
schnellen Zugang zu medizinischen
Innovationen und – so wörtlich –
den unmittelbaren Zugang zur
medizinischen Grundversorgung,
die er als Versorgung definiert, die
„das Maß des Notwendigen“ nicht
überschreitet. Er äußert sich somit
indirekt zum Leistungskatalog –
allein dies ist bemerkenswert – und
spricht von der Grundversorgung in
einem zukünftigen Gesundheitswe-
sen. Wie bei allen Politikern fehlt
die Aussage, wer diesen Katalog
zeitnah definieren soll.
2. Gesundheit und Pflege werden in
der Zukunft teurer. Dies müsse von
der Politik kommuniziert werden.
Hier fällt auf, dass er sich nicht –
wie sonst üblich – auf eine Finan-
zierung allein durch Einsparungen
im System zurückzieht.
3. Spahn sieht Gesundheitspolitik als
eine Maßnahme zur sozialpoliti-
schen Versorgung an. Er vergisst
aber nicht den wichtigen Hinweis,
dass 4,5 Millionen Beschäftigte 10 %
des Bruttosozialproduktes erwirt-
schaften. Die Gesundheitswirtschaft
soll wegen dieser „wirtschafts- und
wachstumspolitischen Komponen-
te“ gefördert werden.
4. Hier übt Spahn Kritik an der seithe-
rigen Gesundheitspolitik, die nahe-
zu rein über die Kostendämpfung
definiert werden muss. Die Forde-
rung lautet folgerichtig, die aus-
schließliche Abhängigkeit von den
Lohnkosten zu durchbrechen.
5. Kostensteigerungen der Zukunft
sollten durch einen zusätzlichen
lohnunabhängigen Zusatzbeitrag
finanziert werden. Um den Bei-
tragszahler damit nicht zu überfor-
dern, gibt es einen steuerfinanzier-
ten Sozialausgleich, vor allem um
auch Zins-, Miet- oder Dividenden-
einnahmen aber auch Unterneh-
mensgewinne mit einzubeziehen.
Er fordert im Gegensatz zu den
Oppositionsparteien keinen an
zusätzlichen Einnahmen orientier-
ten Beitrag, sondern eine lupenrei-
ne zusätzliche Steuerfinanzierung.
Man kann Spahns Vorstellung so
interpretieren: Die GKV der
Zukunft wird weiter über lohnab-
hängige, aber eingefrorene Beiträge
über einen Zusatzbeitrag pro Versi-
cherten und über die Steuern finan-
ziert werden. Deren Anteil dürfte
mit Sicherheit kontinuierlich stei-
gen.
6. Spahn möchte von den von den
Oppositionsparteien geschürten
Neiddebatten weg. Er erwähnt aus-
drücklich die angeblichen solidari-
schen „Besserverdiener“ und die
kürzeren Wartezeiten für Privatver-
sicherte.
7. In diesem Punkt geht es um die
Zukunft der PKV, deren „Verfassung
und Verfasstheit“ zur Disposition
gestellt wird. Er beklagt die Bei-
tragssteigerungen, die arme und
reiche Privatversicherte gleicher-
maßen treffen und die unsozialen
Billigtarife. Die „Provisions- und
Vertriebsexzesse“ werden ange-
prangert. Seine Analyse endet mit
dem Satz: „Da ist nicht nur etwas
faul.“
8. Er mahnt die sozialpolitische Kom-
ponente des PKV-Systems an, ohne
direkt die Gleichschaltung und Ori-
entierung an der GKV zu fordern.
Dies wäre aber folgerichtig.
9. Die „Dualität“ des Systems PKV/
GKV müsse durch eine Beseitigung
der in Punkt 8 beschriebenen Män-
gel reformiert werden. Wie es bei
einer zunehmend inhaltlichen
Angleichen von PKV und GKV dabei
weiter zu einem Wettbewerb kom-
men sollt, wird von Spahn nicht
näher erläutert.
10. Abschließend folgt ein Bekenntnis
zur Freiberuflichkeit des Arztes, wie
es sich bei einer Vorstellung auf
einem Deutschen Ärztetag gehört.
Er will keine angestellten Ärzte, wie
z. B. in Großbritannien, und hofft
auf eine Rechtsprechung, die den
Vertragsarzt nicht zum Amtsträger
macht. Es ist zu befürchten, dass
sich davon unsere obersten Gerichte
in ihrer anstehenden Entscheidung
nicht beeindrucken lassen.
Keine Abschaffung sondern
Reform der PKV
Im Klartext: Spahn will keine
Abschaffung der PKV und damit auch
keine gleichgeschaltete Bürgerversi-
cherung. Die PKV soll aber reformiert
werden und sich dabei an den Ele-
menten der GKV orientieren. Ob bei
diesem Vorgehen noch relevante
Unterschiede zwischen PKV und GKV
am Ende übrig bleiben, muss hinter-
fragt werden. Sein Motto lautet
„Gleichschaltung nein – Angleichung
ja“. Da bleibt für zukünftige Verhand-
lungen zwischen Parteien bei einer
eventuellen Regierungsbildung noch
genügend Spielraum zur Kompro-
misslösung in Richtung Bürgerversi-
cherung.
HFS
Aufklärung zur
Bürgerversicherung?
Das 10-Punkte-Papier von Jens Spahn
Beim Deutschen Ärztetag in Nürnberg hat Jens Spahn (CDU) 10 The-
sen zu „Anforderungen an eine gesetzliche Krankenversicherung in
der Zukunft“ vorgelegt. Er war in den letzten Wochen durch Äuße-
rungen aufgefallen, die die Stellung der privaten Krankenversiche-
rung als zweiten Arm der Versorgung in Frage stellten. Zumindest ist
dies in der Öffentlichkeit so angekommen. Dies hat vor allem deshalb
viel Aufmerksamkeit erregt, weil man doch gerade von der CDU
erwartet hat, dass sie die private Krankenversicherung in der derzei-
tigen Form verteidigt und nicht in Frage stellt.

